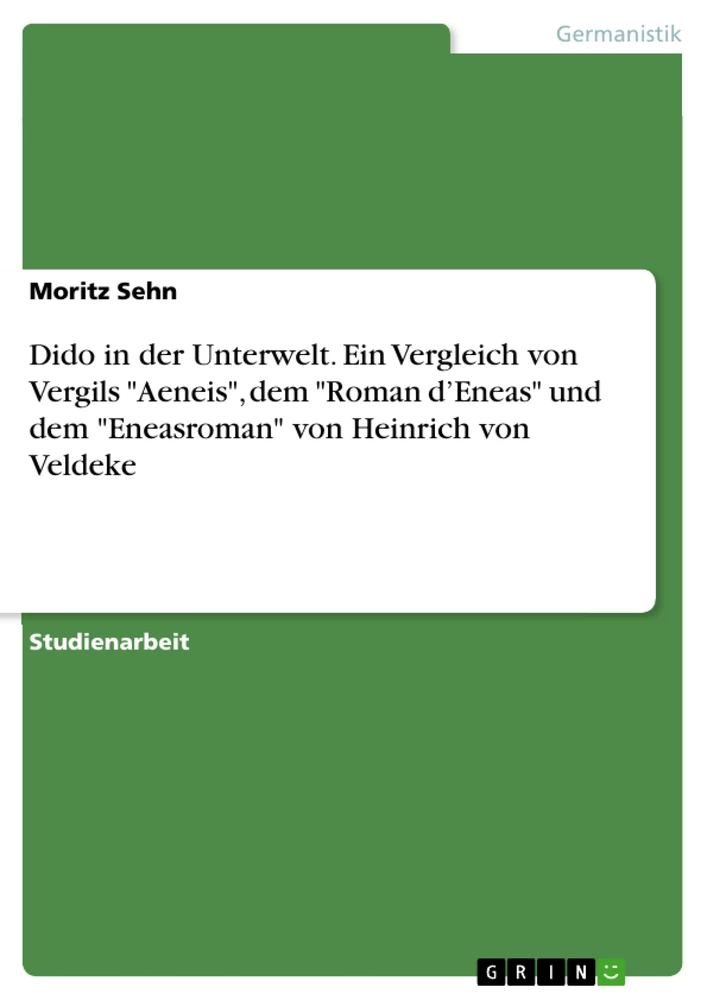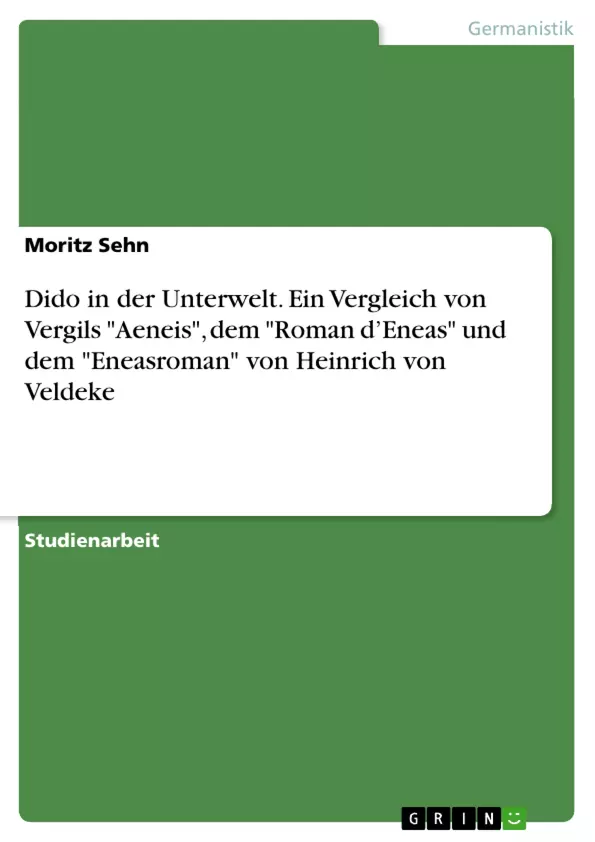Der "Eneasroman" Heinrichs von Veldeke wurde im Jahre 1183 fertig gestellt und erstmals einem höfischen Publikum vorgetragen. Der im Eneasroman behandelte Stoff jedoch wurde zuvor schon in altfranzösischer Sprache im "Roman d’Eneas" von einem anonymen Verfasser publiziert und war Veldeke bekannt. Beide mittelalterlichen Fassungen – die mittelhochdeutsche und die altfranzösische – gehen im Ursprung auf die lateinische Vorlage der "Aeneis" des antiken Dichters Vergil zurück.
Die differenzierte Untersuchung der von Veldeke übernommenen Aspekte seiner Vorlagen, sowie der Abweichungen selbiger sollen in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehen. Exemplarisch dafür soll die Unterweltfahrt des Protagonisten dienen, da sie wie keine andere Szene zu zeigen vermag, inwiefern sich die drei Versionen des Stoffes unterscheiden.
Die Figur der Dido, auf deren Darstellung diese Arbeit ihren Fokus legt, hat in allen drei behandelten Werken einen vergleichsweise kurzen Auftritt, oder gar eine Nebenrolle, neben der Dominanz der Rolle es Eneas.
Nichts desto trotz – und das versucht diese Arbeit zu zeigen – ist die Darstellung der Dido in der Unterwelt in hohem Maße semantisch beladen und somit eine vertiefende Untersuchung wert.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Die Unterweltfahrt
- Abstieg und Gang durch die Unterwelt
- Begegnung mit Dido
- Ort und Umfang
- Kommunikationsart
- Schuldfrage
- Resümee
- Ursachen für die abweichenden Bearbeitungen
- Wiedererzählen
- Theologische Aspekte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Darstellung der Figur der Dido in der Unterwelt in Vergils Aeneis, dem Roman d’Eneas und dem Eneasroman Heinrichs von Veldeke. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der drei Versionen aufzuzeigen und Erklärungsansätze dafür zu liefern.
- Die unterschiedlichen Darstellungen der Sibylle als Wegweiserin in die Unterwelt.
- Die semantische Bedeutung der Begegnung Eneas' mit Dido in den drei Texten.
- Die Rolle des Selbstmordes und die Frage nach der Schuldzuweisung für Didos Tod.
- Die Modifikationen der antiken Vorlage durch die mittelalterlichen Bearbeiter im Kontext des christlichen Weltbildes.
- Die unterschiedlichen Interpretationen des Traumes und der Seelenwanderung in den drei Versionen.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beleuchtet den Kontext der Entstehung der drei Versionen. Die Unterweltfahrt wird im zweiten Kapitel analysiert, wobei besonderes Augenmerk auf den Abstieg des Protagonisten und die Begegnung mit Dido gelegt wird. Es werden die verschiedenen Orte und Formen der Verstorbenen sowie die unterschiedlichen Kommunikationsformen zwischen Eneas und Dido in den drei Texten untersucht. Ein Schwerpunkt liegt auf der Schuldfrage, die durch die Darstellung des Selbstmordes Didos aufgeworfen wird.
Im dritten Kapitel werden die Ursachen für die abweichenden Bearbeitungen betrachtet. Dabei werden sowohl die Prinzipien des Wiedererzählens und der ‚tractatio materiae‘ beleuchtet als auch die theologischen Aspekte, die die mittelalterlichen Autoren bei der Adaption der antiken Vorlage beeinflusst haben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Dido, Unterweltfahrt, Selbstmord, Schuldzuweisung, antike Vorlage, mittelalterliche Bearbeitungen, Aeneis, Roman d’Eneas, Eneasroman, Vergil, Heinrich von Veldeke, christliches Weltbild, ‚tractatio materiae‘, Wiedererzählen, theologische Aspekte, Traum, Seelenwanderung.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Dido in der antiken Mythologie?
Dido war die legendäre Gründerin und Königin von Karthago, die sich aus Liebe zu Eneas das Leben nahm, als dieser sie verließ.
Wie unterscheidet sich Veldekes „Eneasroman“ von Vergils „Aeneis“?
Veldeke adaptiert den antiken Stoff für das höfische Publikum des Mittelalters und integriert christliche Moralvorstellungen sowie höfische Minne-Ideale.
Was geschieht bei der Begegnung in der Unterwelt?
Eneas trifft die verstorbene Dido. Während sie bei Vergil schweigt, untersuchen die mittelalterlichen Fassungen die Schuldfrage und die Kommunikation zwischen den beiden neu.
Wie bewertet das Mittelalter Didos Selbstmord?
Im Gegensatz zur Antike wird der Selbstmord im christlich geprägten Mittelalter oft theologisch kritischer betrachtet, was sich in der Darstellung der Unterwelt widerspiegelt.
Was ist der „Roman d’Eneas“?
Dies ist eine anonyme altfranzösische Bearbeitung der Aeneis, die als direkte Vorlage für Heinrich von Veldeke diente.
Welche Rolle spielt die Sibylle in der Unterweltfahrt?
Die Sibylle fungiert als prophetische Wegweiserin, deren Darstellung sich von einer göttlichen Seherin zur mittelalterlichen weisen Frau wandelt.
- Quote paper
- Moritz Sehn (Author), 2014, Dido in der Unterwelt. Ein Vergleich von Vergils "Aeneis", dem "Roman d’Eneas" und dem "Eneasroman" von Heinrich von Veldeke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319532