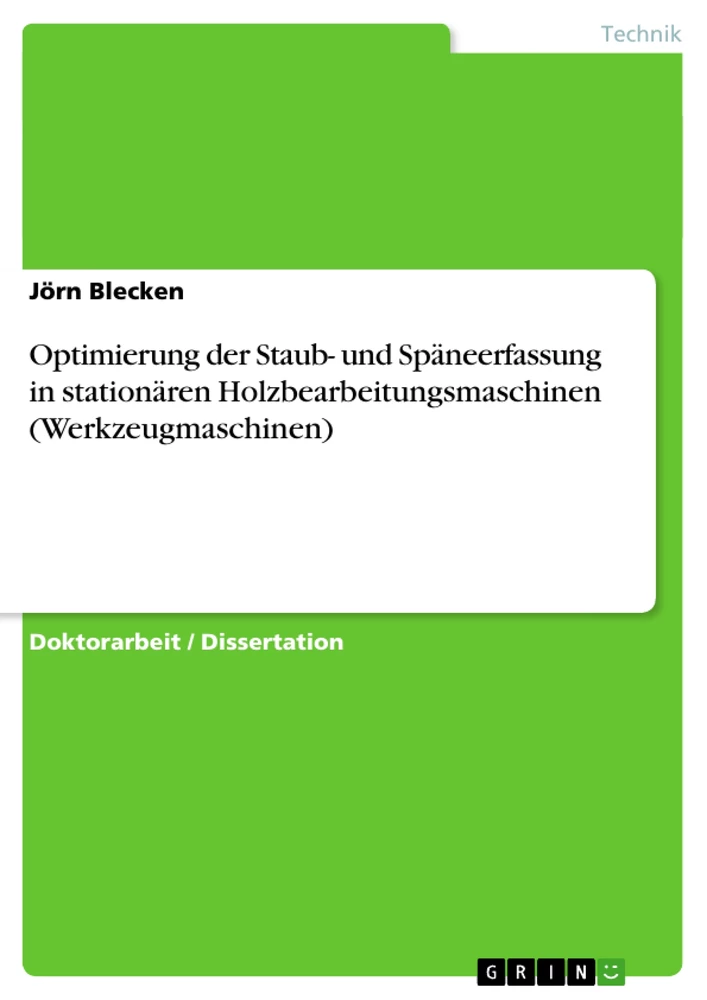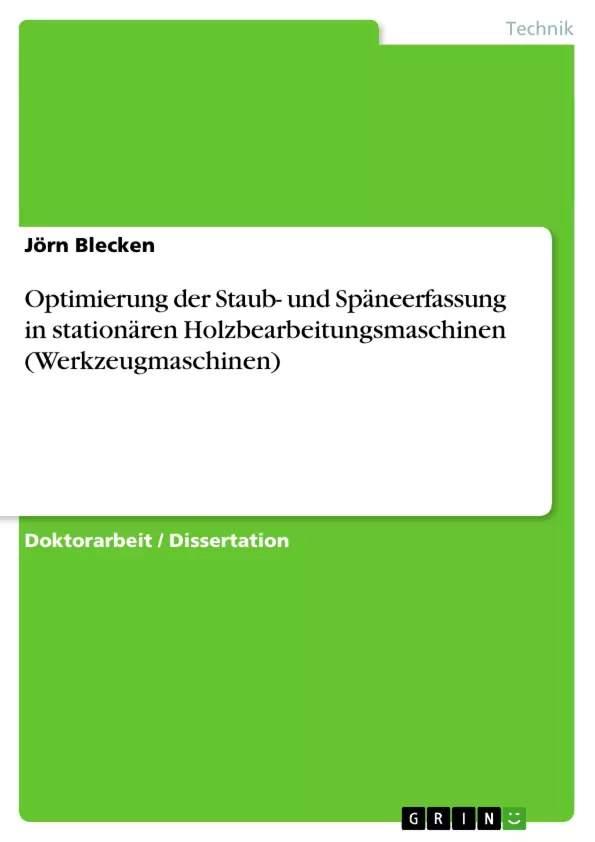Die Bearbeitung von Holz ist wie bei keinem zweiten Werkstoff mit dem Einsatz zerspanender Fertigungsverfahren verbunden. Angefangen von der Gewinnung der Rohholzsorten durch Schlagen oder Sägen über das Entasten und Zerlegen des Baumstammes in kommissionierbare Rohteile bis hin zur Endbearbeitung durch Fräsen oder Schleifen muss Holz spanabhebend verarbeitet werden.
Mit dem Holzzerspanungsprozess geht zwangsläufig die Erzeugung von Abfallprodukten in Form von Stäuben und Spänen einher, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes, der Brand- und Explosionsgefahr, des Maschinen- und Werkzeugverschleißes sowie der Werkstückqualität beseitigt werden müssen [WOL02, EIN02, SEE99, HOF01b]. Da Holz und Holzwerkstoffe aufgrund ihrer hydrophilen Werkstoffeigenschaft fast ausschließlich trocken bearbeitet werden müssen, können die entstehenden Staub- und Spänepartikel nicht, wie beispielsweise in der Metallzerspanung üblich, mit Hilfe flüssiger Kühlschmierstoffe gebunden und abtransportiert werden.
Als die vielseitigste und einfachste Möglichkeit zur Beseitigung von Holzstäuben- und -spänen aus dem Zerspanungsbereich der Maschinen hat sich letztlich die pneumatische Förderung durchgesetzt. Die Strömungsfördertechnik ermöglicht nicht nur eine berührungslose Erfassung der Partikel in einem kontinuierlichen Luftstrom, sondern auch den gezielten Transport des Fördergutes an entsprechende Filter- und Siloanlagen [BUH89, WEB74].
Während in den vergangenen Jahren die Absauganlagentechnik im Bereich der Ventilatoren und Steuerungen spürbare Fortschritte gemacht hat, änderte sich wenig an der Gestaltung der Staub- und Späneerfassungseinrichtungen insbesondere an stationären Holzbearbeitungsmaschinen. Die dort eingesetzten Absaughauben bestehen heute unverändert aus strömungsungünstigen, kastenförmigen Stahlblechkonstruktionen, die zum Werkstück nur unzureichend mit Bürsten- oder Elastomerlammellen abgedichtet werden. Die ineffiziente Auslegung von Erfassungseinrichtungen an den immer leistungsfähigeren Holzbearbeitungsmaschinen hat jedoch eine ganze Reihe technischer und wirtschaftlicher Probleme zur Folge.
Der in den letzten Jahren anhaltende Trend zu einer steigenden Kundenorientierung zwingt nach wie vor auch die Hersteller der Holz- und Möbelindustrie zur Flexibilisierung ihrer Prozesse. Bezogen auf die zerspanende Fertigung ergeben sich daraus kleine Losgrößen, hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten und eine große Vielfalt der zum Einsatz kommenden Werkzeuge.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Problemstellung
- Stand der Erkenntnisse
- Staub- und Späneemissionen in der Holzbranche
- Definition von Staub und Spänen
- Gesundheitsgefährdung durch Holzstaub
- Staubemissionen als Wirtschaftsfaktor
- Gesetzliche Vorschriften und Richtlinien
- Möglichkeiten zur Reduzierung der Holzstaubkonzentration
- Absaugeinrichtungen an stationären Holzbearbeitungsmaschinen
- Forschungsansätze
- Fazit zum Stand der Erkenntnisse
- Staub- und Späneemissionen in der Holzbranche
- Zielsetzung
- Grundlagen
- Kenngrößen zur Erfassung von Holzstäuben und -spänen
- Schwebegeschwindigkeit
- Arbeitsgeschwindigkeit
- Erfassungsgrad
- Kenngrößen zur Förderung von Holzstäuben und -spänen
- Kritische Fördergeschwindigkeit
- Numerische Optimierung von Absaugsystemen
- Kenngrößen zur Erfassung von Holzstäuben und -spänen
- Erfassungstechnische Untersuchungen zur Staub- und Späneerfassung
- Siebanalyse der entstehenden Staub- und Spänepartikel
- Untersuchung charakteristischer Kenngrößen im Strömungskanal
- Aufbau des Strömungskanals
- Partikelförderung in unbeeinflusster Strömung
- Aktive und passive Beeinflussung der Partikelförderung
- Einfluss der Zerspanung auf Staub- und Spänepartikel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation befasst sich mit der Optimierung der Staub- und Späneerfassung in stationären Holzbearbeitungsmaschinen. Das Hauptziel ist die Entwicklung von Maßnahmen, die die Entstehung und Verbreitung von Holzstaub in der Arbeitsumgebung reduzieren und damit die Gesundheit der Beschäftigten schützen. Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der Staub- und Späneerfassung, einschließlich der physikalischen Eigenschaften von Holzstaub, der Funktionsweise von Absaugsystemen und der Möglichkeiten zur Optimierung der Absaugtechnik.
- Physikalische Eigenschaften von Holzstaub
- Funktionsweise von Absaugsystemen
- Optimierung der Absaugtechnik
- Gesundheitsgefährdung durch Holzstaub
- Gesetzliche Vorschriften und Richtlinien für die Holzstaubbelastung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Dissertation vor und erläutert die Relevanz der Staub- und Späneerfassung in der Holzbearbeitung. Das zweite Kapitel analysiert den aktuellen Stand der Forschung und der Technik im Bereich der Staub- und Späneerfassung. Hier werden die verschiedenen Arten von Holzstaub, die Gesundheitsrisiken, die wirtschaftlichen Auswirkungen und die relevanten Vorschriften und Richtlinien beleuchtet. Außerdem werden verschiedene Absaugeinrichtungen und Forschungsansätze vorgestellt. Das dritte Kapitel beschreibt die Zielsetzung der Dissertation, die in der Optimierung der Staub- und Späneerfassung liegt. Das vierte Kapitel behandelt die Grundlagen der Staub- und Späneerfassung, einschließlich der relevanten Kenngrößen und der Funktionsweise von Absaugsystemen. Das fünfte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen zur Staub- und Späneerfassung. Hier werden die Ergebnisse der Siebanalyse, der Strömungskanaluntersuchungen und der Untersuchung des Einflusses der Zerspanung auf die Staub- und Spänepartikel dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Dissertation behandelt die Themen Staub- und Späneerfassung, Holzbearbeitung, Holzstaub, Absaugtechnik, Gesundheitsgefährdung, Gesetzliche Vorschriften, Strömungskanaluntersuchungen, Siebanalyse, Zerspanung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Staub- und Späneerfassung bei Holz so wichtig?
Holzstaub stellt eine erhebliche Gesundheitsgefährdung dar und erhöht das Brand- und Explosionsrisiko in holzverarbeitenden Betrieben.
Wie funktioniert die pneumatische Förderung in Holzbearbeitungsmaschinen?
Partikel werden berührungslos durch einen kontinuierlichen Luftstrom erfasst und über Rohrleitungen zu Filter- oder Siloanlagen transportiert.
Was sind die Schwachstellen herkömmlicher Absaughauben?
Oft sind es strömungsungünstige, kastenförmige Konstruktionen, die unzureichend zum Werkstück abdichten und dadurch einen geringen Erfassungsgrad haben.
Was ist die kritische Fördergeschwindigkeit?
Das ist die Mindestluftgeschwindigkeit, die nötig ist, um Partikel im Luftstrom in der Schwebe zu halten und Ablagerungen in den Rohren zu vermeiden.
Welche Rolle spielt die Zerspanung für die Staubqualität?
Die Art des Werkzeugs und die Schnittgeschwindigkeit beeinflussen die Partikelgröße (Siebanalyse), was wiederum die Anforderungen an die Absaugung bestimmt.
- Quote paper
- Jörn Blecken (Author), 2004, Optimierung der Staub- und Späneerfassung in stationären Holzbearbeitungsmaschinen (Werkzeugmaschinen), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31961