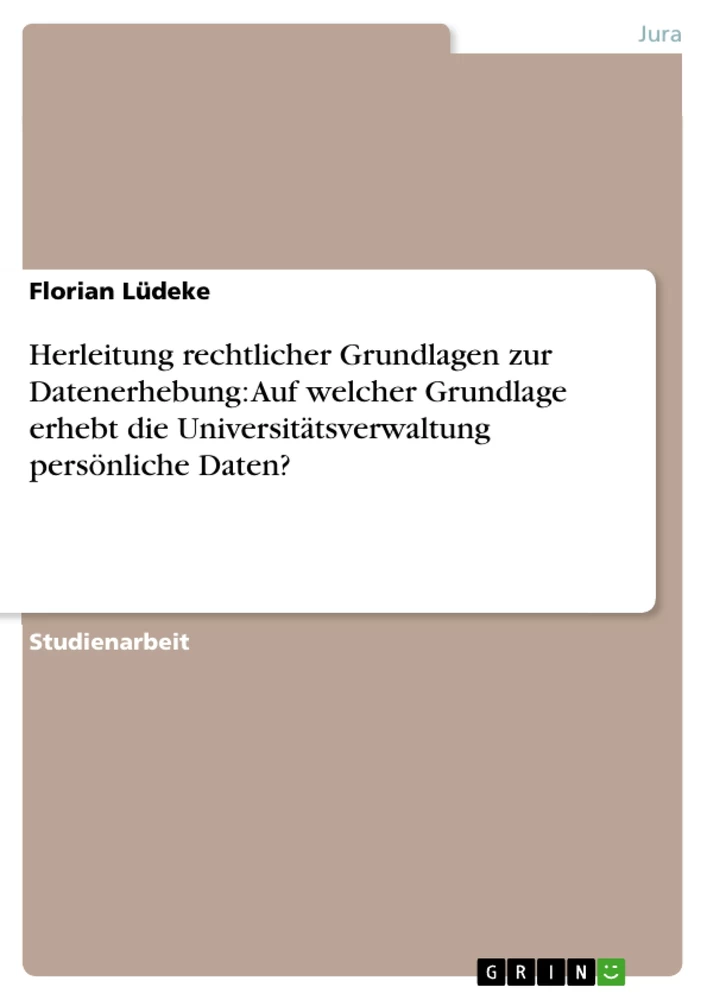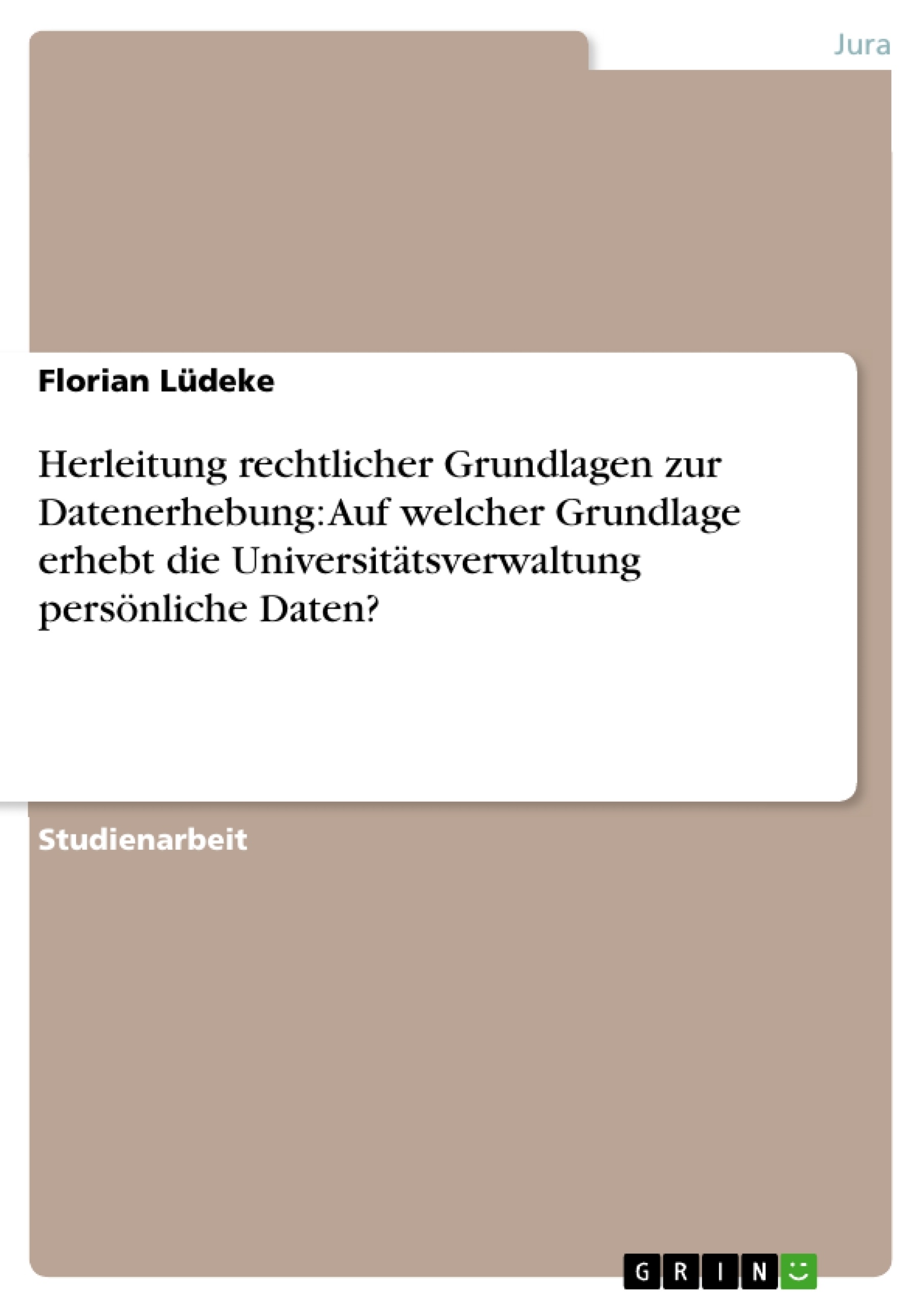Den gedanklichen roten Faden dieser Seminararbeit bildet folgende Ausgangsfrage: Auf welcher rechtlichen Grundlage werden von einer Einrichtung wie der Universitätsverwaltung persönliche (personenbezogene Daten) erhoben? Das als „Herleitung rechtlicher Grundlagen zur Datenerhebung“ betitelte Kapitel B kann im Kontext des Seminars „Rechtsinformatik I“ als Eröffnung des Themenkomplexes Daten, Datenschutz und -verarbeitung verstanden werden. Ausgangspunkt der Untersuchung ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches 1983 als Volkszählungsurteil bekannt wurde. Die Relevanz dieses Bundesverfassungsgerichtsentscheids 65,1 begründet sich durch die Entstehung eines „neuen Grundrechts“, welches unter dem Begriff der informationellen Selbstbestimmung wegweisend für den modernen Datenschutz wurde und als Garant der Sicherheit persönlicher Daten fungiert. Anders formuliert: Eine Legitimationshürde für jede datenerhebende und - verarbeitende Stelle. Die Darstellung der Anpassung der Datenerhebung an Universitäten (geregelt u.a. durch das Hochschulstatistikgesetz) dient hier als Exempel, anhand dessen versucht wird, die durchdringende Wirkung des Grundrechts der informationellen Selbstbestimmung aufzuzeigen und die Auswirkungen dieses Urteils zu charakterisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung (Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983)
- Das „neue Grundrecht”
- Kernsätze der Begründung zum Bundesverfassungsgerichtsentscheid
- Anforderungen an eine legitime Erhebung nichtanonymer Daten
- Auswirkungen des Volkszählungsurteils auf die Datenerfassung
- Differenzierung: Daten zu Verwaltungs- und Statistikzwecken
- Voraussetzungen für die Zulässigkeit der statistischen Datenerhebung
- Das Hochschulstatistikgesetz (HStatG)
- Datenerhebung im Zuge der Immatrikulation
- Universitäre Datenerhebung zu statistischen Zwecken
- § 2 (Frist und Form der Anträge) Immatrikulationsordnung der ULG (I)
- Interne Statistik; § 38 (Erhebung und Verwendung personenbezogener Informationen) NHG
- Übersicht
- Erhebung nichtanonymer studentischer Daten
- § 33 (Immatrikulation) NHG
- § 2 Immatrikulationsordnung der ULG (II)
- Übersicht
- Universitäre Datenerhebung unter den Kriterien des VZ-Urteils
- Universitäre Datenerhebung zu statistischen Zwecken
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die rechtlichen Grundlagen der Datenerhebung an Universitäten. Ausgehend vom Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1983, welches das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung etablierte, wird analysiert, wie dieses Grundrecht die universitäre Datenerhebung beeinflusst. Die Arbeit beleuchtet die Anwendung des Grundrechts im Kontext der Immatrikulation und der universitären Statistik.
- Das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung
- Auswirkungen des Volkszählungsurteils auf die Datenerhebung
- Rechtliche Grundlagen der universitären Datenerhebung
- Datenerhebung im Immatrikulationsprozess
- Anwendung des Hochschulstatistikgesetzes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Arbeit untersucht die rechtlichen Grundlagen der Datenerhebung durch die Universitätsverwaltung, ausgehend vom Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1983. Das Urteil etablierte das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung als zentrale Legitimationshürde für jede datenerhebende Stelle. Die Arbeit analysiert, wie dieses Grundrecht die Datenerhebung an Universitäten, insbesondere im Kontext des Hochschulstatistikgesetzes, beeinflusst.
Das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung (Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983): Dieses Kapitel beschreibt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Volkszählungsgesetz von 1983, welches das „neue Grundrecht“ der informationellen Selbstbestimmung etablierte. Das Urteil erklärte bestimmte Übermittlungsregelungen des Gesetzes für nichtig, da sie die informationelle Selbstbestimmung verletzten, indem sie die Weitergabe nicht-anonymer Daten ohne ausreichenden Schutz der Privatsphäre ermöglichten. Es wird detailliert auf die Kernsätze der Begründung eingegangen und die Bedeutung des Schutzes vor der unbegrenzten Speicherung, Vervielfältigung und Weitergabe personenbezogener Daten erläutert. Die Gefahr der Erstellung eines umfassenden Persönlichkeitsbildes durch Datenzusammenführung und der damit verbundene Kontrollverlust über die eigenen Daten werden als zentrale Aspekte hervorgehoben.
Auswirkungen des Volkszählungsurteils auf die Datenerfassung: Das Kapitel analysiert die Auswirkungen des Volkszählungsurteils auf die Datenerhebung, insbesondere die Differenzierung zwischen Daten für Verwaltungs- und Statistikzwecke. Es werden die Voraussetzungen für die Zulässigkeit statistischer Datenerhebung im Kontext des Grundrechts der informationellen Selbstbestimmung untersucht und die Rolle des Hochschulstatistikgesetzes (HStatG) erläutert. Die Anpassung der universitären Datenerhebung an die Vorgaben des Urteils wird detailliert beschrieben, wobei die Bedeutung des Schutzes der persönlichen Daten und der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Vordergrund stehen.
Datenerhebung im Zuge der Immatrikulation: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Datenerhebung an Universitäten im Zusammenhang mit der Immatrikulation. Es werden die verschiedenen Aspekte der universitären Datenerhebung zu statistischen Zwecken und die Erhebung nicht-anonymer studentischer Daten im Lichte des Volkszählungsurteils und des Hochschulstatistikgesetzes analysiert. Die relevanten Paragraphen der Immatrikulationsordnung und des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) werden erläutert und ihre Bedeutung für den Datenschutz im Kontext der Immatrikulation aufgezeigt. Die Kapitel zeigen den Spagat zwischen der Notwendigkeit statistischer Daten und dem Schutz der studentischen Privatsphäre auf.
Schlüsselwörter
Informationelle Selbstbestimmung, Volkszählungsurteil, Datenschutz, Datenerhebung, Hochschulstatistikgesetz, Immatrikulation, personenbezogene Daten, Bundesdatenschutzgesetz, Universitätsverwaltung, Rechtliche Grundlagen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Rechtliche Grundlagen der Datenerhebung an Universitäten
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die rechtlichen Grundlagen der Datenerhebung an Hochschulen, insbesondere im Kontext des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung und des Hochschulstatistikgesetzes (HStatG). Sie analysiert die Auswirkungen des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts von 1983 auf die universitäre Datenerhebung, speziell im Immatrikulationsprozess.
Welches Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Das zentrale Urteil ist das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983. Dieses Urteil etablierte das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung und legte die Kriterien für eine rechtmäßige Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten fest. Die Arbeit analysiert, wie dieses Urteil die universitäre Praxis der Datenerhebung beeinflusst.
Was ist das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung?
Das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung, welches durch das Volkszählungsurteil verankert wurde, schützt die Privatsphäre des Einzelnen vor unbefugter Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe seiner Daten. Es garantiert die Kontrolle über die eigenen Daten und schränkt die Möglichkeiten der Datenerhebung und -verarbeitung deutlich ein.
Wie beeinflusst das Volkszählungsurteil die Datenerhebung an Universitäten?
Das Volkszählungsurteil wirkt sich erheblich auf die universitäre Datenerhebung aus. Es erfordert, dass jede Datenerhebung gesetzlich legitimiert und die informationelle Selbstbestimmung der Studierenden gewahrt wird. Die Arbeit analysiert, wie die Universitäten die Vorgaben des Urteils umsetzen, insbesondere im Umgang mit anonymisierten und nicht-anonymisierten Daten.
Welche Rolle spielt das Hochschulstatistikgesetz (HStatG)?
Das HStatG regelt die Erhebung und Verwendung von Daten in Hochschulen zu statistischen Zwecken. Die Seminararbeit untersucht, wie das HStatG mit dem Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung in Einklang gebracht werden kann und welche Voraussetzungen für eine rechtmäßige Datenerhebung im Rahmen des Gesetzes erfüllt sein müssen.
Wie wird die Datenerhebung im Immatrikulationsprozess betrachtet?
Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Analyse der Datenerhebung im Zusammenhang mit der Immatrikulation. Es werden die relevanten Paragraphen der Immatrikulationsordnung und des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) untersucht und deren Bedeutung für den Datenschutz im Kontext der Immatrikulation erläutert. Der Spagat zwischen dem Bedarf an statistischen Daten und dem Schutz der Privatsphäre der Studierenden wird hier besonders deutlich.
Welche konkreten Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Einleitung, Das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung (Volkszählungsurteil), Auswirkungen des Volkszählungsurteils auf die Datenerhebung, Datenerhebung im Zuge der Immatrikulation und Fazit. Jedes Kapitel beleuchtet spezifische Aspekte der rechtlichen Grundlagen der universitären Datenerhebung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Informationelle Selbstbestimmung, Volkszählungsurteil, Datenschutz, Datenerhebung, Hochschulstatistikgesetz, Immatrikulation, personenbezogene Daten, Bundesdatenschutzgesetz, Universitätsverwaltung, Rechtliche Grundlagen.
- Quote paper
- Florian Lüdeke (Author), 2003, Herleitung rechtlicher Grundlagen zur Datenerhebung: Auf welcher Grundlage erhebt die Universitätsverwaltung persönliche Daten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31963