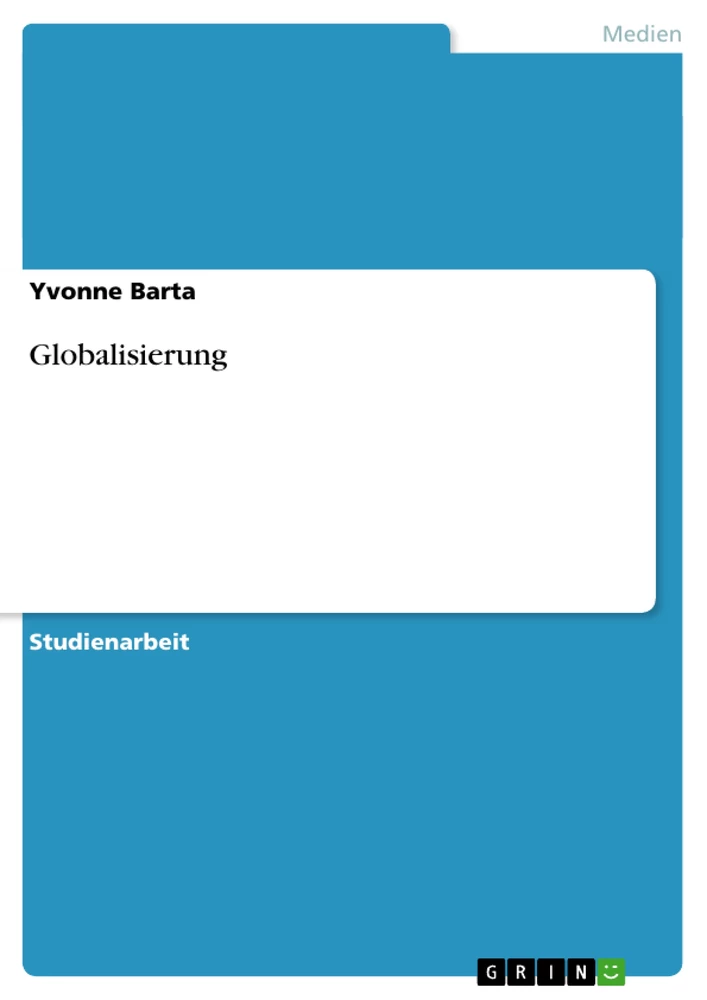"Die Globalisierung ist nicht als Naturgewalt über die Volkswirtschaften hereingebro-chen, sondern durch ein historisch gewachsenes Netz nationaler Gesetze, bilateraler Verträge und internationaler Regimes möglich geworden. Es gestattet die Bewegung von Gütern, Dienstleistungen, Kapital – und von Menschen, über Landesgrenzen hin-weg[...].“ beschreibt ein Zitat aus DER ZEIT.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1.Modelle des Außenhandels
1.1 Modell 1
1.2 Modell 2
1.3 Theorem der Spezialisierungsvorteile
1.4 Theorem der komparativen Kostenvorteile
2. Sieben ökologische Argumente für Freihandel und seine Widersprüche
2.1 Optimale Allokation der Ressourcen
2.2 Länder können ihren komparativen Vorteil ausnutzen und sich auf das Gut spezialisieren, in dessen Produktion sie einen komparativen Vorteil besitzen
2.3 Durch steigenden Wettbewerb im Inland werden Unternehmen gezwungen, effizienter und billiger zu produzieren
2.4 Durch internationale Spezialisierung können sogenannte Größenvorteile, "internal" und "external economies of scale" erreicht werden
2.5 Freier Handel ermöglicht einen Technologietransfer und fördert somit Innovation
2.6 Freier Handel öffnet neue Märkte und kann somit zu einem exportgeleiteten Wachstum führen
2.7 Durch Protektionismus werden Marktverzerrungen und Ineffizienzen gefördert
3. Forderungen der ATTAC - Erklärungen
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 : Einfaches Kreislaufschema einer offenen Volkswirtschaft [Quelle: Hübl (1984), S. 57.]
Abb. 2 : Kreislaufschema einer offenen Volkswirtschaft mit staatlicher ökonomischer Aktivität
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Modelle des Außenhandels
"Die Globalisierung ist nicht als Naturgewalt über die Volkswirtschaften hereingebrochen, sondern durch ein historisch gewachsenes Netz nationaler Gesetze, bilateraler Verträge und internationaler Regimes möglich geworden. Es gestattet die Bewegung von Gütern, Dienstleistungen, Kapital - und von Menschen, über Landesgrenzen hinweg[...].“ (1 ) beschreibt ein Zitat aus DER ZEIT.
Um etwas näher auf die Bewegung von Gütern, Dienstleistungen und Kapital, einzugehen, ziehen wir zwei Modell zur Veranschaulichung heran:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. (1): (Modell1)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. (2): (Modell 2)
1.1 Modell 1
Hierbei wird zum besseren Verständnis unterstellt, dass nur Unternehmen Transaktio- nen über Landesgrenzen hinweg führen. Unser fiktiver Außenhandel entsteht aus Aus- gaben- und Einnahmeströmen, die durch Export (Ex) und Import (Im) von Gütern und Dienstleistungen veranlasst werden. Die Importe steuern einen Ausgabestrom von den Unternehmen an das Ausland und Exporte lösen einen entgegengesetzten Strom aus. Exportieren die Unternehmen mehr als sie importieren, so entsteht in Höhe des Saldos in der Gesamtwirtschaft ein Bündel Aktiva in Form von Forderungen an das Ausland (dargestellt durch den Pfeil vom Vermögensänderungskonto zum Ausland).
1.2 Modell 2
Die Betrachtung von Modell 2 orientiert sich an der Theorie des Internationalen Han- dels. Unter anderem trugen in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Einflussfakto- ren, wie z.B. Außenhandelsliberalisierung, Einkommenswachstum und technologische Entwicklungen im Transport und Kommunikationsbereich, zu einem kräftigen Wachs- tum des Welthandels bei. Diese Entwicklung war mit ausgeprägten Strukturwandlungen in den Handelsströmen verbunden. Um die Auswirkung der spezifischen Einflussfakto- ren auf den Handel zu analysieren, wurden verschiedene Erklärungsmodelle entwickelt, die jedoch lediglich einen Teilbereich des internationalen Handels erklären. Diese be- dürfen einer Unterscheidung zw. intersektoralem Außenhandel und intrasektoralem Au- ßenhandel und eine damit zusammenhängende Betrachtung von unterschiedlichen Gründen für den Außenhandel. Um mögliche Antworten empirisch überprüfbarer Hypothesen über die wesentlichen Ursachen arbeitsteiliger Strukturen der Weltwirt- schaft und ihrer Veränderungen zu entwickeln, müssten z.B. folgende Fragen analysiert werden:
- Warum werden bestimmte Güter international getauscht?
- Welche der international gehandelten Güter werden von welchem Land exportiert und importiert?
- Welche Preisrelationen bilden sich zwischen Exporten und Importen heraus?
- Wie sind die Rahmenbedingungen des internationalen Handels beschaffen?
- Überlassen die Staaten die Entwicklung der Außenhandelsbeziehungen dem Selbststeuerungssystem des Weltmarktes?
- oder greifen die Staaten ihrerseits steuernd in diese arbeitsteiligen Beziehungen ein?
1.3 Theorem der Spezialisierungsvorteile
Nach David Ricardo kommt es im Zuge des Außenhandels zu Spezialisierung und da- mit notwendigerweise zu Faktorwanderungen. Dieser Gedanke beruht letztendlich auf dem „Arbitrage - Phänomen“, welches die Realisierung von Profit - (Nutzen -) Diffe- rentialen bei gegebenen Alternativen repräsentiert: In dem folgenden Beispiel prüfen wir, wie sich der Handel zwischen zwei Ländern (Portugal und England) bei zwei Gü- tern (Tuch und Wein) entwickelt: Hierbei - gemessen in Arbeitsstunden - ist Portugal sowohl in der Tuch- als auch in der Weinproduktion überlegen (in Portugal erfordert die Produktion einer Einheit Wein (EW) 70 Arbeitsstunden, die Produktion einer Ein- heit Tuch (ET) 80 Arbeitsstunden, in England erfordert eine Einheit Wein (EW) 120 Arbeitsstunden, eine Einheit Tuch (ET) 100 Arbeitsstunden). Damit ist der Kostenvor- sprung für Portugal in der Weinproduktion größer. Wir unterstellen, dass die Profitra- ten in beiden Produktionen ausgeglichen sind, insofern entscheidet der jeweilige Kos- tenaufwand über den relativen Preis der Güter. Also kostet in Portugal 1 EW 0,875 ET und 1 ET 1,14 EW, in England kostet 1 EW 1,2 ET und 1 ET 0,83 EW. Gemessen in Tuch ist Wein in Portugal im komparativen Vergleich zu England relativ billig, wäh- rend Wein in England relativ teuer ist. Gemessen in Wein ist Tuch in Portugal im Ver- bindung zu England relativ teuer, während es in England relativ billig ist. Daher finden zwischen Portugal und England Arbitragebewegungen statt. Daraus folgt, dass Tuch- produzenten nach Portugal exportieren und von dort Wein importieren, während portu- giesische Weinproduzenten nach England gegen Tuch exportieren. Damit spezialisiert sich England auf die Tuch- und Portugal auf die Weinproduktion. Die Produzenten realisieren so höhere Profitdifferentiale und wegen der Spezialisierung erhöht sich das Weltsozialprodukt, wovon beide Länder profitieren. Die Verlierer sind dabei die Wein- produzenten in England und die dort beschäftigten Arbeitskräfte, während in Portugal die Tuchproduktion unter Anpassungsdruck gerät. Wahrscheinlich kommt es im Zuge der Strukturanpassung zu Wanderungsbewegungen zwischen den Regionen und es wird über dem Markt zu Ausgleichbewegungen kommen (Förderung von Flexibilität und Mobilität), während aus wohlfahrtstaatlicher Perspektive staatliche Aktivität zur Angleichung der Lebensverhältnisse unumgänglich ist.
Fazit: Aufgrund von regionalen oder sektoralen Verlierern im Zuge einer zusammen- wachsenden Welt (Globalisierung), muß immer mit (lobbyistischem) Druck derjenigen gerechnet werden, die sich zu den Verlierern zählen. Ricardos Handelstheorie beruht im Gegensatz zur klassischen Handelstheorie nicht auf vollkommener Konkurrenz sondern auf unvollständiger Konkurrenz: Anstatt bei der Güterproduktion ähnliche Güter herzustellen, spezialisieren sich Produzenten auf die Produktion eines bestimm- ten Gutes, denn dadurch werden in einem großen Unternehmen die Durchschnittskos- ten gesenkt. Der Handel kann nun stattfinden, da die zusätzliche Bedienung ausländi- scher Märkte eine Vergrößerung der Produktionskapazitäten ermöglicht, die wiederum zu einer kostengünstigeren Herstellung der Güter und folglich zu steigenden Gewinnen führt. Daher sind die Unternehmen bestrebt, ihr Produktions- und Absatzvolumen durch die Erschließung von Auslandsmärkten zu erhöhen. Dieser Theorie zufolge las- sen sich die Außenhandelsspezialisierungen von Ländern durch Größenvorteile erklä- ren. Unterschiedlichen Faktorausstattungen ermöglichen mit ihren Wirkungen auf die relativen Faktorpreise z.B. eine zukünftige Spezialisierung Mittelosteuropas auf die Produktion arbeitsintensiver Erzeugnisse. Dies kann zwar Wachstumsimpulse liefern, sie birgt jedoch auch Risiken:
- Arbeitsintensiv gefertigte Produkte sind in der Mehrzahl standardisierte Erzeugnisse auf weitgehend gesättigten Märkten, auf denen Preiswettbewerb vorherrscht.
- Die Nachfrage ist durch eine relativ niedrige Einkommens- und eine hohe Preiselas- tizität charakterisiert.
- Eine Spezialisierung auf arbeitsintensive Ausfuhren bedeutet, dass Mittelosteuropa mit vielen Entwicklungsländern in einen Lohnkostenwettbewerb tritt.
- Durch Skalenerträge und technologische Erneuerungen wird zunehmend die Kom- pensation von Lohnkostenvorteilen durch die Industrieländer ermöglicht.
- Freie Exportwahl der Arbeitsplätze (können dahin exportieren, wo die Kosten und Auflagen für den Einsatz der Arbeitskräfte möglichst niedrig sind), dadurch sind Unternehmen in der Lage, Produkte und Dienstleistungen zu zerlegen und arbeitstei- lig an verschiedenen Orten der Welt zu erzeugen, denn
- Unternehmen befinden sich in einer Position, Nationalstaaten oder einzelne Produk- tionsorte gegeneinander auszuspielen und auf diese Weise »globalen Kuhhandel« um die billigsten Steuer- und günstigsten Infrastrukturleistungen betreiben zu kön- nen; ebenso können sie Nationalstaaten »bestrafen«, wenn sie als »teuer« oder »in- vestitionsfeindlich« gelten, sie können zwischen Investitionsort, Produktionsort, Steuerort und Wohnort selbsttätig unterscheiden.
1.4 Theorem der komparativen Kostenvorteile
Das zuvor genannte Beispiel von Ricardo bezog sich auf den Warenaustausch zwischen zwei Ländern, der sich für beide Länder selbst dann lohnt, wenn ein Land alle Güter günstiger herstellen kann als das andere. Wir gingen von der modellhaften Vorstellung aus, dass beide Länder sowohl Tuch als auch Wein herstellen könnten, dass jedoch je- des Land aufgrund komparativer Kostenvorteile jeweils nur ein Gut herstellt: Das in- dustrialisierte England bezieht Wein aus dem Agrarland Portugal und exportiert seine Stoffe dorthin. Der Handel ist - nach Ricardo - für beide Länder von Nutzen, obwohl Portugal beide Güter (in Arbeitszeit gemessen) zu niedrigeren Stückkosten herstellen könnte als England. Der komparative Kostenvorteil liegt jedoch bei Portugals Wein, da die Portugiesen im Vergleich zu den Engländern bei der Weinerzeugung noch deutlich produktiver sind als bei der Tuchherstellung. Deshalb profitiert das Land, indem es sich auf die Weinerzeugung konzentriert und ihm das Tuch nicht mehr selbst zu weben ob- liegt, denn es besteht die Möglichkeit, dies im Handel mit England gegen Wein einzu- tauschen, da die Portugiesen weniger Arbeit haben, die für den Export benötigte Menge Wein zu erzeugen, als sie einsetzen müssten, wenn sie das Tuch für den Eigenbedarf selbst fertigten. Spiegelbildlich haben die Engländer einen komparativen Kostenvorteil bei der Tuchproduktion, denn Ihr Arbeitseinsatz, um das für den Tausch benötigte Tuch herzustellen, ist geringer als beim Anbau eigenen Weins. Dadurch kann England die eingesparten Arbeitskräfte profitabler in andere Industriezweige einsetzen.
Fazit: Wenn sich jedes Land auf das Produkt konzentriert, das es (relativ gesehen) billi- ger produzieren kann, und die Wirtschaftseinheiten nicht so weit auseinanderliegen, so dass die Transportkosten die möglichen Vorteile aufzehren, wächst in beiden Ländern der Wohlstand.
Als Geschäftsmann war David Ricardo bewusst, dass sich Kaufleute nicht um abstrakte Erklärungen über komparative Kostenvorteile kümmern. Für sie - so Ricardo - zählen allein die Preise:
Die Englischen Kaufleute werden höchst wahrscheinlicht dazu neigen, auch Tücher aus Portugal zu importieren, wenn sie dort preiswerter sind als in England. Damit wird je- doch gleichzeitig mehr Geld nach Portugal gebracht und dies führt wiederum zu höhe- ren Preisen in Portugal, während die englischen Preise wegen der abnehmenden Geld- menge fallen. Die Geldströme dauern wahrscheinlich so lange an, bis es wieder vorteil- haft ist, Stoffe von England nach Portugal zu exportieren, d.h. mit einiger Verzögerung bestimmen also auch (in unserem Bsp.) die komparativen Kostenvorteile den Warenaus- tausch.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Theorem der komparativen Kostenvorteile?
Nach David Ricardo lohnt sich Handel zwischen zwei Ländern selbst dann, wenn ein Land alle Güter günstiger produzieren kann, sofern es sich auf seine relativ effizientesten Produkte spezialisiert.
Welche ökologischen Argumente gibt es für den Freihandel?
Dazu gehören die optimale Allokation von Ressourcen, Technologietransfer für Innovationen und die Vermeidung von Ineffizienzen durch Protektionismus.
Was sind die Risiken einer Spezialisierung auf arbeitsintensive Produkte?
Länder treten in einen harten Lohnkostenwettbewerb, sind anfällig für Preiswettbewerb auf gesättigten Märkten und Unternehmen können Standorte gegeneinander ausspielen.
Was fordert die Organisation ATTAC im Kontext der Globalisierung?
Die Arbeit geht auf die Forderungen von ATTAC ein, die sich kritisch mit den Auswirkungen der uneingeschränkten Globalisierung und des Kapitalverkehrs auseinandersetzen.
Wie beeinflusst die Globalisierung die Macht von Nationalstaaten?
Unternehmen können Staaten „bestrafen“ oder gegeneinander ausspielen, indem sie zwischen Investitions-, Produktions- und Steuerorten frei wählen.
- Arbeit zitieren
- Yvonne Barta (Autor:in), 2001, Globalisierung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31971