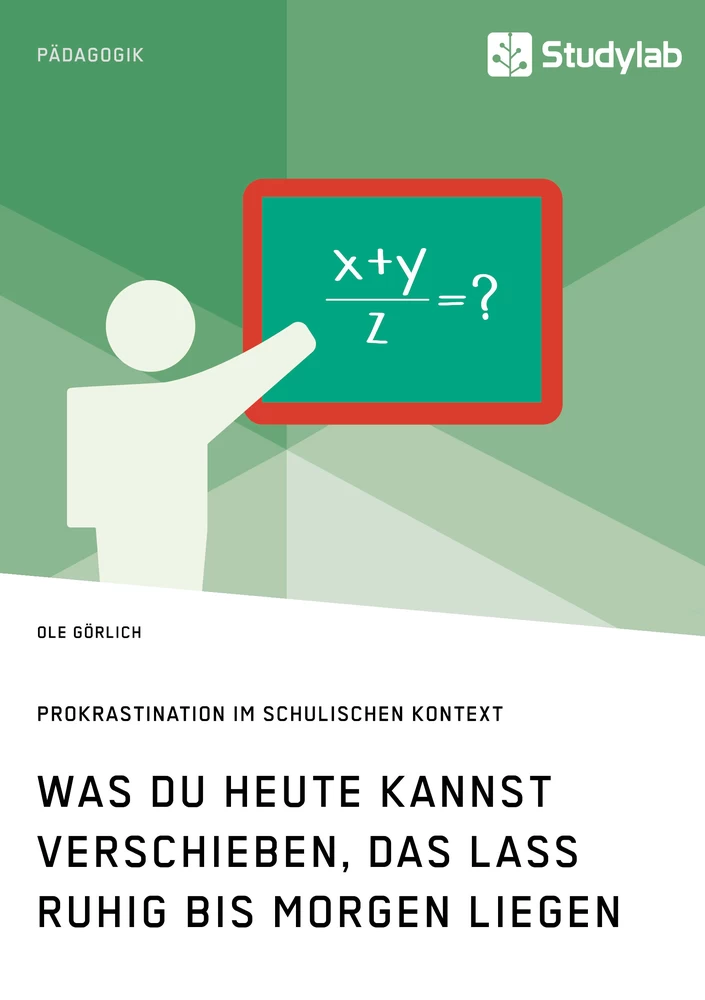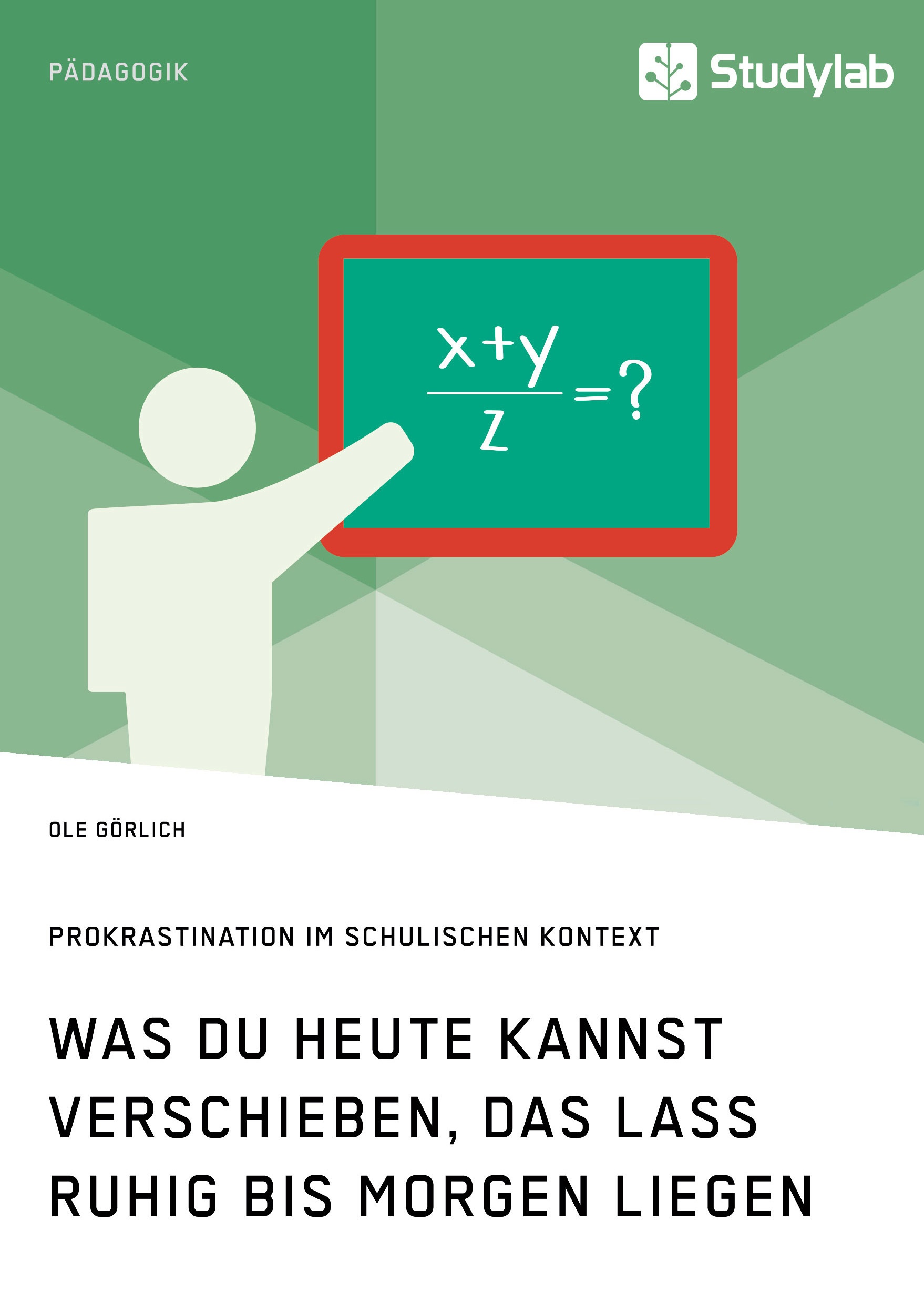Das Hinauszögern einer Hausarbeit, einer wichtigen Prüfung oder gar das Aufschieben einer bedeutsamen Lebensentscheidung sind weit verbreitete Verhaltensmuster. Häufig haben sie für den Einzelnen negative Konsequenzen. Diese Beispiele illustrieren ein alltägliches Phänomen, dass als Prokrastination (umgangssprachlich Aufschieberitis) bezeichnet werden kann. Immer wieder finden sogenannte Aufschieber Gründe, warum eine bestimmte Handlung nicht ausgeführt werden sollte. Dieses Verhaltensmuster kann nicht allein als schlechte Angewohnheit charakterisiert oder mit unzureichendem Zeitmanagement erklärt werden, sondern ist vielmehr als eine Arbeitsstörung einzuordnen.
Im Rahmen dieser Arbeit soll das Phänomen der Prokrastination im schulischen Kontext analysiert und evaluiert werden. Im Fokus steht die Frage, inwieweit dysfunktionales Aufschiebe- und Vermeidungsverhalten innerhalb der untersuchten Gruppe von Schülern und Schülerinnen im Alter von 13 bis 16 Jahren existiert. Außerdem wird untersucht, welcher Zusammenhang zwischen Prokrastination und Angst besteht und inwieweit speziell manifeste Angst und Prüfungsangst eine Rolle für ein Aufschiebeverhalten spielen. Des Weiteren soll der Zusammenhang von Prokrastination zu Depressivität einbezogen werden, da innerhalb der relevanten Fachliteratur mögliche Relationen konstituiert werden.
Aus dem Inhalt:
- Akademische Prokrastination;
- State- und Trait-Prokratination;
- Kognitive, affektive und behaviorale Merkmale von Prokrastination;
- Depressivität, Angst und Schulunlust;
- Geschlechts- und altersspezifische Unterschiede
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Abgrenzung Prokrastination
- 2.1.1 Akademische Prokrastination
- 2.1.2 State- und Trait-Prokrastination
- 2.2 Prävalenz
- 2.3 Korrelierende Personenmerkmale
- 2.4 Kognitive, affektive und behaviorale Merkmale von Prokrastination
- 2.4.1 Handlungsvorbereitung und Handlungsplanung
- 2.4.2 Selbstwirksamkeitdefizite und Attributionsstile
- 2.4.3 Konkurrierende Aktivitäten und Konditionierung
- 2.5 Depressivität
- 2.5.1 Abgrenzug Depressivität
- 2.5.2 Rumination
- 2.5.3 Zusammenhang zwischen Prokrastination und Depressivität
- 2.6 Angst
- 2.6.1 Abgrenzung Angst
- 2.6.2 Leistungs- und Prüfungsgsangst
- 2.6.3 Zusammenhang zwischen Angst und Prokrastination
- 2.7 Schulunlust
- 2.8 Forschungsfragen und Hypothesen
- 3 Methoden
- 3.1 Vorbereitung und Durchführung der Untersuchung
- 3.2 Untersuchungsstichprobe
- 3.3 Instrumente
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Reliabilität
- 4.2 Verteilung der Konstrukte
- 4.3 Geschlechtsspezifische und alterspezifische Unterschiede in Bezug auf Prokrastination
- 4.4 Korrelationen der Konstrukte
- 5. Diskussion und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Prokrastination im schulischen Kontext. Ziel ist es, die Ursachen und Folgen von Prokrastination bei Schülern zu untersuchen und die Zusammenhänge mit anderen Merkmalen wie Depressivität, Angst und Schulunlust zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung von Prokrastination
- Prävalenz und Korrelierende Personenmerkmale
- Kognitive, affektive und behaviorale Merkmale von Prokrastination
- Zusammenhänge zwischen Prokrastination und anderen Merkmalen wie Depressivität, Angst und Schulunlust
- Empirische Untersuchung von Prokrastination bei Schülern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Prokrastination im schulischen Kontext vor und erläutert die Relevanz des Themas. Das zweite Kapitel beleuchtet den theoretischen Hintergrund von Prokrastination. Es werden verschiedene Definitionen und Abgrenzungen von Prokrastination diskutiert, sowie die Prävalenz und Korrelierende Personenmerkmale betrachtet. Die kognitiven, affektiven und behavioralen Merkmale von Prokrastination werden ebenfalls erläutert. Der Zusammenhang zwischen Prokrastination und anderen Merkmalen wie Depressivität, Angst und Schulunlust wird in diesem Kapitel ausführlich behandelt. Das dritte Kapitel beschreibt die Methoden der empirischen Untersuchung, welche zur Untersuchung von Prokrastination bei Schülern durchgeführt wurde. Das vierte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Es werden die Reliabilität der eingesetzten Instrumente, die Verteilung der Konstrukte, sowie geschlechtsspezifische und alterspezifische Unterschiede in Bezug auf Prokrastination beleuchtet. Die Korrelationen der Konstrukte werden ebenfalls analysiert. Das fünfte Kapitel diskutiert die Ergebnisse und fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Untersuchung zusammen.
Schlüsselwörter
Prokrastination, Akademische Prokrastination, State- und Trait-Prokrastination, Depressivität, Angst, Schulunlust, Selbstwirksamkeit, Attributionsstile, Handlungsvorbereitung, Handlungsplanung, Empirische Untersuchung, Schüler.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Prokrastination im schulischen Kontext?
Prokrastination, oft als "Aufschieberitis" bezeichnet, ist das dysfunktionale Hinauszögern von schulischen Aufgaben wie Hausarbeiten oder Prüfungsvorbereitungen trotz negativer Konsequenzen.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Angst und Aufschieben?
Ja, die Arbeit untersucht, inwieweit manifeste Angst und insbesondere Prüfungsangst als Treiber für Vermeidungsverhalten und Prokrastination fungieren.
Wie hängt Prokrastination mit Depression zusammen?
Fachliteratur weist auf Korrelationen zwischen chronischem Aufschieben und Depressivität hin, wobei Rumination (Grübeln) eine verbindende Rolle spielen kann.
Welche Altersgruppe wurde in der Studie untersucht?
Die Untersuchung konzentriert sich auf Schüler und Schülerinnen im Alter von 13 bis 16 Jahren.
Ist Prokrastination nur ein schlechtes Zeitmanagement?
Nein, die Arbeit ordnet Prokrastination eher als eine Arbeitsstörung mit kognitiven, affektiven und behavioralen Merkmalen ein, die über mangelnde Planung hinausgeht.
- Quote paper
- Ole Görlich (Author), 2012, Was du heute kannst verschieben, das lass ruhig bis morgen liegen. Prokrastination im schulischen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319726