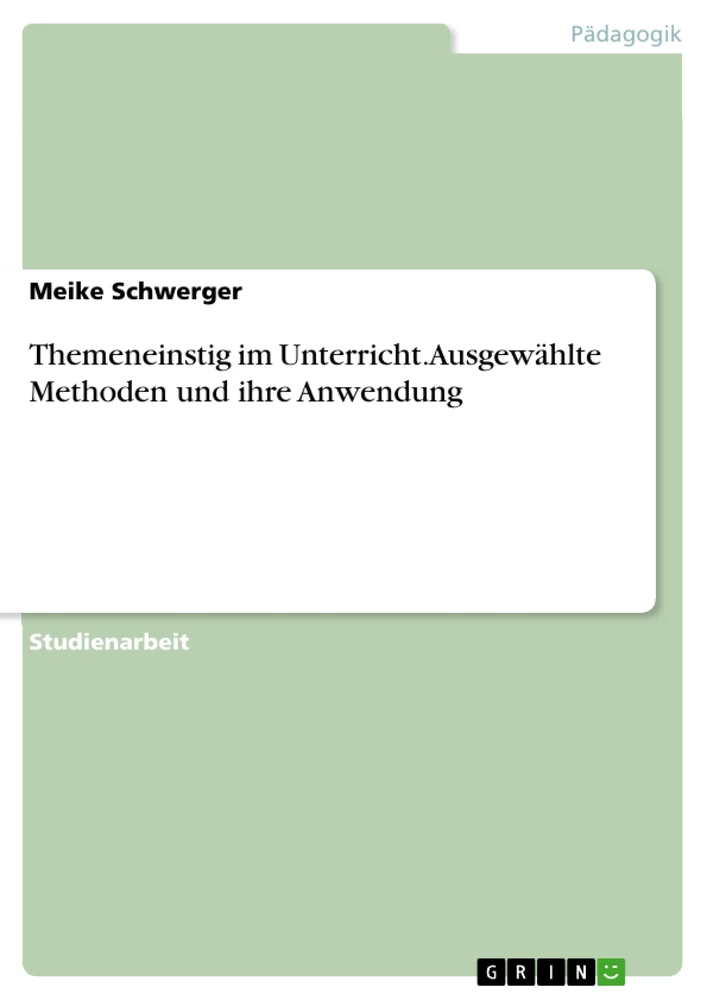„Ziel von Unterricht ist es Lernen durch Lehren anzuregen und zu unterstützen.“ Dabei spielt der Beginn der Unterrichtseinheit eine wichtige Rolle, denn mit einem gelungenen Unterrichtseinstieg kann Motivation gefördert und neugierig gemacht werden auf das was kommt. Das Lernen kann den Schülern also schmackhaft gemacht werden. Es gibt vielfältige Möglichkeiten in den Unterricht einzusteigen. Doch was ist der „gelungene Unterrichtseinstieg“? Gibt es den einen, den richtigen Unterrichtseinstieg? Woran erkenne ich ob eine bestimmte Form des Einstiegs sinnvoll ist oder nicht? Unterrichtseinstiege sind planbar aber ob und inwieweit sie durchführbar sind hängt von vielen Faktoren ab.
Leider ist in der Literatur speziell zu dem Thema des Unterrichtseinstieges nicht besonders viel zu finden. Ich werde mich im Folgenden daher größtenteils an Meyer Hilbert, Johannes Greving und Liane Paradies orientieren und versuchen den Begriff des Unterrichtseinstieges sowie seine didaktischen Funktionen zu definieren. In erster Linie beschäftige ich mich in dieser Arbeit nicht mit Stunde-neröffnungen, sondern mit dem Einstieg in ein neues Thema. Der thematische Unterrichtseinstieg ist jedoch verbunden mit einem Stundenbeginn; ist von ihm kaum trennbar. Deshalb werde ich im ersten Teil der Arbeit Stundeneröffnungsri-tuale und Übungen zum stofflichen Aufwärmen kurz skizzieren und dann ausführ-licher auf den thematischen Einstieg eingehen. Im zweiten Teil stelle ich ausge-wählte Methoden als Möglichkeit des Themeneinstiegs vor und prüfe einige von ihnen abschließend auf ihre Brauchbarkeit in Bezug auf das Thema „Fußball WM 2010 in Südafrika“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung Unterrichtseinstieg:
- Unterrichtseinstiege und ihre didaktischen Funktionen ...
- Stundeneröffnungsrituale
- Übungen zum stofflichen Aufwärmen
- Thematischer Unterrichtseinstieg..
- Ausgewählte Formen des Themeneinstiegs.
- Lehrervortrag.
- Die Methode der Gruppenarbeit....
- Brainstorming……….....
- Rollenspiel.
- Fantasiereise..\li>
- Fußball WM 2010 in Südafrika: Welche Methode eignet sich am besten um in das
Thema einzusteigen?....
- Das Thema „Fußball WM 2010 in Südafrika“: Gruppenarbeit....
- Fazit....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung des Unterrichtseinstiegs für den erfolgreichen Verlauf von Unterrichtseinheiten. Sie untersucht verschiedene Formen des Themeneinstiegs und analysiert deren didaktische Funktionen.
- Die Definition des Begriffs "Unterrichtseinstieg" und die Unterscheidung zwischen Stundeneröffnungsritualen, Übungen zum stofflichen Aufwärmen und dem thematischen Unterrichtseinstieg.
- Die Analyse der didaktischen Funktionen von Unterrichtseinstiegen, insbesondere die Förderung von Motivation, Neugier und Lernbereitschaft.
- Die Vorstellung und Analyse ausgewählter Methoden des Themeneinstiegs, wie Lehrervortrag, Gruppenarbeit, Brainstorming, Rollenspiel und Fantasiereise.
- Die Anwendung der vorgestellten Methoden auf das Beispiel des Themas "Fußball WM 2010 in Südafrika".
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Unterrichtseinstiegs ein und erläutert die Bedeutung eines gelungenen Einstiegs für den Lernerfolg. Anschließend wird der Begriff des Unterrichtseinstiegs definiert und die verschiedenen Arten des Einstiegs, wie Stundeneröffnungsrituale, Übungen zum stofflichen Aufwärmen und der thematische Unterrichtseinstieg, vorgestellt.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den didaktischen Funktionen von Unterrichtseinstiegen. Es werden die Bedeutung von Stundeneröffnungsritualen für die Schaffung einer klaren Unterrichtsstruktur und die Motivation der Schüler sowie die Funktion von Übungen zum stofflichen Aufwärmen für die Wiederholung und Festigung des Lernstoffs erläutert.
Im vierten Kapitel werden verschiedene Methoden des Themeneinstiegs vorgestellt und analysiert. Dazu gehören Lehrervortrag, Gruppenarbeit, Brainstorming, Rollenspiel und Fantasiereise. Die jeweiligen Vor- und Nachteile der Methoden werden dargestellt und ihre Eignung für verschiedene Lernsituationen und Themenbereiche betrachtet.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Anwendung der vorgestellten Methoden auf das Thema "Fußball WM 2010 in Südafrika". Es wird untersucht, welche Methoden besonders geeignet sind, um die Schüler für das Thema zu begeistern und sie zum aktiven Lernen anzuregen.
Schlüsselwörter
Unterrichtseinstieg, didaktische Funktionen, Stundeneröffnungsrituale, Übungen zum stofflichen Aufwärmen, thematischer Unterrichtseinstieg, Methoden des Themeneinstiegs, Lehrervortrag, Gruppenarbeit, Brainstorming, Rollenspiel, Fantasiereise, Fußball WM 2010 in Südafrika.
- Quote paper
- Meike Schwerger (Author), 2010, Themeneinstig im Unterricht. Ausgewählte Methoden und ihre Anwendung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319824