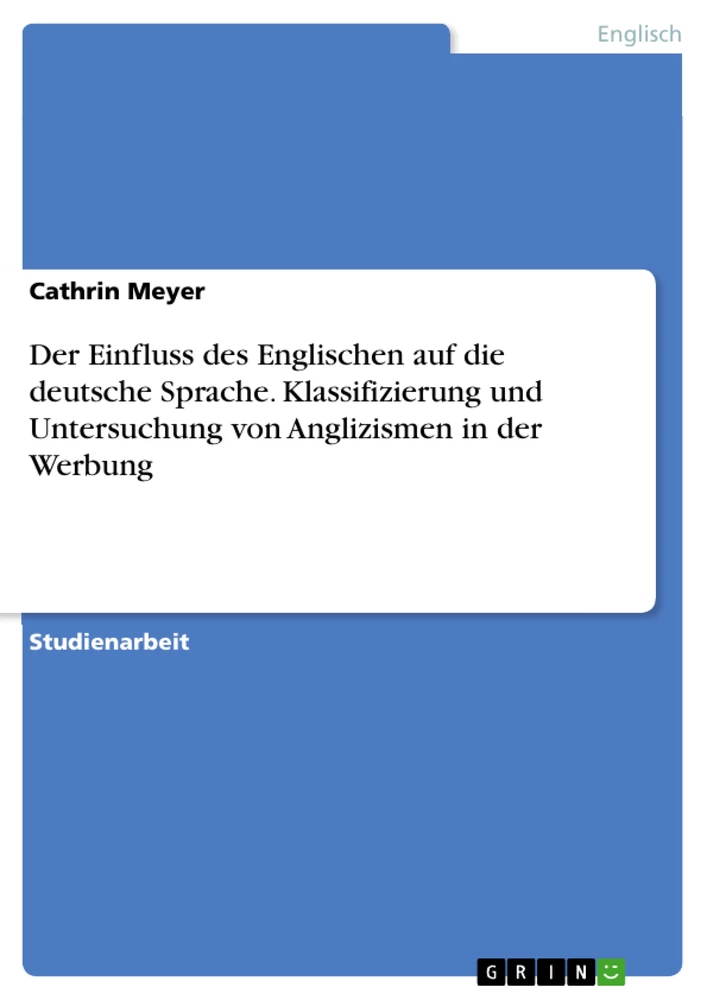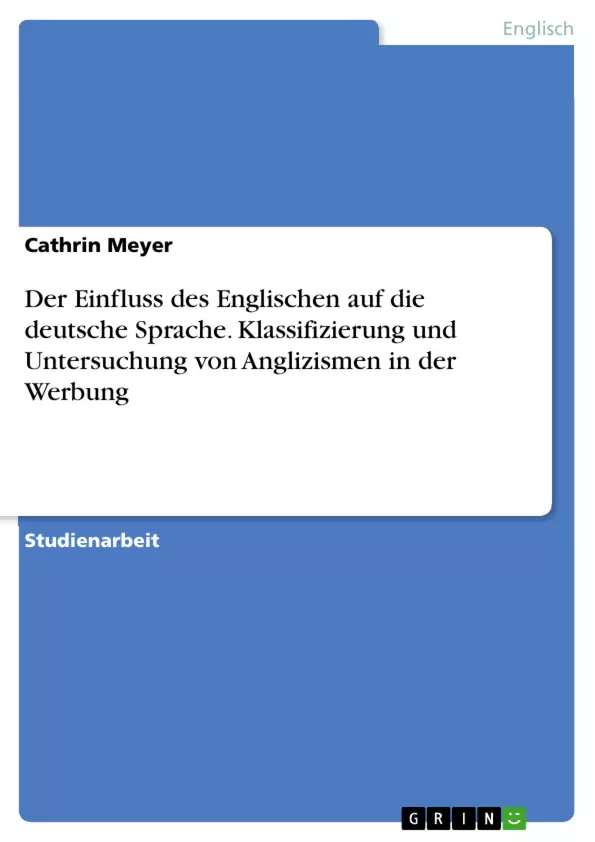Die folgende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss des Englischen auf die Deutsche Sprache, wobei ich als erstes den Begriff Anglizismus erklären werde, um dann im Folgenden die Klassifizierung von Anglizismen und die Lehnmotivation abzuhandeln. Dabei werde ich evidente und latente Spracheinflüsse sowie verschiedene Anglizismen-Klassen und Funktionen von Anglizismen in Augenschein nehmen.
Im nächsten Teil der Hausarbeit geht es um die Anglizismen in der Werbung und inwieweit die Werbung durch diese beeinflusst wird. Auch die Besonderheiten der Werbesprache werden thematisiert und auf die verschiedenen Elemente – Slogan, Fließtext, Schlagzeile – eingegangen. Ich werde also der Frage nachgehen, warum immer mehr Anglizismen im Deutschen und in der deutschen Werbung verwendet werden und inwieweit sich diese gliedern lassen.
Des Weiteren werden Gründe für Anglizismen in der Werbung angesprochen und Beispiele von Anglizismen in Werbeanzeigen analysiert sowie am Ende ein Fazit über das Gesagte abgeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff Anglizismus
- Klassifizierung von Anglizismen
- Lehnmotivation-Funktion von Anglizismen
- Besonderheiten der Werbesprache
- Der englische Einfluss auf die deutsche Werbesprache
- Gründe für Verwendung von Anglizismen in deutschen Werbeanzeigen
- Beispiele für Anglizismen in der Frauenzeitschrift ,,Brigitte"
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss der englischen Sprache auf das Deutsche, mit besonderem Fokus auf die Verwendung von Anglizismen in der Werbung. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Typen von Anglizismen, ihre Lehnmotivation und die Gründe für ihre zunehmende Präsenz in der deutschen Sprache, insbesondere in der Werbesprache.
- Definition und Klassifizierung von Anglizismen
- Lehnmotivation und Funktion von Anglizismen
- Der Einfluss von Anglizismen auf die deutsche Werbesprache
- Gründe für die Verwendung von Anglizismen in Werbeanzeigen
- Beispiele für Anglizismen in der Frauenzeitschrift ,,Brigitte"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Relevanz des englischen Einflusses auf die deutsche Sprache dar. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Begriff Anglizismus und seiner Definition. Es werden verschiedene Typen von Anglizismen klassifiziert und ihre Lehnmotivation erläutert. Das dritte Kapitel analysiert die Besonderheiten der Werbesprache und den Einfluss von Anglizismen auf diese. Es werden Gründe für die Verwendung von Anglizismen in Werbeanzeigen untersucht und Beispiele aus der Frauenzeitschrift ,,Brigitte" analysiert.
Schlüsselwörter
Anglizismen, deutsche Sprache, Werbesprache, Lehnmotivation, Sprachwandel, englischer Einfluss, ,,Brigitte", konventionalisierte Anglizismen, Anglizismen im Konventionalisierungsprozess, Zitatwörter, Eigennamen.
- Quote paper
- Cathrin Meyer (Author), 2012, Der Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache. Klassifizierung und Untersuchung von Anglizismen in der Werbung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319900