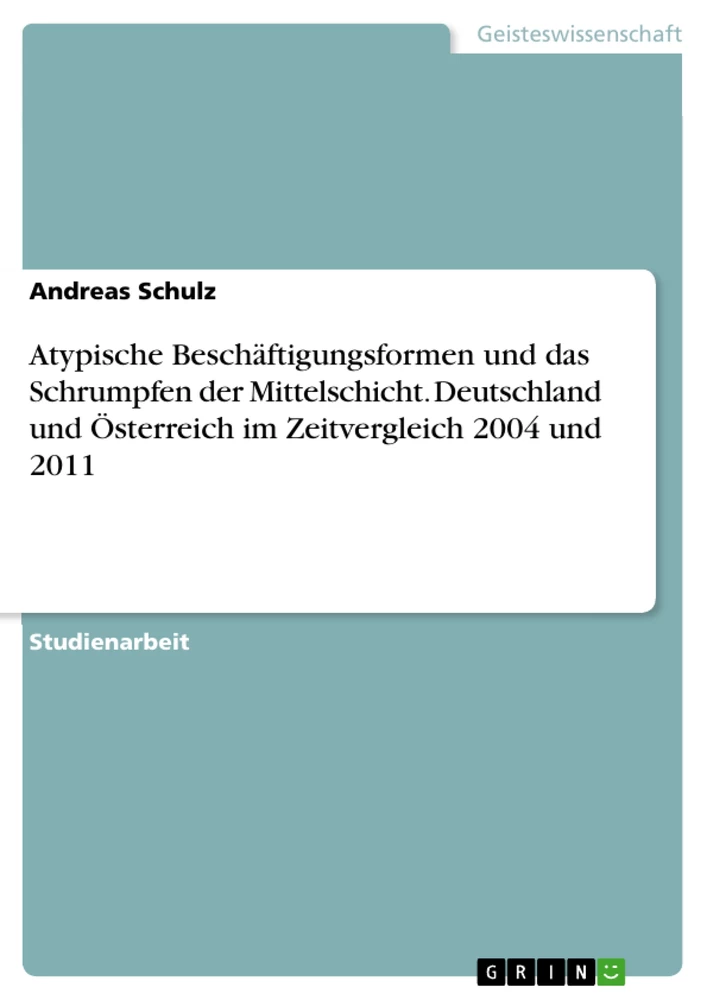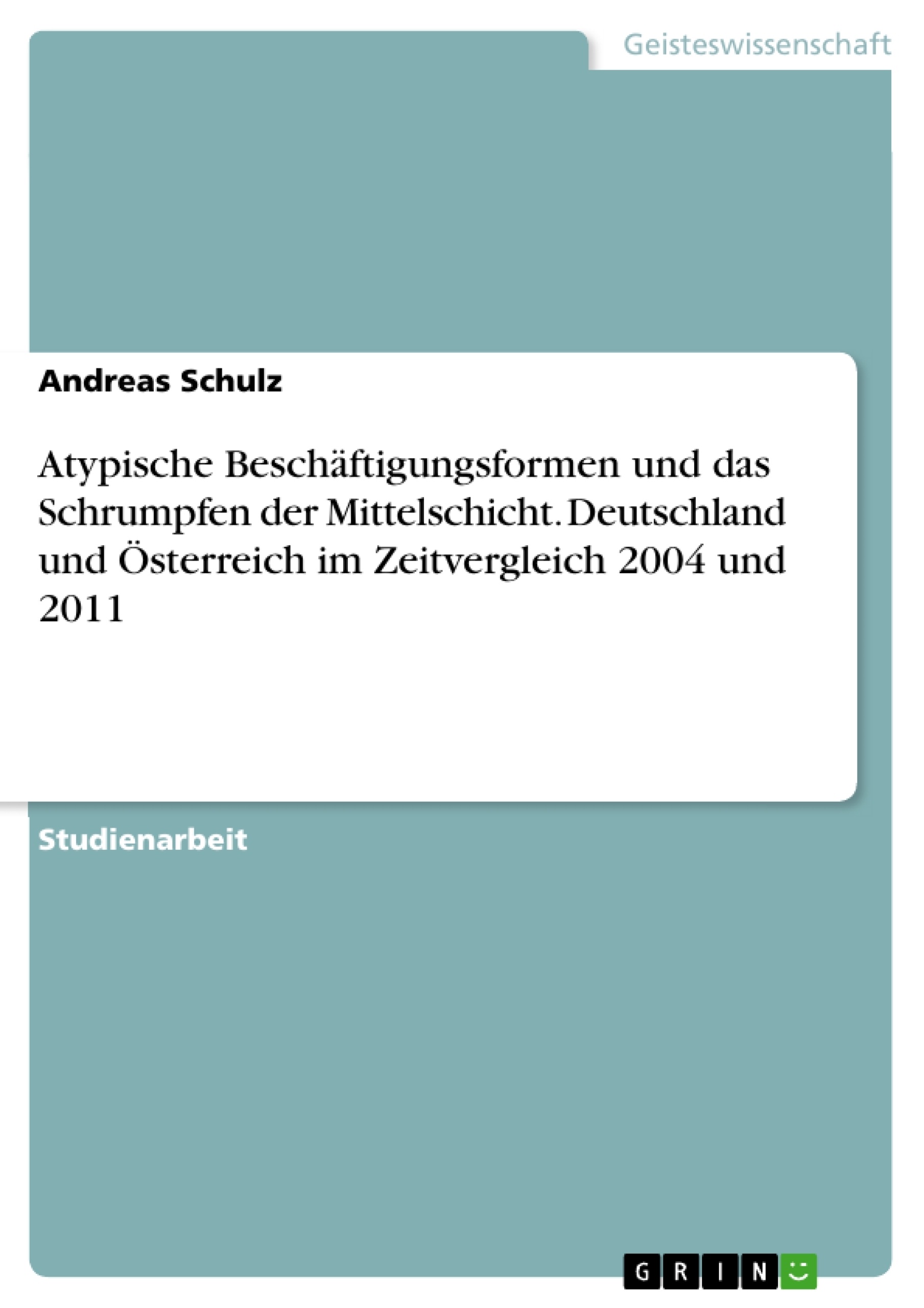Der Fokus der Arbeit soll auf den Anstieg der atypischen Beschäftigungen und die in den Medien vielmals propagierte Schrumpfung der Mitte gesetzt werden. Es wird ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Ansteigen der atypischen Beschäftigung sowie dem Schrumpfen der Mitte untersucht. Zudem sollen generelle Entwicklungen der Mitte aufgezeigt und analysiert werden und mögliche Entwicklungstrends für Österreich, auf Grundlage eines Vergleichs mit Deutschland, da dort vergleichsweise früh eine Arbeitsmarktliberalisierung einsetzte, zu prognostizieren und sich daher auch in Österreich abzeichnen könnten.
Die zentralen forschungsleitenden Fragen sind:
(i) Gibt es einen Zusammenhang zwischen atypischen Arbeitsverhältnissen und einer damit verbundenen sinkenden Wahrscheinlichkeit ein mittleres Einkommen zu erzielen?
(ii) Welche Merkmale erhöhen das Risiko für Personen sich nicht in der Mittelschicht zu verorten?
Im folgenden Kapitel sollen theoretische Überlegungen und Konzepte zur Mittelschicht und zur atypischen Beschäftigungen vorgestellt werden. Es sollen besonders für die Operationalisierung und der Analyse potentielle Risikogruppen heraus gearbeitet.
Obwohl das Mittelschichtsmodell über lange Zeit besonders durch die von ihr ausgehende sozioökonomische Sicherheit, gesellschaftliche Teilhabe und Aufstiegsmöglichkeiten, eine große „Strahlkraft“ besaß, zeigen empirische Untersuchungen, dass der Einkommensanteil der Mitte sich seit der Mitte der 1980er Jahre verringerte. Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage nach einer „Schrumpfenden Mitte“ und dem Zusammenhang des starken Ansteigens atypischer Beschäftigungsquoten in Deutschland und Österreich im Zeitvergleich. Mit dem Bedeutungszuwachs der atypischen Beschäftigungsverhältnissen wächst auch die soziale Ungleichheit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Konzeptualisierung
- Daten, Methoden, Variablen
- Methode
- Abhängige Variable
- Erklärende Variablen
- Trendergebnisse
- Strukturanalysen
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob ein Zusammenhang zwischen dem Anstieg atypischer Beschäftigungsformen und dem Schrumpfen der Mittelschicht in Deutschland und Österreich besteht. Der Fokus liegt auf dem Zeitvergleich der beiden Länder im Zeitraum von 2004 bis 2011. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Arbeitsmarktflexibilisierung auf die soziale Ungleichheit und die Entwicklung der Mittelschicht in beiden Ländern.
- Analyse der Entwicklung atypischer Beschäftigungsformen in Deutschland und Österreich
- Untersuchung des Einflusses atypischer Beschäftigungsformen auf die Einkommensentwicklung der Mittelschicht
- Bewertung der Auswirkungen der Arbeitsmarktflexibilisierung auf die soziale Ungleichheit
- Vergleich der Entwicklungen in Deutschland und Österreich im Kontext der unterschiedlichen Arbeitsmarktstrukturen
- Prognose möglicher Entwicklungstrends für Österreich auf Basis des deutschen Beispiels
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der schrumpfenden Mittelschicht und der wachsenden Bedeutung atypischer Beschäftigungsformen ein. Es werden die relevanten Forschungsfragen definiert und der theoretische Rahmen der Arbeit vorgestellt. Das zweite Kapitel widmet sich der theoretischen Konzeptualisierung der Mittelschicht und atypischer Beschäftigung. Es werden verschiedene Definitionen und Abgrenzungen diskutiert und die wichtigsten Merkmale der beiden Phänomene herausgearbeitet. Das dritte Kapitel behandelt die Daten, Methoden und Variablen, die für die empirische Analyse verwendet werden. Es werden die gewählte Methode, die abhängige Variable und die erklärenden Variablen detailliert erläutert. Das vierte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Trendanalysen, die einen Überblick über die Entwicklung atypischer Beschäftigungsformen und der Einkommensentwicklung der Mittelschicht in Deutschland und Österreich liefern. Das fünfte Kapitel widmet sich den Strukturanalysen, die die Zusammenhänge zwischen atypischen Beschäftigungsformen und der Zugehörigkeit zur Mittelschicht genauer untersuchen. Das sechste Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Schlussfolgerungen, die aus den Analysen gezogen werden können.
Schlüsselwörter
Atypische Beschäftigungsformen, Mittelschicht, Soziale Ungleichheit, Arbeitsmarktflexibilisierung, Deutschland, Österreich, Zeitvergleich, Einkommensentwicklung, Wohlfahrtsstaat, Koordiniertes Arbeitsmarktsystem, Soziale Sicherung, Duales Ausbildungssystem, Tarifbindung, Niedriglohnquote, Ausgrenzungsthese.
Häufig gestellte Fragen
Besteht ein Zusammenhang zwischen atypischer Beschäftigung und dem Schrumpfen der Mittelschicht?
Die Arbeit untersucht, ob der Anstieg atypischer Arbeitsverhältnisse (wie Teilzeit oder Befristungen) die Wahrscheinlichkeit senkt, ein mittleres Einkommen zu erzielen, und somit zum Schrumpfen der Mittelschicht beiträgt.
Welche Länder werden in der Studie verglichen?
Die Analyse führt einen Zeitvergleich zwischen Deutschland und Österreich für die Jahre 2004 und 2011 durch.
Warum dient Deutschland als Vergleichsbasis für Österreich?
In Deutschland setzte eine Arbeitsmarktliberalisierung vergleichsweise früh ein. Daher werden die dortigen Entwicklungen genutzt, um mögliche Trends für den österreichischen Arbeitsmarkt zu prognostizieren.
Welche Risikogruppen werden in der Arbeit identifiziert?
Die Arbeit arbeitet spezifische Merkmale heraus, die das Risiko erhöhen, sich nicht mehr in der Mittelschicht zu verorten, insbesondere im Kontext wachsender sozialer Ungleichheit.
Was sind die zentralen forschungsleitenden Fragen?
Die Fragen lauten: (i) Gibt es einen Zusammenhang zwischen atypischer Arbeit und sinkender Chance auf mittleres Einkommen? (ii) Welche Merkmale führen zum Ausschluss aus der Mittelschicht?
- Citar trabajo
- Andreas Schulz (Autor), 2015, Atypische Beschäftigungsformen und das Schrumpfen der Mittelschicht. Deutschland und Österreich im Zeitvergleich 2004 und 2011, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319996