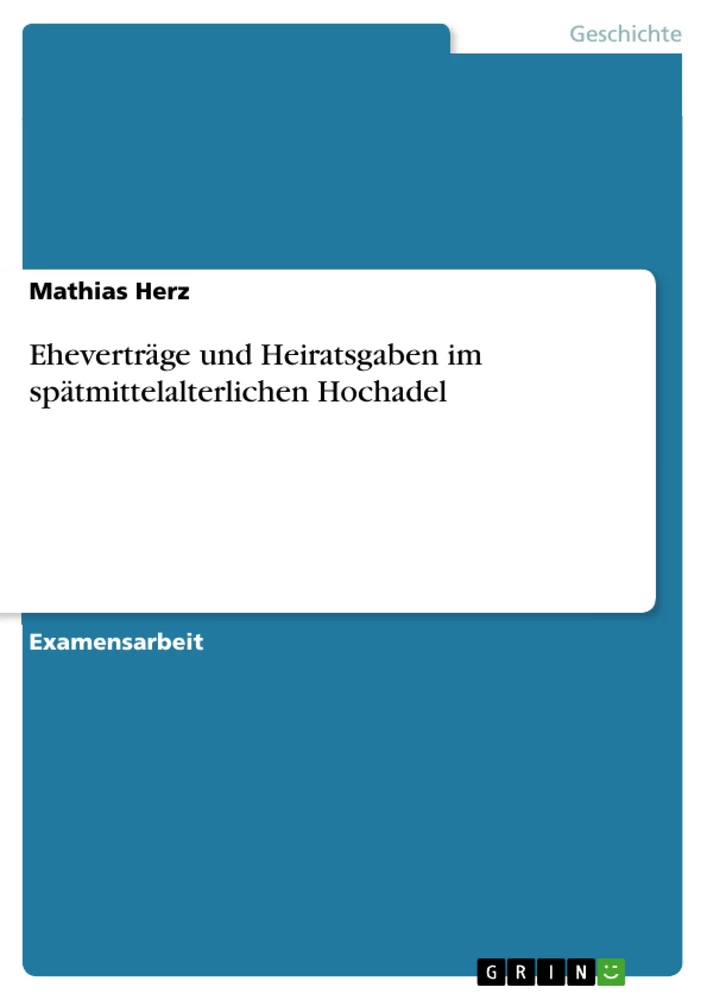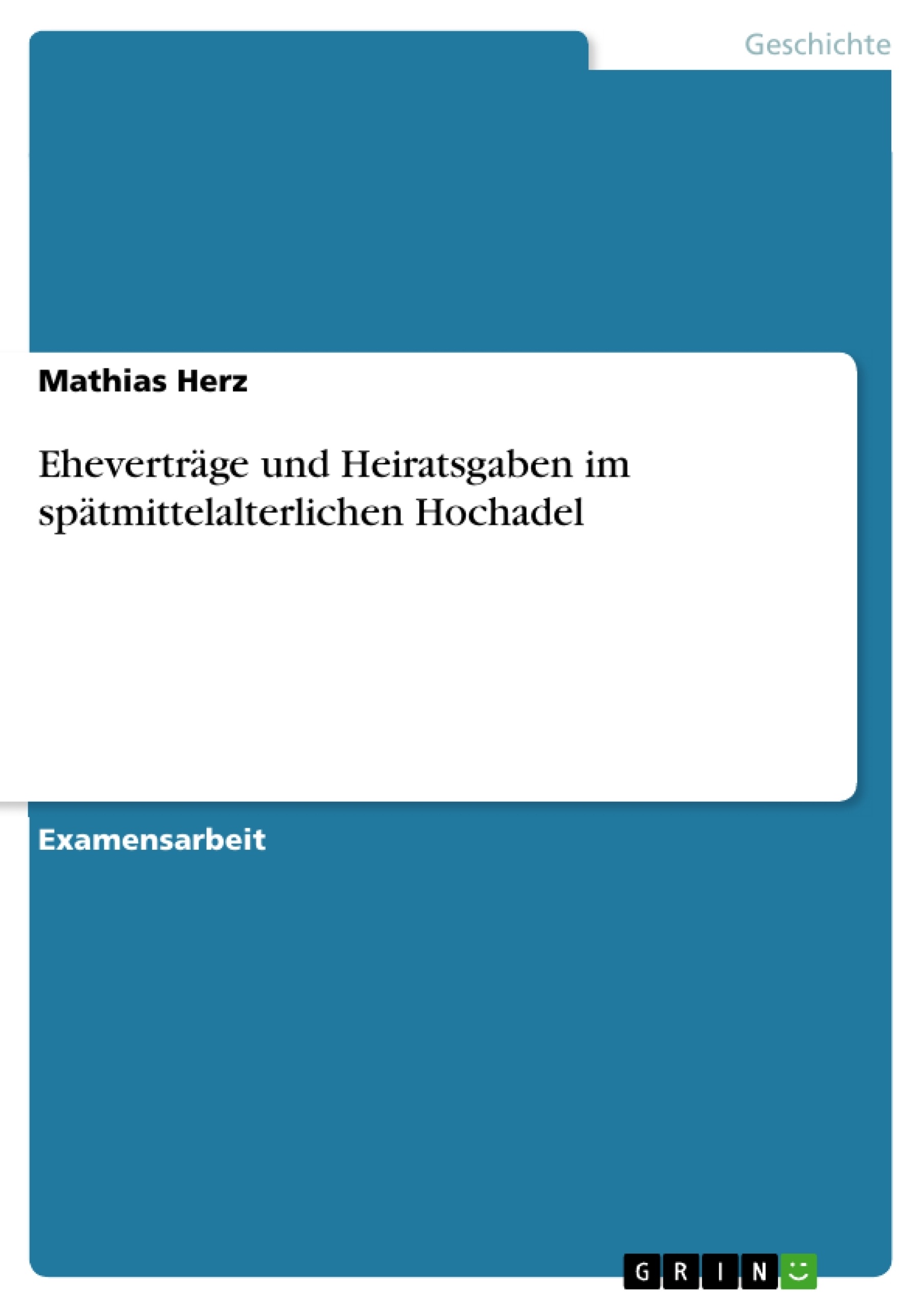Einleitung
Diese Arbeit soll einen Beitrag zur Erforschung des spätmittelalterlichen Hochadels leisten. Dabei werde ich mich auf den fürstlichen Hochadel(1), die Reichsfürsten(2), beschränken. Die Notwendigkeit, sich quellenimmanent mit dem Reichsfürstenstand zu beschäftigen, hat schon JULIUS FICKER angemahnt(3) und mit seiner umfangreichen Darstellung zum Reichsfürstenstand des Mittelalters einen großem Anfangsschritt in diese Richtung geleistet. Die Hinwendung zur Quellenkritik als Grundlage wissenschaftlicher Aussagen über verfassungs- und rechtsgeschichtliche Momente des Mittelalters erwuchs bei ihm aus den Widersprüchen, die sich zwischen den Aussagen der Rechtsbücher des 13. Jahrhunderts(4)
und dem überlieferten Urkundenmaterial des Mittelalters ergaben. JULIUS FICKER entwickelte daraus die These, daß die Rechtsbücher als
Erkenntnisquelle nur Gültigkeit haben, wenn die in ihnen enthaltenen
Aussagen mit den in den Urkunden fixierten Rechtszuständen konform
gehen(5). Tun sie dies nicht, ist den Urkunden als Quelle des historischen Erkenntnisprozesses der Vorrang einzuräumen. Der Grund dafür liegt in den verfassungs-, rechts- und letztendlich auch sozialgeschichtlichen Tatsachen, die in ihnen manifestiert sind.
Die Beschäftigung mit den Eheverträgen des spätmittelalterlichen
Fürstenadels eröffnet in dieser Hinsicht vielfältige Möglichkeiten der Erforschung von mittelalterlicher Wirklichkeit.
[...]
_______
(1) Zur Abgrenzung des fürstlichen vom nichtfürstlichen Adel und den „Grenzstufen“ (Fürstengenossen, gefürsteter Grafenstand) siehe weiter unten in Teil A.
(2) Moraw, P., S. 118: „Es fehlen [...] Studien über die Fürsten im Reich insgesamt, auch über ihre politisch-gesellschaftlichen Kontakte untereinander und ihr reichsständisches Verhalten. Zusammenfassende Werke [...] nahmen ihren Ausgangspunkt beim Königtum
und befaßten sich mit dem Fürstentum eher ex negativo.[...]
(3) Ficker, J., S. VII; S. 19 f.
(4) Goetz, H.-W., Proseminar, S.138: „Das älteste und bekannteste Werk ist der um 1225 entstandene Sachsenspiegel Eikes von Repgow, dessen lateinische Urfassung von Eike selbst ins Niederdeutsche übersetzt wurde [...] Nach seinem Vorbild entstanden um 1275 der Augsburger „Deutschenspiegel“ und der damit eng verwandte „Schwabenspiegel“,
der ein allgemeines deutsches Recht bieten wollte. Im europäischen Horizont betrachtet, ordnen sich die „Spiegel“ in eine ganze Reihe solcher stets persönlich gefärbter Rechtsbücher ein.“
(5) Schönherr, F., S. 8
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen, Forschungsstand, theoretische Erläuterungen
- Adel
- Reichsfürstenstand - Entwicklung und Bedeutung
- Ehe im spätmittelalterlichen Fürstenadel - Gratwanderung zwischen Möglichkeit und Beschränkung
- Das kanonische Eherecht
- Konsens
- Ehehindernisse
- Eheschließung im spätmittelalterlichen Fürstenadel
- Ehe-soziale Kontrolle und politisches Interesse
- Kriterien der Partnerwahl
- Das kanonische Eherecht
- Fürstliche Eheverträge des Spätmittelalters im Spiegel der Quellen
- Vermittler, Vertragspartner, Begründung der Eheschließung
- Vermittler
- Vertragspartner
- Bedeutung der Öffentlichkeit
- Begründung der Eheschließung
- Die rechte Ehe
- Ehegüterrecht und Heiratsgabensystem
- Heiratsgaben der Frauenseite
- Heimsteuer
- Aussteuer
- Heiratsgaben der Mannesseite
- Widerlegung
- Morgengabe
- Heiratsgaben der Frauenseite
- Wittum
- Erbrechtliche Vereinbarungen
- Zeugen und sonstige Vertragspunkte
- Schlußbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Eheverträge und Heiratsgaben im spätmittelalterlichen Hochadel, insbesondere den Reichsfürstenstand. Sie zielt darauf ab, die mittelalterliche Wirklichkeit anhand der Quellenlage zu erforschen und den Einfluss von kanonischem Recht, sozialen Normen und politischen Interessen auf die Eheschließungen aufzuzeigen.
- Kanonisches Eherecht und seine Auswirkung auf die Praktiken des Hochadels
- Die Rolle von Eheverträgen in der Sicherung von Macht und Besitz
- Das System der Heiratsgaben und seine Bedeutung für die Familienstrukturen
- Soziale und politische Aspekte der Partnerwahl im Hochadel
- Der Einfluss von Vermittlern und der Öffentlichkeit auf die Eheschließung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht Eheverträge und Heiratsgaben im spätmittelalterlichen Hochadel, insbesondere den Reichsfürstenstand, unter Heranziehung der Quellenkritik und im Kontext des bestehenden Forschungsstandes. Die Autorin/der Autor betont die Bedeutung der Urkunden als Primärquellen im Vergleich zu Rechtsbüchern und legt den Fokus auf die vielfältigen Möglichkeiten, die die Analyse von Eheverträgen für die Erforschung der mittelalterlichen Wirklichkeit bietet.
Begriffsbestimmungen, Forschungsstand, theoretische Erläuterungen: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die weitere Analyse. Es definiert den Begriff des Adels und Reichsfürstenstandes, beschreibt den aktuellen Forschungsstand und beleuchtet die theoretischen Ansätze, die der Untersuchung zugrunde liegen. Es wird die Forschungslücke bezüglich des Reichsfürstentums im Spätmittelalter aufgezeigt und die Bedeutung der Quellenkritik im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit hervorgehoben.
Adel: Dieses Kapitel behandelt den Adel im Spätmittelalter und bietet eine umfassende Definition und Abgrenzung von den verschiedenen Adelsgruppen. Es konzentriert sich auf die Definitionen und die Unterscheidung zwischen fürstlichem und nichtfürstlichem Adel. Die Definition des Reichsfürstenstandes wird präzisiert und dessen Bedeutung im Kontext der Eheschließungen erläutert.
Reichsfürstenstand - Entwicklung und Bedeutung: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung und Bedeutung des Reichsfürstenstandes im Spätmittelalter. Es beleuchtet die politische und gesellschaftliche Stellung der Reichsfürsten und ihren Einfluss auf die Eheschließungen innerhalb des Hochadels. Der Fokus liegt auf dem historischen Kontext und den strukturellen Gegebenheiten, die die Eheschließungen beeinflussten.
Ehe im spätmittelalterlichen Fürstenadel - Gratwanderung zwischen Möglichkeit und Beschränkung: Dieses Kapitel analysiert die Ehe im spätmittelalterlichen Fürstenadel unter dem Gesichtspunkt des kanonischen Eherechts. Es untersucht die Aspekte des Konsenses und der Ehehindernisse sowie die praktische Umsetzung der Eheschließungen im Kontext sozialer Kontrolle und politischer Interessen. Die Kriterien der Partnerwahl werden im Detail erläutert.
Fürstliche Eheverträge des Spätmittelalters im Spiegel der Quellen: Dieses Kapitel befasst sich mit den fürstlichen Eheverträgen als Quellen und ihrer Bedeutung für das Verständnis mittelalterlicher Ehen. Die Analyse der Quellen wird beleuchtet, um ein detailliertes Bild der Vertragsgestaltung und der dahinterliegenden Motive zu ermöglichen. Die verschiedenen Aspekte der Vertragsgestaltung werden beleuchtet.
Vermittler, Vertragspartner, Begründung der Eheschließung: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Vermittler, Vertragspartner und die Bedeutung der Öffentlichkeit bei der Begründung der Eheschließung. Es analysiert die verschiedenen Akteure und deren Einfluss auf die Eheverträge. Die Bedeutung der öffentlichen Bekanntmachung der Eheschließung wird beleuchtet.
Die rechte Ehe: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff der „rechten Ehe“ im spätmittelalterlichen Kontext und den damit verbundenen rechtlichen und sozialen Implikationen. Es analysiert die Kriterien, die eine Ehe als „recht“ erscheinen ließen und die Konsequenzen, die sich aus einer nicht „rechten Ehe“ ergaben.
Ehegüterrecht und Heiratsgabensystem: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Ehegüterrecht und dem System der Heiratsgaben. Es analysiert die Heiratsgaben der Frauenseite (Heimsteuer und Aussteuer) und der Mannesseite (Widerlegung und Morgengabe) und deren Bedeutung für die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der Ehepartner.
Wittum: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Wittum, ein wichtiger Aspekt des Ehevertrags. Es erläutert die rechtlichen Regelungen und die soziale Funktion des Wittums für die Witwe. Die Bedeutung des Wittums im Kontext des Erbrechts und der Versorgung der Witwe wird analysiert.
Erbrechtliche Vereinbarungen: Dieses Kapitel behandelt die erbrechtlichen Vereinbarungen in den Eheverträgen. Es analysiert, wie die Erbfolge und der Besitz in den Eheverträgen geregelt wurden und welche Auswirkungen dies auf die Familien und deren Vermögen hatte.
Zeugen und sonstige Vertragspunkte: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der Zeugen und anderen Vertragsdetails in den Eheverträgen. Es beleuchtet die Bedeutung der Zeugenaussagen und die Bedeutung weiterer Klauseln in den Verträgen.
Schlüsselwörter
Spätmittelalter, Hochadel, Reichsfürstenstand, Eheverträge, Heiratsgaben, Kanonisches Recht, Ehegüterrecht, Wittum, Erbrecht, Quellenkritik, soziale Kontrolle, politische Interessen, Partnerwahl.
Häufig gestellte Fragen zu: Eheverträge und Heiratsgaben im spätmittelalterlichen Hochadel
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Eheverträge und Heiratsgaben im spätmittelalterlichen Hochadel, insbesondere den Reichsfürstenstand. Sie analysiert den Einfluss von kanonischem Recht, sozialen Normen und politischen Interessen auf die Eheschließungen dieser Zeit.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse von Primärquellen wie fürstlichen Eheverträgen. Die AutorIn betont die Bedeutung der Quellenkritik im Vergleich zu sekundären Quellen wie Rechtsbüchern.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie kanonisches Eherecht (Konsens, Ehehindernisse), die Rolle von Eheverträgen bei der Sicherung von Macht und Besitz, das System der Heiratsgaben (Heimsteuer, Aussteuer, Widerlegung, Morgengabe), soziale und politische Aspekte der Partnerwahl, den Einfluss von Vermittlern und der Öffentlichkeit auf die Eheschließung, das Ehegüterrecht, das Wittum und erbrechtliche Vereinbarungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Begriffsbestimmungen, Adel, Reichsfürstenstand, Ehe im spätmittelalterlichen Fürstenadel, fürstliche Eheverträge, Vermittler und Vertragspartner, die „rechte Ehe“, Ehegüterrecht und Heiratsgabensystem, Wittum, erbrechtliche Vereinbarungen, Zeugen und sonstige Vertragspunkte sowie Schlussbemerkungen. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung und konzentriert sich auf spezifische Aspekte der Thematik.
Welche Bedeutung hat das kanonische Recht?
Das kanonische Recht spielte eine zentrale Rolle, indem es den Rahmen für die Eheschließung vorgab (Konsens, Ehehindernisse). Die Arbeit untersucht, wie dieses Recht in der Praxis des Hochadels umgesetzt und beeinflusst wurde.
Welche Rolle spielten Heiratsgaben?
Heiratsgaben (Heimsteuer, Aussteuer, Widerlegung, Morgengabe) waren ein wichtiger Bestandteil der Eheverträge. Sie beeinflussten die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der Ehepartner und spiegeln die Bedeutung von Besitz und Vermögen in der damaligen Gesellschaft wider.
Welche Bedeutung hatte das Wittum?
Das Wittum sicherte die Versorgung der Witwe nach dem Tod des Ehemannes. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Regelungen und die soziale Funktion des Wittums.
Welche Rolle spielten soziale und politische Interessen?
Soziale Kontrolle und politische Interessen hatten einen erheblichen Einfluss auf die Partnerwahl und die Gestaltung der Eheverträge. Die Arbeit untersucht, wie diese Faktoren die Eheschließungen im Hochadel prägten.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Kapitel "Schlussbemerkungen" der Arbeit detailliert beschrieben und lassen sich hier nicht vollständig zusammenfassen.) Die Arbeit liefert einen detaillierten Einblick in die Praxis der Eheschließungen und Heiratsgaben im spätmittelalterlichen Hochadel, indem sie die Komplexität der Interaktion zwischen Recht, sozialen Normen und politischen Interessen aufzeigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Spätmittelalter, Hochadel, Reichsfürstenstand, Eheverträge, Heiratsgaben, Kanonisches Recht, Ehegüterrecht, Wittum, Erbrecht, Quellenkritik, soziale Kontrolle, politische Interessen, Partnerwahl.
- Arbeit zitieren
- Mathias Herz (Autor:in), 1997, Eheverträge und Heiratsgaben im spätmittelalterlichen Hochadel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31