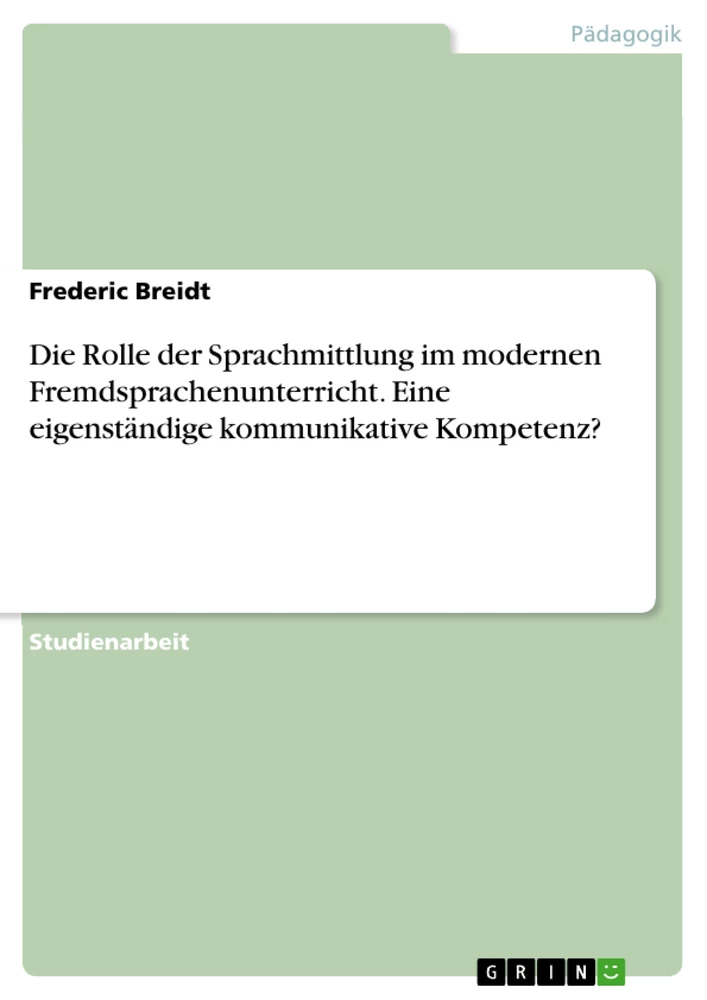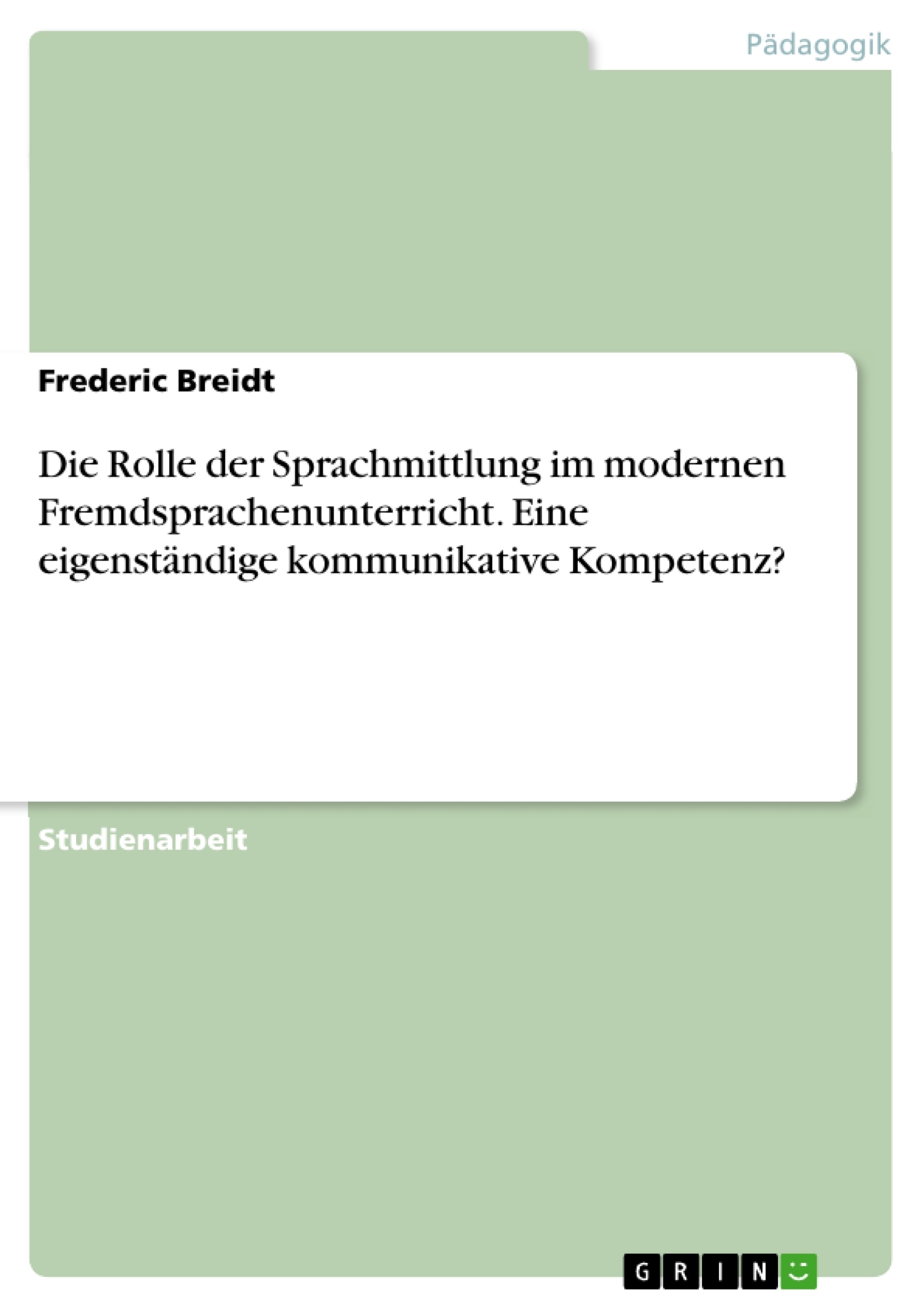Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Rolle der Sprachmittlung im modernen gymnasialen Fremdsprachenunterricht. Sie beleuchtet unter anderem die Anforderungen, welche diese neuartige Fertigkeit für die Schülerinnen und Schüler mit Blick auf die sprachlich-kommunikative und interkulturelle Kompetenz darstellt. Auch wird darauf eingegangen, welche Kriterien gelungene Sprachmittlungsaufgaben berücksichtigen müssen.
Seit geraumer Zeit sehen sich vor allem Kultus- und Bildungsministerien in der Pflicht, die schulische Ausbildung um praxisnahe Aspekte zu erweitern, nicht zuletzt um dem Gelerntem mehr Bezug zum realen Leben geben zu können. Im Zuge dieser Entwicklung gewinnt die interkulturelle Komponente des Sprachunterrichtes, welche ich insbesondere in meiner wissenschaftlichen Arbeit beleuchten möchte, wesentlich an Bedeutung, denn die Schüler/innen sollen die Kompetenz erlangen sich sicher und frei zwischen Kulturen bewegen können. Dies erfordert sowohl ein gewisses Maß an allgemeinem Wissen über die jeweilige Kultur als auch die Fähigkeit, Sachverhalte sprachlich, aber auch inhaltlich korrekt vermitteln zu können, es impliziert somit den Grundgedanken der Sprachmittlung und ist zu einem wichtigen Plan des Bildungsplans geworden.
Jene signifikante Aufwertung hat die Sprachmittlung bereits 2001 durch die Aufnahme in den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GeR), den Einheitlichen Prüfungsanforderungen im Abitur für die modernen Fremdsprachen (EPA) und somit auch in den aktuellen curricularen Vorgaben für den modernen Fremdsprachenunterricht aller Bundesländer erfahren. Diese Vorgaben verdeutlichen, dass die inhaltliche Gestaltung des Fremdsprachenunterrichts in zunehmendem Maße durch die Sprachmittlung, die neue „Fertigkeit“, beeinflusst wird. Auf diese Veränderungen mussten sich nicht nur die Schüler/Innen und Lehrer/Innen einstellen, sondern auch viele Fremdsprachendidaktiker/Innen betraten im Bereich der Theorie und Praxis oftmals Neuland, weshalb die wissenschaftliche Erforschung dieser „neuen“ Kompetenz teilweise noch aussteht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Sprachmittlung?
- 2.1 Warum sollte Sprachmittlung im Gymnasialunterricht verwendet werden?
- 3. Anforderungen an die Schüler/Innen mit Blick auf die sprachlich-kommunikative und interkulturelle Kompetenz
- 4. Sprachmittlungsaufgaben und ihre Qualität
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Sprachmittlung im gymnasialen Fremdsprachenunterricht. Sie klärt zunächst den Begriff der Sprachmittlung, differenziert ihn von Übersetzung und Dolmetschen und beleuchtet seine zunehmende Relevanz im Kontext der Globalisierung und der interkulturellen Kommunikation. Die Arbeit analysiert die Anforderungen an Schüler*innen bezüglich sprachlich-kommunikativer und interkultureller Kompetenzen im Bereich der Sprachmittlung und untersucht Kriterien für gelungene Sprachmittlungsaufgaben.
- Definition und Abgrenzung von Sprachmittlung, Übersetzung und Dolmetschen
- Bedeutung der Sprachmittlung im Kontext von Globalisierung und interkultureller Kommunikation
- Anforderungen an die sprachlich-kommunikative und interkulturelle Kompetenz der Schüler*innen
- Kriterien für gelungene Sprachmittlungsaufgaben
- Didaktische Implikationen für den Fremdsprachenunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung erläutert den wachsenden Stellenwert praxisnaher Aspekte im schulischen Unterricht und hebt die Bedeutung der interkulturellen Komponente im Sprachunterricht hervor. Sie betont die zunehmende Relevanz der Sprachmittlung, ihre Aufnahme in den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GeR) und die daraus resultierenden Herausforderungen für Schüler*innen, Lehrer*innen und Fremdsprachendidaktiker*innen. Die Arbeit skizziert ihre Zielsetzung: die Klärung des Begriffs Sprachmittlung, die Untersuchung ihrer Bedeutung im Fremdsprachenunterricht, die Analyse der Anforderungen an Schüler*innen und die Bestimmung von Kriterien für gelungene Sprachmittlungsaufgaben.
2. Was ist Sprachmittlung?: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Sprachmittlung“ und grenzt ihn von „Übersetzung“ und „Dolmetschen“ ab. Es wird deutlich, dass Sprachmittlung im schulischen Kontext anders verstanden wird als in der Sprachwissenschaft. Im Fokus steht die sinngetreue Vermittlung von Inhalten unter Berücksichtigung des Kontextes und der Bedürfnisse des Adressaten, im Gegensatz zur wortgetreuen Wiedergabe bei Übersetzung und Dolmetschen. Der Kapitel verweist auf die historische Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts und die Abkehr vom übersetzungslastigen Ansatz zugunsten kommunikativer Kompetenz.
2.1 Warum sollte Sprachmittlung im Gymnasialunterricht verwendet werden?: Dieser Abschnitt unterstreicht die praktische Relevanz der Sprachmittlung im Alltag und im Beruf angesichts der Globalisierung und der zunehmenden interkulturellen Begegnungen. Er betont die Notwendigkeit, fremdsprachige Informationen in die Muttersprache zu übertragen, um den weltweiten Zugriff auf Informationen im Internet zu ermöglichen und die Mehrsprachigkeit der EU-Bürger zu fördern. Die Fähigkeit zur Sprachmittlung wird als essentielle Kompetenz für die Teilhabe an einer globalisierten Welt dargestellt.
Schlüsselwörter
Sprachmittlung, Übersetzung, Dolmetschen, interkulturelle Kompetenz, kommunikative Kompetenz, Fremdsprachenunterricht, Globalisierung, Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GeR), Adressatenorientierung, Didaktik.
Häufig gestellte Fragen zu: Sprachmittlung im gymnasialen Fremdsprachenunterricht
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Sprachmittlung im gymnasialen Fremdsprachenunterricht. Sie definiert den Begriff Sprachmittlung, grenzt ihn von Übersetzung und Dolmetschen ab und untersucht seine Bedeutung im Kontext der Globalisierung und interkulturellen Kommunikation. Weiterhin analysiert sie die Anforderungen an Schüler*innen hinsichtlich sprachlich-kommunikativer und interkultureller Kompetenzen und entwickelt Kriterien für gelungene Sprachmittlungsaufgaben. Die Arbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zur Definition von Sprachmittlung, zu ihrer Bedeutung im Unterricht, zu den Anforderungen an Schüler*innen und ein Fazit. Schlüsselbegriffe und eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel werden ebenfalls bereitgestellt.
Was versteht die Arbeit unter Sprachmittlung und wie unterscheidet sie diese von Übersetzung und Dolmetschen?
Die Arbeit definiert Sprachmittlung als die sinngetreue Vermittlung von Inhalten unter Berücksichtigung des Kontextes und der Bedürfnisse des Adressaten. Im Gegensatz dazu stehen Übersetzung und Dolmetschen, die eine wortgetreuere Wiedergabe anstreben. Die Arbeit betont den Unterschied im schulischen Kontext, wo Sprachmittlung anders verstanden wird als in der Sprachwissenschaft.
Warum ist Sprachmittlung im gymnasialen Unterricht wichtig?
Die Arbeit argumentiert, dass Sprachmittlung angesichts der Globalisierung und zunehmender interkultureller Begegnungen eine essentielle Kompetenz darstellt. Sie ermöglicht den Zugang zu weltweiten Informationen und fördert die Mehrsprachigkeit. Die Fähigkeit, fremdsprachige Informationen in die Muttersprache zu übertragen, wird als entscheidend für die Teilhabe an einer globalisierten Welt gesehen.
Welche Anforderungen stellt Sprachmittlung an Schüler*innen?
Die Arbeit analysiert die Anforderungen an die sprachlich-kommunikative und interkulturelle Kompetenz von Schüler*innen im Bereich der Sprachmittlung. Es geht darum, Inhalte sinngetreu und adressatenorientiert zu vermitteln, den Kontext zu berücksichtigen und die jeweilige kommunikative Situation angemessen zu meistern.
Welche Kriterien kennzeichnen gelungene Sprachmittlungsaufgaben?
Die Arbeit legt Kriterien für gelungene Sprachmittlungsaufgaben dar, die sich auf die sinngetreue und adressatenorientierte Vermittlung von Inhalten konzentrieren. Weitere Kriterien beziehen sich auf die Berücksichtigung des Kontextes und die angemessene Bewältigung der kommunikativen Situation.
Welche didaktischen Implikationen ergeben sich für den Fremdsprachenunterricht?
Die Arbeit weist auf didaktische Implikationen für den Fremdsprachenunterricht hin, die sich aus den Ergebnissen der Analyse von Sprachmittlungsaufgaben und den Anforderungen an die Schüler*innen ergeben. Konkrete didaktische Vorschläge werden jedoch nicht explizit genannt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Arbeit verwendet Schlüsselwörter wie Sprachmittlung, Übersetzung, Dolmetschen, interkulturelle Kompetenz, kommunikative Kompetenz, Fremdsprachenunterricht, Globalisierung, Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GeR), Adressatenorientierung und Didaktik.
- Quote paper
- Frederic Breidt (Author), 2013, Die Rolle der Sprachmittlung im modernen Fremdsprachenunterricht. Eine eigenständige kommunikative Kompetenz?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320004