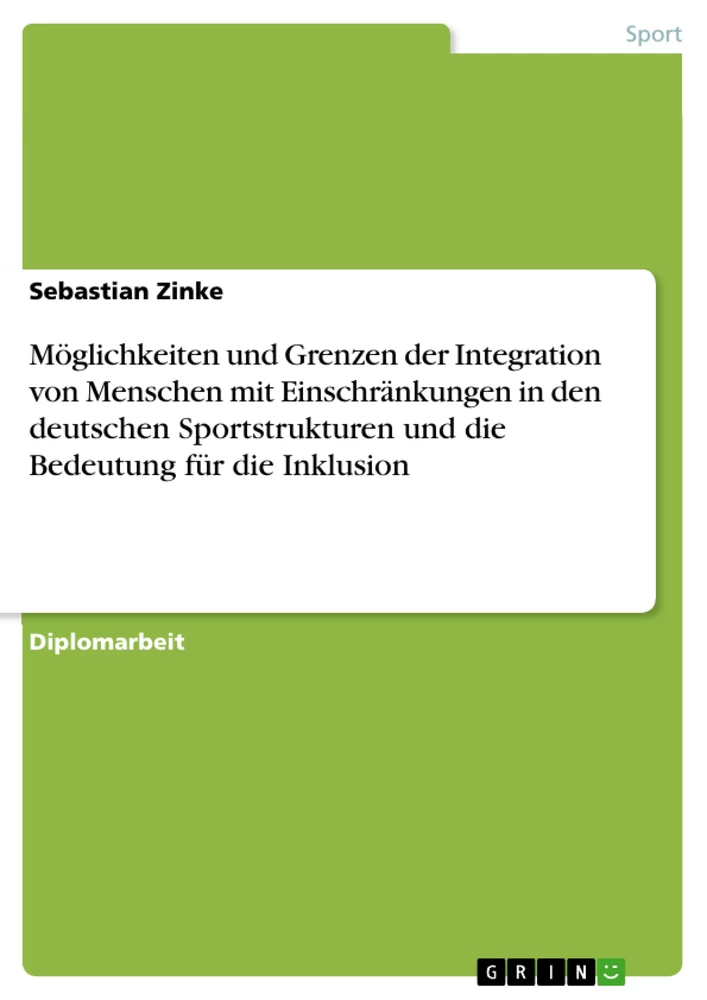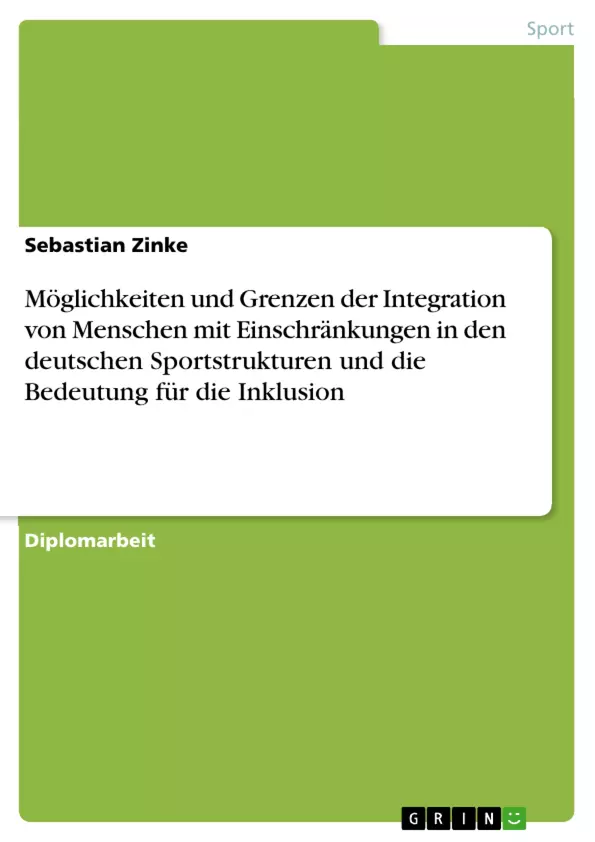„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“(Artikel 3 Abs. 3 im deutschen Grundgesetz)
Sind Menschen mit Einschränkungen in den deutschen Sportstrukturen benachteiligt? Der Druck dieser Frage verstärkt sich durch die seit 2009 in Deutschland geltende UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), deren zentrale Begriffe die Chancengleichheit, die Würde, die Barrierefreiheit und die selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe sind. Darüber hinaus tauchen in ihr die Begriffe Integration und Inklusion auf. Die UN-BRK stellt aktuelle strukturelle Bedingungen auf den Prüfstand und formuliert inhaltliche Fragen. Wie sehen integrative und inklusive Konzepte aus? Dieser politischen Dimension und Entwicklung können sich die deutschen Sportstrukturen nicht entziehen.
Die vorliegende Arbeit untersucht strukturelle und inhaltliche Fragen. Die zentralen Begriffe Behinderung, Integration und Inklusion sind in ihrer Bedeutung und Entwicklung durch die Geschichte und den Autoren der jeweiligen Wissenschaftsbereiche geprägt und bedürfen zuerst einer Klärung. Die Frage nach integrierenden und ab- und ausgrenzenden Mechanismen ist eine klassische Frage der Sportsoziologie. Aus diesem Grund orientiere ich mich an systemtheoretischen Strategien, um die deutschen Sportstrukturen zu analysieren, im Allgemeinen und im behindertenspezifischen Bereich. Auf Verbands- und Vereinsebene wird der aktuelle Stand skizziert und bewertet. Die inhaltliche Analyse untersucht bestehende Sportangebote für Menschen mit Einschränkungen und ihre Relevanz für die gesellschaftliche Teilhabe. Die Rahmenbedingungen der deutschen Sportstrukturen werden betrachtet, um ihre Abhängigkeit vom Umfeld darzustellen. Die Erkenntnisse dieser Arbeit formulieren eine aktuellen Stand, die Möglichkeiten und Grenzen und eine Perspektive für die Zukunft.
Persönliche Erfahrungen sind in der Wissenschaft oft der Ausgangspunkt für die Wahl der wissenschaftlichen Forschungsfrage. So ist es auch bei mir. Mit dieser Arbeit beantworte ich mir Fragen, die sich durch meine praktische Arbeit in über zehn Jahren im Integrationssport des SV Pfefferwerk e.V. Berlin für mich ergeben haben. Aus diesem Grund sind viele Themen anschaulich und praktisch dargestellt. Diese Arbeit versucht einfache Antworten auf komplizierte Fragen zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Historie des Begriffes „Behinderung“
- Geschichtlicher Abriss
- Zwischenfazit Historie
- Begriffsklärung von Behinderung, Integration und Inklusion
- Der Begriff „Behinderung“
- Medizinisch-juristische Definition im §2 des Sozialgesetzbuches
- Die behindertenpädagogische Definition
- Die Definition der WHO
- Die soziologische Definition
- Die verschiedenen Definitionen von Behinderung und ihre Bedeutung
- Die Verwendung der Behinderungsbegriffe
- Die Dekategorisierung von Behinderung
- Verschiedene Behinderungs- und Schädigungsformen
- Sichtweisen und Handlungsmodelle zum „Problem\" Behinderung
- Der Begriff der Integration
- In der Geschichte
- Definition
- Verschiedene Perspektiven von Integration
- Der Begriff der Inklusion
- In der Geschichte
- Definition
- Der Begriff Inklusion vs. Integration
- Das Modell der fünf Stufen nach Sander
- Exklusion/Inklusion/Integration aus systemtheoretischer Sicht
- Zwischenfazit zu den Begriffen Integration und Inklusion
- Der Begriff „Behinderung“
- Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung
- Die sozialen Reaktionen und ihre Ursachen
- Veränderungsmöglichkeiten der sozialen Reaktion
- Einstellung von Menschen mit Einschränkungen untereinander
- Zwischenfazit zur Einstellungsänderung
- Statistik - Menschen mit Behinderung in Deutschland
- Menschen mit Einschränkung in den deutschen Sportstrukturen
- Die UN-Behindertenrechtskonvention
- Der Artikel 30 Punkt 5
- Arbeitspapier „Bewegung leben - Inklusiv leben”
- Die Sportstrukturen für Menschen mit Einschränkungen
- Die Verbände
- Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB)
- Der Deutsche Gehörlosenverband (DGS)
- Der Deutsche Behindertensportverband (DBS)
- Die Special Olympics Deutschland (SOD)
- Der Behindertensportverband (DBS) aus systemtheoretischer Sicht
- Zwischenfazit zu den Sportverbänden
- Die Sportvereine
- Definition und Gesetz
- Vereinsmerkmale
- Vereinstypen und Kategorien
- Die Veränderungen im Sportverein
- Modelle und Möglichkeiten des Integrationssports
- Integration durch Kommunikation und Assistenz
- Die Verbände
- Sport für Menschen mit Einschränkung
- Der Spitzensport/Leistungssport
- Der Stellenwert des Leistungssports für die Integration
- Die Chancen des Wettkampfsports
- Rollstuhlbasketball - „Inklusion als Rechenaufgabe\" (TAGESSPIEGEL, 2013,11)
- Unified Sports”
- Anforderung an den Wettkampfsport
- Der Gesundheitssport im DBS
- Freizeit und Breitensport
- Freizeitverhalten von Menschen mit Einschränkung
- Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen mit Einschränkung
- Integrative Didaktik und Pädagogik im Freizeitbereich
- Grundposition integrativer Pädagogik
- Die „Psychomotorik”
- Praktischen Beispiel für ein integratives Sportangebot
- Konsequenzen für die Praxis des Integrationssports
- Die Bedeutung der integrativen Pädagogik und Didaktik für den Sportverein
- Der Spitzensport/Leistungssport
- Sporthallen - Barrierefreiheit und Barriereabbau
- Die Geschichte der Barrierefreiheit
- Die Barrierefreiheit im Gesetz und im Sportalltag
- Die Sporthallensituation in Deutschland
- Zwischenfazit zur Sporthallensituation
- Die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Sporthallen
- Die Aus- und Fortbildung der Übungsleiter im Integrationssport
- Notwendige Schritte für die Aus- und Fortbildung
- Aktuelle Förderprogramme für integrative Maßnahmen
- Erlebte Integrative Sportschule (EISS)
- Das Integrationssportprogramm des Hamburger Sportbundes
- Gegenüberstellung der Förderprogramme
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Integration von Menschen mit Einschränkungen in den deutschen Sportstrukturen und deren Bedeutung für die Inklusion. Sie untersucht strukturelle und inhaltliche Fragen, analysiert die Bedeutung der Begriffe Behinderung, Integration und Inklusion im Kontext der deutschen Sportstrukturen und beleuchtet die Rahmenbedingungen für die Integration von Menschen mit Einschränkungen im Sport.
- Die historische Entwicklung und die verschiedenen Definitionen von Behinderung
- Die Bedeutung der Begriffe Integration und Inklusion im Kontext des Sports
- Die Analyse der Sportstrukturen für Menschen mit Einschränkungen auf Verbands- und Vereinsebene
- Die Untersuchung bestehender Sportangebote für Menschen mit Einschränkungen und deren Relevanz für die gesellschaftliche Teilhabe
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten der Integration von Menschen mit Einschränkungen im Sport
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage beleuchtet. Im Anschluss werden die Begriffe Behinderung, Integration und Inklusion definiert und in ihren historischen Kontext gesetzt. Kapitel 4 untersucht die Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung, während Kapitel 5 statistische Daten zu Menschen mit Einschränkungen in Deutschland präsentiert. Kapitel 6 beleuchtet die UN-Behindertenrechtskonvention und deren Bedeutung für die Integration im Sport. Kapitel 7 analysiert die Sportstrukturen für Menschen mit Einschränkungen auf Verbands- und Vereinsebene. Kapitel 8 befasst sich mit verschiedenen Sportangeboten für Menschen mit Einschränkungen. Kapitel 9 analysiert die Barrierefreiheit in Sporthallen. Kapitel 10 widmet sich der Aus- und Fortbildung von Übungsleitern im Integrationssport. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die zentralen Ergebnisse zusammenfasst und Perspektiven für die Zukunft aufzeigt.
Schlüsselwörter
Integration, Inklusion, Behinderung, Sportstrukturen, Sportangebote, Menschen mit Einschränkungen, UN-Behindertenrechtskonvention, Barrierefreiheit, Sportvereine, Sportverbände, Übungsleiter, Förderprogramme.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion im Sport?
Integration bedeutet die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in bestehende Strukturen, während Inklusion verlangt, dass die Strukturen von vornherein so gestaltet sind, dass jeder ohne Barrieren teilhaben kann.
Welche Bedeutung hat die UN-Behindertenrechtskonvention für den Sport?
Die Konvention (insb. Art. 30) verpflichtet Deutschland dazu, Menschen mit Behinderung eine gleichberechtigte Teilnahme an Sport- und Freizeitaktivitäten zu ermöglichen.
Was sind die größten Barrieren für Inklusion in Sportvereinen?
Neben baulichen Barrieren (fehlende Barrierefreiheit in Hallen) sind es oft Vorurteile, mangelnde Qualifikation der Übungsleiter und starre Verbandsstrukturen.
Welche Rolle spielen Verbände wie der DBS oder Special Olympics?
Diese Verbände organisieren den Breiten- und Leistungssport für Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen und setzen sich politisch für deren Rechte ein.
Was ist „Psychomotorik“ im Kontext des Integrationssports?
Ein ganzheitliches pädagogisches Konzept, das die enge Verbindung von körperlicher Bewegung und psychischem Erleben nutzt, um die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Zinke (Autor:in), 2013, Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Menschen mit Einschränkungen in den deutschen Sportstrukturen und die Bedeutung für die Inklusion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320070