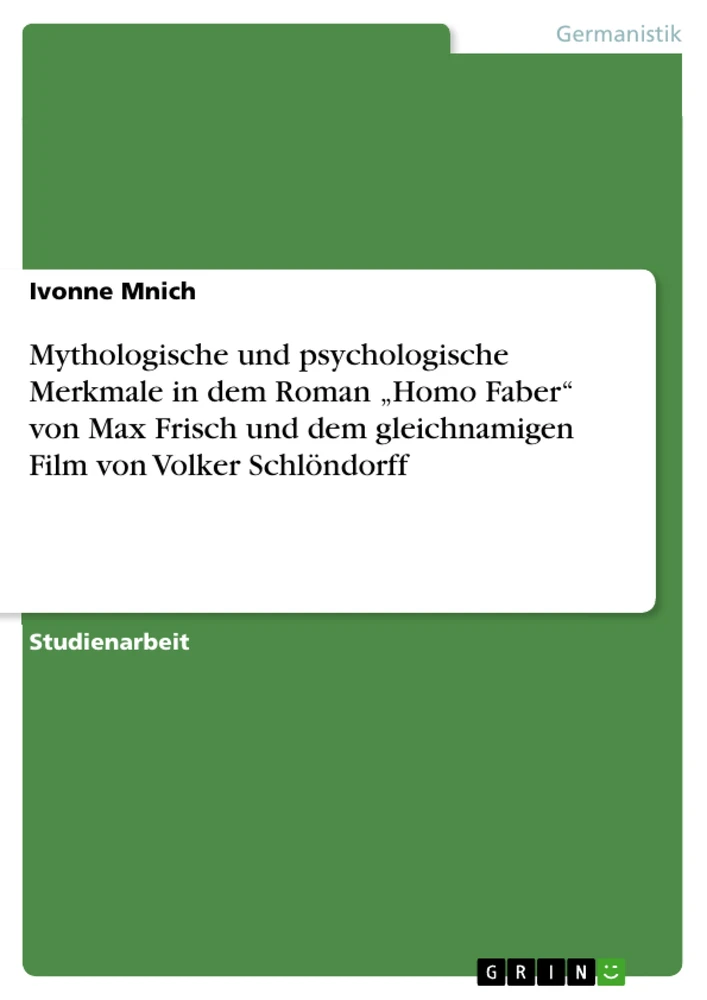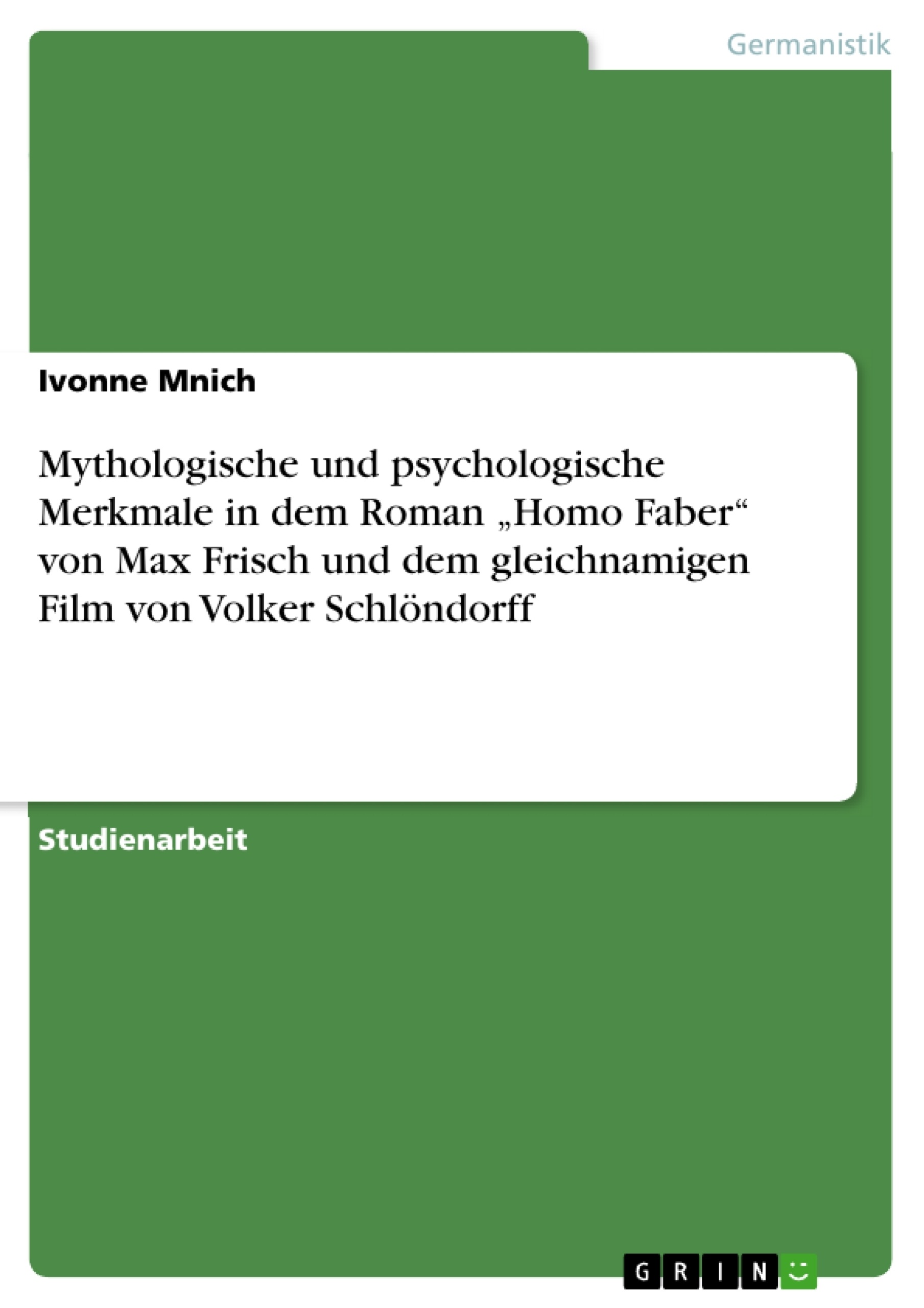Im Jahre 1957 ist der von Max Frisch als Bericht betitelte Roman „Homo Faber“ erschienen. Dieser entwickelte sich kurz nach der Veröffentlichung zum Bestseller und wird 1991, unter Regie von Volker Schlöndorff, gleichnamig verfilmt. In dieser Seminararbeit lege ich das Augenmerk auf die verschachtelten mythologischen Merkmale und Motive antiker griechischer Tragödien, die Max Frisch in seinem Roman aufleuchten lässt. Bereits in dem Titel „Homo Faber“ wird der Bezug zum Mythos sichtbar. Welcher Mythos die größte Rolle in „Homo Faber“ einnimmt, wird in der Arbeit anhand von Belegen nachgewiesen und genauer untersucht.
Um einen engeren Sinn hinter den versteckten Motiven zu erkennen, möchte ich die psychologische Struktur, die sich aus dem Roman herleiten lässt, dazuziehen und Zusammenhänge zu den Ödipus-Mythos untersuchen. Insbesondere gehe ich hier auf den Ödipuskomplex ein, um ein Verständnis von den Beziehungen zwischen den Figuren und den Bezug zum Ödipus-Mythos in dem Roman darzulegen. Der Aspekt der Technikverbundenheit von Faber und die Beziehung zwischen den Protagonisten werden hier mit einbezogen. Einen Teil dieser Arbeit widme ich der Gegenüberstellung von Max Frischs „Homo Faber“ und der gleichnamigen Verfilmung von Volker Schlöndorff, um die Mittel der unterschiedlichen Medien zur Vermittlung der mythologischen Motive wiederzugeben.
Für einen Roman des 20. Jahrhunderts finden sich erstaunlich viele Parallelen zu antiken griechischen Tragödien. Gerade in diesem Zeitalter der Technisierung findet eine erhöhte Auseinandersetzung mit dem Unterbewussten und dem Sinn des Seins statt. Der Gegensatz zwischen Technik und Schicksal sowie die Verbindung zum Protagonisten Faber treten sehr in den Vordergrund des Romans. Durch eine doppelte Erzähltechnik, Hauptfigur auf der einen Seite und Berichterstatter auf der anderen, bekommt der Leser Einblick in die Gefühlswelt und Selbstkonflikte von Faber. Dies wird durch die Form eines tagebuchartigen Berichts verstärkt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Technik und Schicksal
- 2. Antike Tragödien und „Homo Faber“
- 3. Hinweise auf mythologische Zusammenhänge
- 3.1 Ödipus
- 4. Beziehungsschema der Hauptfiguren
- 5. Psychologische Aspekte / Ödipuskomplex
- 6. Vergleich: Max Frisch und Volker Schlöndorff
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die mythologischen und psychologischen Merkmale in Max Frischs Roman „Homo Faber“ und vergleicht diese mit der gleichnamigen Verfilmung von Volker Schlöndorff. Die Arbeit analysiert die verwebebten mythologischen Motive antiker griechischer Tragödien, insbesondere den Ödipuskomplex, im Kontext des Romans. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Protagonisten Faber, seinem Verhältnis zur Technik und seinen Beziehungen zu den anderen Figuren.
- Die Auseinandersetzung zwischen Technik und Schicksal im Leben Fabers.
- Die Parallelen zwischen „Homo Faber“ und antiken griechischen Tragödien.
- Die Rolle des Ödipuskomplexes in der Beziehung zwischen Faber, Sabeth und Hanna.
- Die psychologische Struktur der Hauptfigur und ihre Konflikte.
- Der Vergleich der Darstellung mythologischer Motive im Roman und im Film.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Roman „Homo Faber“ von Max Frisch und dessen Verfilmung durch Volker Schlöndorff. Sie hebt die überraschenden Parallelen zu antiken griechischen Tragödien hervor und kündigt die Schwerpunkte der Arbeit an: die Analyse mythologischer Merkmale, die Untersuchung der psychologischen Aspekte, insbesondere des Ödipuskomplexes, und den Vergleich zwischen Roman und Verfilmung. Der Bezug zum Mythos im Titel wird bereits erwähnt, und die Arbeit kündigt an, den wichtigsten Mythos im Roman zu identifizieren und zu untersuchen.
II. Hauptteil: Der Hauptteil befasst sich eingehend mit den zentralen Themen des Romans. Er beginnt mit der Analyse des Spannungsverhältnisses zwischen Fabers technischem Denken und dem schicksalhaften Verlauf seines Lebens, wobei die Bedeutung von Technologie und deren Rolle in Fabers Leben betont wird. Die Arbeit stellt Parallelen zu antiken Tragödien, insbesondere der Ödipus-Tragödie, her und untersucht die mythologischen Bezüge im Roman, einschließlich der Beziehung zwischen Faber, Sabeth und Hanna, sowie die psychologischen Aspekte, insbesondere den Ödipuskomplex und dessen Einfluss auf die Handlung und die Charaktere. Schließlich vergleicht der Hauptteil die Darstellung der mythologischen Motive im Roman und in Schlöndorffs Verfilmung.
Schlüsselwörter
Homo Faber, Max Frisch, Volker Schlöndorff, Ödipuskomplex, griechische Tragödie, Technik, Schicksal, Mythos, Psychoanalyse, Literaturverfilmung, Inzest, Vater-Tochter-Beziehung.
Häufig gestellte Fragen zu Max Frischs "Homo Faber"
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert Max Frischs Roman "Homo Faber" und dessen Verfilmung durch Volker Schlöndorff. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der mythologischen und psychologischen Aspekte, insbesondere des Ödipuskomplexes, und dem Vergleich zwischen Roman und Film. Die Arbeit untersucht die verwebebten mythologischen Motive antiker griechischer Tragödien im Kontext des Romans und konzentriert sich auf die Darstellung des Protagonisten Faber, sein Verhältnis zur Technik und seine Beziehungen zu den anderen Figuren.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: das Spannungsverhältnis zwischen Technik und Schicksal im Leben Fabers; die Parallelen zwischen "Homo Faber" und antiken griechischen Tragödien; die Rolle des Ödipuskomplexes in der Beziehung zwischen Faber, Sabeth und Hanna; die psychologische Struktur der Hauptfigur und ihre Konflikte; und der Vergleich der Darstellung mythologischer Motive im Roman und im Film.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: I. Einleitung: Einführung in die Thematik, Vorstellung von Roman und Verfilmung, Hervorhebung der Parallelen zu antiken Tragödien und Ankündigung der Schwerpunkte. II. Hauptteil: Detaillierte Analyse des Spannungsverhältnisses zwischen Technik und Schicksal, Parallelen zu antiken Tragödien (insbesondere Ödipus), Untersuchung der mythologischen Bezüge (Faber, Sabeth, Hanna), psychologische Aspekte (Ödipuskomplex), Vergleich Roman/Film. III. Fazit: (Der Inhalt des Fazits ist nicht explizit in der Zusammenfassung der Kapitel beschrieben).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Homo Faber, Max Frisch, Volker Schlöndorff, Ödipuskomplex, griechische Tragödie, Technik, Schicksal, Mythos, Psychoanalyse, Literaturverfilmung, Inzest, Vater-Tochter-Beziehung.
Welchen Zweck verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die mythologischen und psychologischen Merkmale in Max Frischs Roman "Homo Faber" und vergleicht diese mit der gleichnamigen Verfilmung. Sie analysiert die im Roman verwebebten mythologischen Motive antiker griechischer Tragödien, insbesondere den Ödipuskomplex, und konzentriert sich auf die Darstellung des Protagonisten Faber, sein Verhältnis zur Technik und seine Beziehungen zu den anderen Figuren.
Wie wird der Ödipuskomplex in der Arbeit behandelt?
Der Ödipuskomplex spielt eine zentrale Rolle in der Analyse. Die Arbeit untersucht seine Rolle in der Beziehung zwischen Faber, Sabeth und Hanna und analysiert dessen Einfluss auf die Handlung und die Charaktere sowohl im Roman als auch im Film.
Wie wird der Vergleich zwischen Roman und Verfilmung vorgenommen?
Die Arbeit vergleicht die Darstellung der mythologischen Motive im Roman und in Schlöndorffs Verfilmung, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Interpretation aufzuzeigen.
- Arbeit zitieren
- Ivonne Mnich (Autor:in), 2014, Mythologische und psychologische Merkmale in dem Roman „Homo Faber“ von Max Frisch und dem gleichnamigen Film von Volker Schlöndorff, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320123