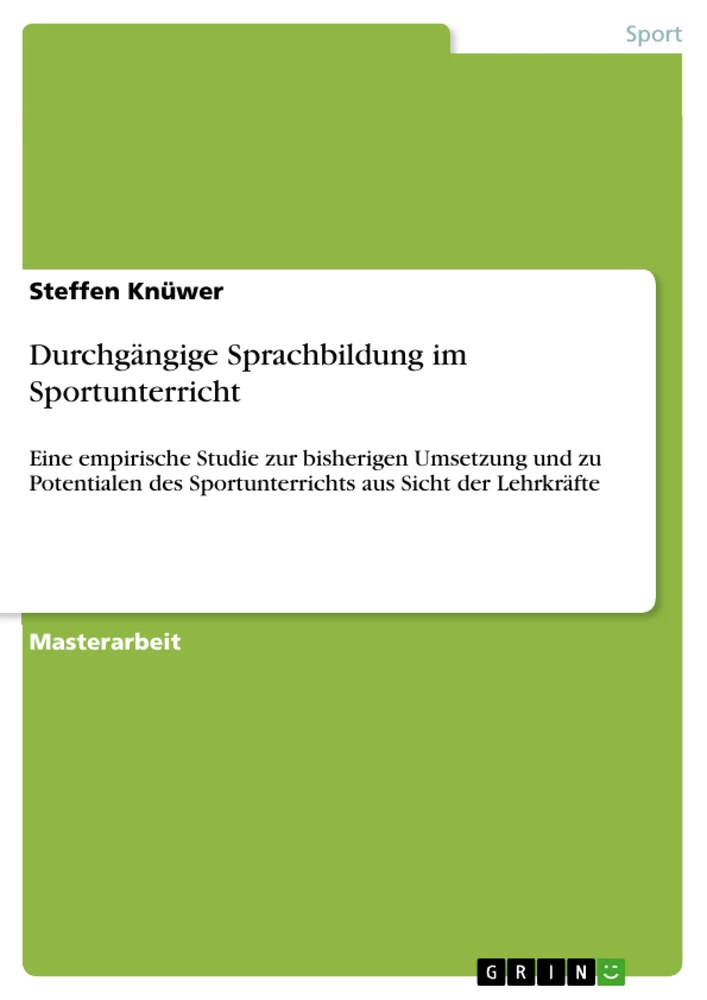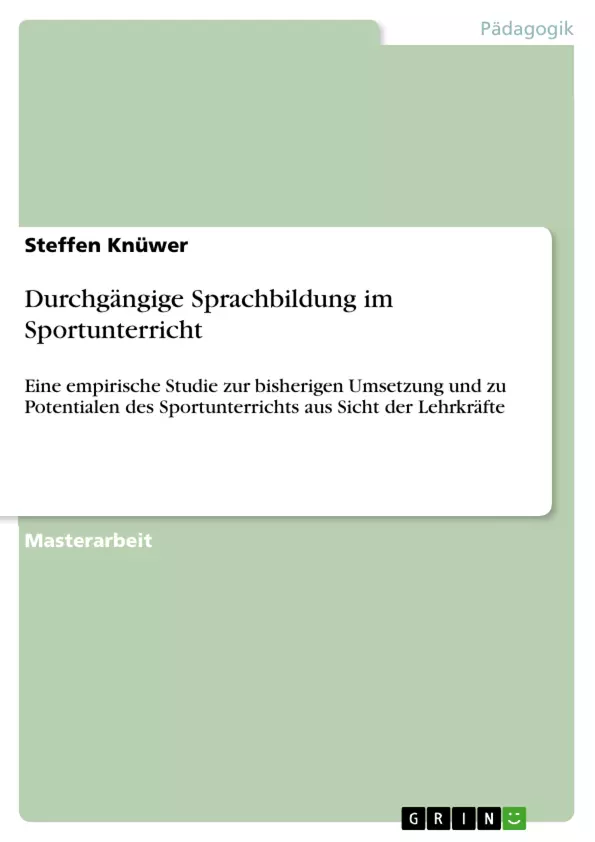Diese Abschlussarbeit beschäftigt sich mit dem Problem, dass Schülerinnen und Schüler mit einer anderen Erstsprache als dem Deutschen im deutschen Schulsystem häufig an dem sprachlichen Register der Bildungssprache scheitern. Bildungssprache bezeichnet kurz gesagt ein sprachliches System, welches sich durch eine spezifische Lexik, (Entlehnungen aus Fachsprachen) und eine komplexere grammatikalische Struktur, beispielsweise durch ein höheres Abstraktionsniveau, auszeichnet und speziell in der Schule vorkommt.
Dieses sprachliche Register divergiert darüber hinaus von Schulfach zu Schulfach. Aktuell stellt sich die Lage im Unterricht so da, dass die einzelnen Schulfächer „ihre Ausprägung“ der Bildungssprache nur implizit von den Schülerinnen und Schülern verlangen, statt sie explizit zu fördern. Schülerinnen und Schüler mit einem anderen sprachlichen Hintergrund stehen in diesem Fall vor einer sprachlichen Barriere, weil sie mangels sprachlicher Vorbilder oder Kontakt, Bildungssprache kaum bis gar nicht anwenden und verstehen können.
Um diesem Problem zu begegnen wurde das Konzept der „Durchgängigen Sprachbildung“ entwickelt, welche von den Schulfächern verlangt, dass sie sprachsensibel unterrichtet werden. Dass bedeutet, dass jedes Schulfach das von ihm verlangte sprachliche System auch vermittelt. Viele Unterrichtsfächer, gerade aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, haben schon Ideen entwickelt, wie dieses Konzept umsetzbar wäre. Der Sportunterricht hat sich diesem Problem bislang noch nicht angenommen, obwohl er durch die hohe sprachliche Aktivität der Schülerinnen und Schüler durchaus Potential bietet.
Diese Arbeit beschäftigt sich deshalb mit folgenden Fragen: Erstens, inwieweit ist der Sportunterricht aus seiner Beschaffenheit heraus sprachbildend und zweitens, welche weiteren Potentiale hält er bereit? Aus sportdidaktischer Perspektive soll zudem der Frage nachgegangen werden, welche Potentiale das Konzept der durchgängigen Sprachbildung für den Sportunterricht bereithält?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Durchgängige Sprachbildung
- Bildungssprache – Alltagssprache – Fachsprache
- Forschungsstand zum Zielspracherwerb
- Sprachbildung als Aufgabe aller Unterrichtsfächer das Konzept der durchgängigen Sprachbildung
- Qualitätsmerkmale für sprachbildenden Unterricht
- Sprachbildung im Sportunterricht
- Potentiale des Sportunterrichts für die Sprachbildung
- Fachsprache des Sportunterrichts
- Sprachliches Handeln im Sportunterricht
- Der Kernlehrplan Sport für die Hauptschulen in NRW
- Potentiale der Sprachbildung für den Sportunterricht
- Überfrachtung des Sportunterrichts
- Sprachbildung in den sportbezogenen Curricula
- Potentiale des Sportunterrichts für die Sprachbildung
- Zwischenbilanz und Fragestellung
- Untersuchungsdesign
- Problemzentriertes Interview zur Datenerhebung
- Stichprobe
- Interviewleitfaden
- Durchführung
- Datenaufbereitung
- Datenauswertung
- Ergebnisse
- Grundlegende Fragen
- Fachwortschatz Sport
- Einschätzung/ Messung Sprachstand
- Sprachsensibilität des Sportunterrichts
- Kommunikation im Unterricht
- Qualitätsmerkmale für sprachbildenden Unterricht
- Diskussion
- Kritische Reflexion des Vorgehens
- Schlussbetrachtung und Ausblick
- Glossar
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Potentiale des Sportunterrichts für die Sprachbildung von Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache. Im Fokus stehen die Frage, inwieweit der Sportunterricht durch seine Beschaffenheit sprachbildend ist und welche weiteren Potentiale er für die Förderung der Sprachkompetenz bereithält. Des Weiteren wird analysiert, welche Vorteile sich für den Sportunterricht aus der Einbeziehung von Sprachbildung ergeben.
- Das Konzept der durchgängigen Sprachbildung im Kontext des Sportunterrichts
- Potentiale des Sportunterrichts für die Sprachbildung
- Potentiale der Sprachbildung für den Sportunterricht
- Empirische Untersuchung der Sichtweise von Sportlehrkräften auf Sprachbildung im Sportunterricht
- Diskussion der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die Bedeutung von Bildung in der heutigen Gesellschaft. Sie stellt den Zusammenhang zwischen Bildung und Integration von Migranten her und betont die Rolle der Zielsprache im Bildungsprozess. Das Konzept der durchgängigen Sprachbildung wird als Antwort auf die Herausforderungen der Sprachförderung von Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache eingeführt.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Konzept der durchgängigen Sprachbildung. Es werden die verschiedenen Sprachkonzepte wie Bildungssprache, Alltagssprache und Fachsprache erläutert und deren Bedeutung für den schulischen Erfolg von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund hervorgehoben.
Kapitel 3 untersucht die Potentiale des Sportunterrichts für die Sprachbildung. Es werden die Fachsprache des Sportunterrichts, das sprachliche Handeln im Sportunterricht und der Kernlehrplan Sport für die Hauptschulen in NRW analysiert.
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Schlüsselwörter
Sprachbildung, Sportunterricht, Deutsch als Zweitsprache, Migrationshintergrund, Bildungssprache, Fachsprache, Qualitätsmerkmale, Sprachstand, Sprachsensibilität, Kommunikation, empirische Forschung.
- Quote paper
- Steffen Knüwer (Author), 2015, Durchgängige Sprachbildung im Sportunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320137