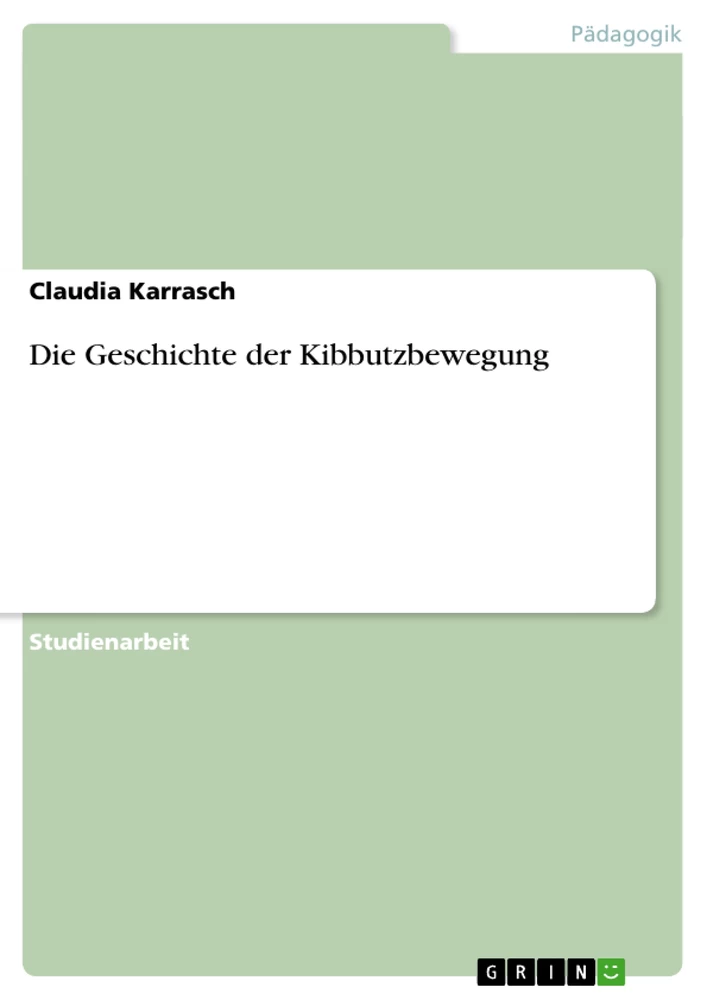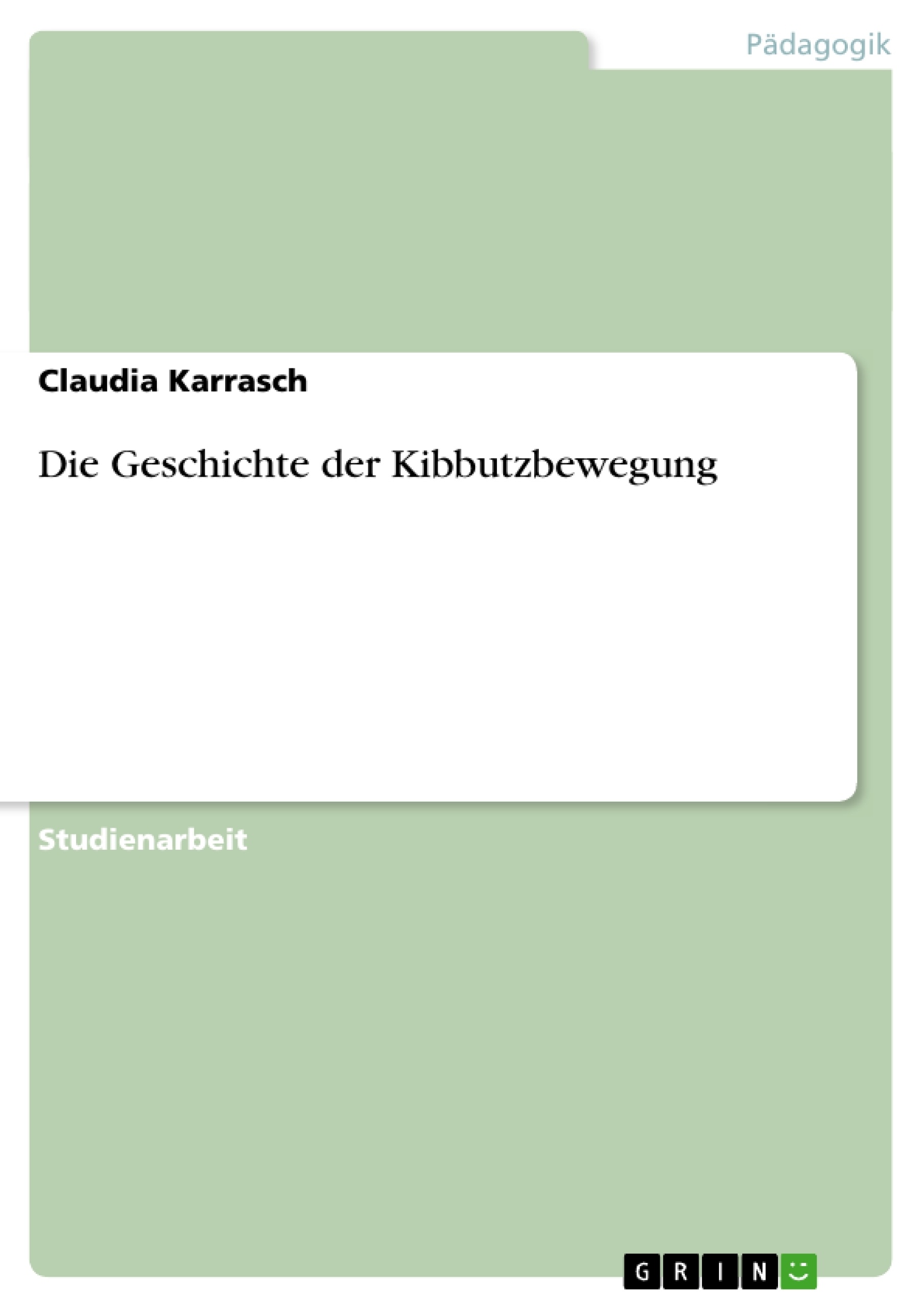Das bürgerliche Familienbild entstand im Bürgertum des 19. Jahrhunderts und war bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts das Leitbild für weite Bevölkerungskreise. Es beruht auf einer Aufteilung der Welt in einen außerhäuslichen Bereich des Geldverdienens und der sozialen Kontakte sowie in einen familialen Bereich der Liebe und Kindererziehung. Diese Aufteilung impliziert dementsprechend eine scharfe Trennung der Geschlechtsrollen. Die Frau ist für die Binnenbeziehung der Familie, die Haushaltsführung und die Kindererziehung verantwortlich, während der Mann seine Familie nach außen hin repräsentiert, als einziger im Erwerbsleben steht und somit das Familieneinkommen sichert. Mit der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung ist eine ausgeprägte Autoritätsstruktur verbunden.
Inhaltsverzeichnis
- Autorität und das bürgerliche Familienbild
- Die bürgerliche Familie
- Autorität
- Kibbutz
- Beschreibung Kibbutz
- Geschichte und Entstehung der Kibbutzbewegung
- Westeuropäische Einflüsse auf die Kibbutzbewegung
- Einfluss der (jüdischen) Jugendbewegung auf die Kibbutzbewegung
- Kollektiverziehung und Familienerziehung im Kindesalter
- Das Konzept der Kollektiverziehung
- Ziele und Prinzipien der Kollektiverziehung
- Institutionen der Kollektiverziehung
- Theoretische Grundlagen
- Das Konzept des „multiple mothering“
- Das erste emotionale Zentrum: Das Elternhaus
- Das zweite emotionale Zentrum: Das Kinderhaus
- „Informelle Erziehung“ und Sozialisation in der Adoleszenz (Jugendphase 13. – 18 Lebensjahr)
- Vor und Nachteile der kollektiven Erziehung und die sozialen Folgen
- Die Schule im Kibbutz
- Die Grundschule
- Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule - das erste Schuljahr im Kindergarten
- Die didaktische Konzeption des Grundschulunterrichts
- Spezifika der pädagogischen Arbeit in der Grundschule
- Die Sekundarstufe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Geschichte der Kibbutzbewegung, indem sie den Einfluss der bürgerlichen Familienstruktur auf die Entwicklung der Bewegung und die Implementierung eines kollektiven Erziehungssystems untersucht. Die Arbeit analysiert die theoretischen Grundlagen der Kollektiverziehung und die sozialen Folgen des Lebens in einer Kibbutzgemeinschaft.
- Das bürgerliche Familienbild und die Bedeutung der Autorität
- Die Entstehung und Entwicklung der Kibbutzbewegung
- Das Konzept der Kollektiverziehung im Kibbutz
- Sozialisationsprozesse in der Kibbutzgemeinschaft
- Vor- und Nachteile der kollektiven Erziehung
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel untersucht das bürgerliche Familienbild und die Bedeutung der Autorität in der Gesellschaft des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Es werden die geschlechtsspezifischen Rollen und die repressive Erziehungstechnik des bürgerlichen Familienmodells diskutiert.
- Das zweite Kapitel liefert eine Einführung in das Konzept der Kibbutzbewegung und beschreibt ihre Entwicklung im Kontext des jüdischen Zionismus und der frühen Einwanderung nach Palästina.
- Das dritte Kapitel analysiert die Grundprinzipien der Kollektiverziehung im Kibbutz. Es befasst sich mit den Zielen und Prinzipien der Kollektiverziehung, den einzelnen Institutionen und den theoretischen Grundlagen.
- Das vierte Kapitel erforscht den Einfluss der Kollektiverziehung auf die Sozialisation der Kinder und Jugendlichen im Kibbutz. Es werden die Entwicklungsphasen des Kindes und die sozialen Beziehungen in der Gemeinschaft betrachtet.
- Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit den Vor- und Nachteilen der kollektiven Erziehung und den sozialen Folgen für die Individuen und die Kibbutzgemeinschaft.
- Das sechste Kapitel untersucht das Schulsystem im Kibbutz und bespricht die spezifische didaktische Konzeption und die pädagogische Arbeit in den verschiedenen Schulformen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Familienbildes in der deutschen Gesellschaft und die Vergleichbarkeit mit den soziokulturellen Bedingungen der Kibbutzbewegung. Zentrale Begriffe sind Autorität, Kollektiverziehung, Sozialisation, Familienerziehung, Kibbutz, jüdische Jugendbewegung, Westeuropäische Einflüsse und die Entwicklung der Kibbutzgemeinschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der Kollektiverziehung im Kibbutz?
Ziel war die Überwindung des bürgerlichen Familienideals und der repressiven Autoritätsstrukturen zugunsten einer gemeinschaftlichen Erziehung zur Gleichheit.
Was versteht man unter „multiple mothering“?
Es beschreibt ein Konzept, bei dem das Kind neben der biologischen Mutter weitere Bezugspersonen (Erzieherinnen/Metaplot) im Kinderhaus hat.
Wie unterschied sich das Leben der Kinder im Kibbutz von bürgerlichen Familien?
Kinder lebten und schliefen meist in altersgleichen Gruppen in Kinderhäusern, während das Elternhaus als emotionales Zentrum für die Freizeit diente.
Welchen Einfluss hatte die jüdische Jugendbewegung auf den Kibbutz?
Die Jugendbewegungen brachten Ideale wie Naturverbundenheit, Autonomie und den Wunsch nach einer neuen, gerechteren Gesellschaftsform in die Kibbutzbewegung ein.
Gibt es Schulen direkt im Kibbutz?
Ja, die Kibbutzim entwickelten eigene Schulsysteme mit spezifischen didaktischen Konzepten, die Arbeit und Lernen oft miteinander verknüpften.
- Arbeit zitieren
- Claudia Karrasch (Autor:in), 2003, Die Geschichte der Kibbutzbewegung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32017