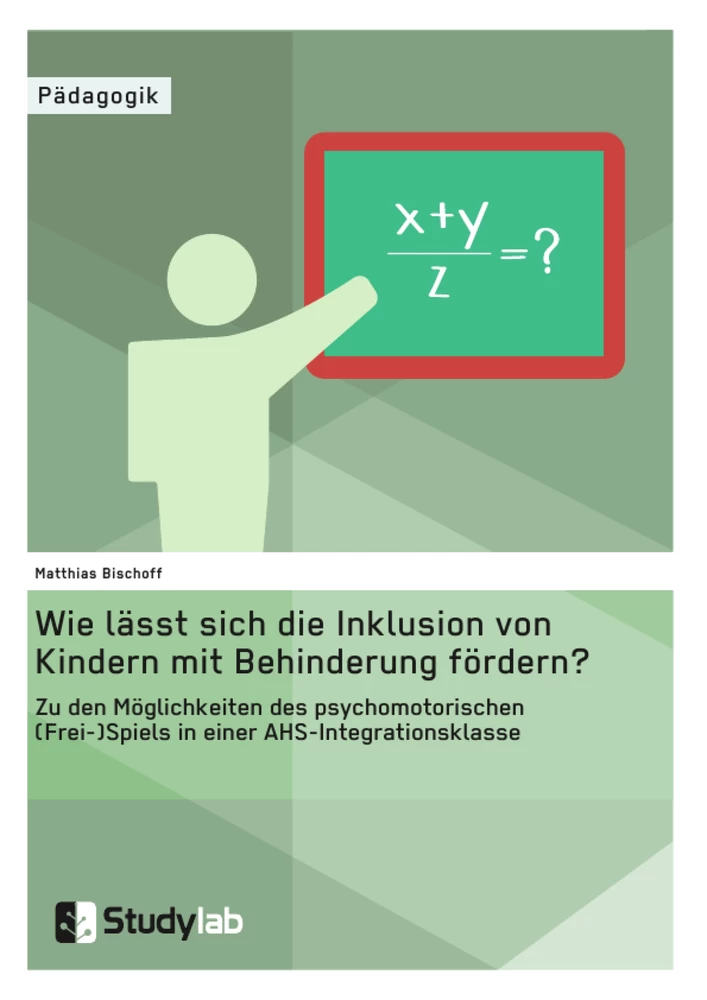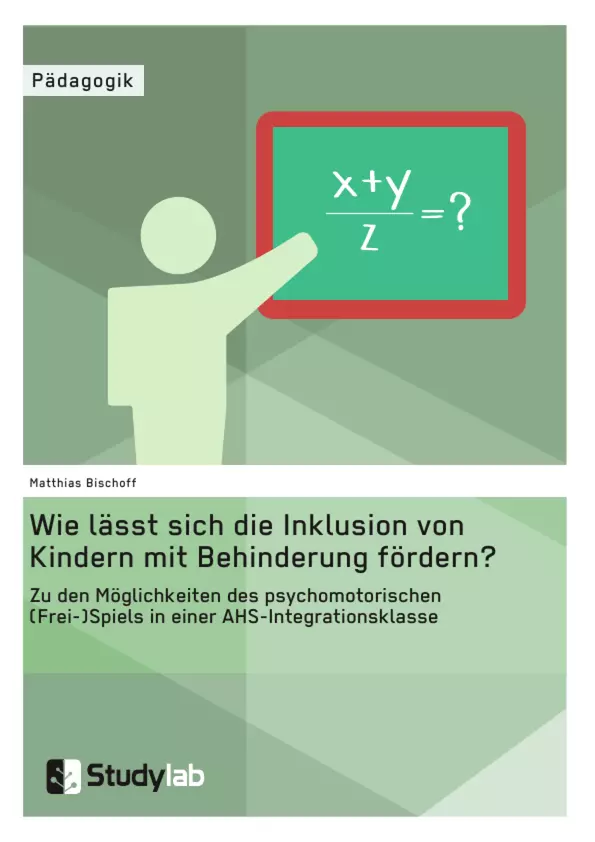Um österreichischen Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und/oder sonderpädagogischem Förderbedarf den Zugang in die Gesellschaft zu erleichtern, wurden vielerorts Integrationsklassen geschaffen, in denen sie gemeinsam mit nicht behinderten Schülerinnen und Schülern unterrichtet werden. Pädagogisches Hauptziel ist hierbei der Aufbau von gegenseitiger Wertschätzung, Verständnis und Respekt. Doch welche Methoden stehen Lehrenden im inklusiven Unterricht zur Verfügung, um diese Entwicklung zu fördern?
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem psychomotorischen (Frei-)Spiel im gemeinsamen „Bewegung und Sport“-Unterricht einer AHS-Integrationsklasse. Der Autor verdeutlicht, wie das freie Spiel als verbindende und interaktionsfördernde Komponente lehrplanübergreifend und altersadäquat eingesetzt werden kann. Auch zeigt er, auf welche Weise Psychomotorik als kindzentrierte Entwicklungsförderung in der frühen Adoleszenz Anwendung findet.
Neben theoretischer Auseinandersetzung mit entwicklungspsychologischen Grundlagen werden die unterschiedlichen Dynamiken des Spiels als solche, mit Schwerpunkt der Rolle des Spiels und des Spielraums in der Psychomotorik analysiert. Dem Lehrplan der Allgemeinbildenden Höheren Schule im Gegenstand Bewegung und Sport wird der Lehrplan der Schwerstbehindertenschule gegenüber gestellt und daraus verbindende Elemente bezüglich des Einsatzes des (freien) Spiels im Sinne eines lehrplanunabhängigen, interaktiven Miteinanders definiert.
Schlussfolgerungen für die Praxis sowie exemplarische Beispiele für einen möglichen Einsatz des Psychomotorischen (Frei-)Spiels im gemeinsamen Turnunterricht einer Sekundarstufen-Integrationsklasse ergänzen die vorliegende Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1. Einleitung
- 2. Begriffserklärungen
- 2.1 Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS)
- 2.2 Sonderpädagogisches Zentrum (SPZ)
- 2.3 Sonderpädagogischer Förderbedarf (SPF)
- 2.4 Integration in der Allgemeinbildenden Höheren Schule
- 2.5 Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler einer Integrationsklasse
- 2.6 Gesetzliche Grundlagen der Sekundarstufenintegration
- 2.7 Spezifika des Teamteachings in der Allgemeinbildenden Höheren Schule
- 2.8 Spezifika Teamteaching in der Psychomotorik
- 2.9 Psychomotorik
- 2.9.1 Ursprünge der Psychomotorik
- 2.9.2 Begriff Psychomotorik
- 2.10 Körperbehinderung
- 2.10.1 Allgemein
- 2.10.2 Einteilung von Behinderungen
- 2.10.3 Frühkindliche Hirnschädigungen
- 2.11 Geistige Behinderung
- 2.11.1 Definition
- 3. Hypothese
- 4. Psychomotorik in der Entwicklungsstufe der 10-14 Jährigen
- 4.1 Psychomotorische Förderung
- 4.1.1 Die Entwicklung der Psychomotorik von der Übungsbehandlung zur ganzheitlichen Entwicklungsförderung
- 4.1.2 Psychomotorik und ihr handlungsorientierter Ansatz
- 4.1.3 Psychomotorik versus sensorische Integrationsbehandlung
- 4.1.4 Psychomotorik – kindzentrierte Entwicklungsförderung
- 4.1.5 Psychomotorik – ein verstehender Zugang
- 4.1.6 Psychomotorik – ein systemisch-konstruktivistischer Zugang
- 4.2 Entwicklungspsychologie
- 4.2.1 Grundlagen
- 4.2.2 Wissenschaftliche Anfänge der Entwicklungspsychologie
- 4.2.3 Der psychoanalytische Ansatz
- 4.2.4 Freuds Theorie der psychosexuellen Entwicklung
- 4.2.5 Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung
- 4.2.6 Piagets Konstruktivistische Entwicklungstheorie
- 4.2.7 Wygotskis soziokulturelle Entwicklungstheorie
- 4.2.8 Behaviorismus & soziale Lerntheorie
- 4.1 Psychomotorische Förderung
- 5. Das Spiel
- 5.1 Allgemeines
- 5.1.1 Das Spiel als grundlegende Persönlichkeitsentwicklung des Menschen
- 5.1.2 Was bedeutet Spiel für das Kind?
- 5.2 Klassifizierung der Spielerscheinungen und Erklärungsversuche anhand verschiedener Theorien
- 5.2.1 Spiel aus dem Blickwinkel der „Energy Theories“
- 5.2.2 Spiel als Vorübung für das Leben – Karl Groos als Vertreter der „Functional Theories“
- 5.2.3 Spiel aus dem Blickwinkel der Funktionslusttheorie – Karl Bühler
- 5.2.4 Spiel als Aktivitätsform der kognitiven Entwicklung – Jean Piaget als Vertreter des,,psychological approach“
- 5.2.5 Spiel und psychodynamischen Aspekte – Sigmund Freud, Alfred Adler, Frederik Buytendijk, Hans Zulliger
- 5.2.6 Spiel aus der motivationspsychologischen Betrachtung – Heinz Heckhausen
- 5.3 Charakteristika des (kindlichen) Spielens
- 5.3.1 Gegenstandsbezug und Bewegung im (kindlichen) Spiel
- 5.3.2 Der Faktor Zeit im (kindlichen) Spiel
- 5.3.3 Der Faktor Umwelt im (kindlichen) Spiel
- 5.3.4 Die Dynamik im (kindlichen) Spiel
- 5.3.5 Der Spielraum als Voraussetzung des (kindlichen) Spiels
- 5.3.6 Experimentieren im (kindlichen) Spiel
- 5.3.7 Aufbau einer Wirklichkeit durch Spielen
- 5.1 Allgemeines
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Inklusion von Kindern mit Behinderung im Bildungssystem. Sie analysiert die Möglichkeiten des psychomotorischen (Frei-)Spiels in einer AHS-Integrationsklasse und untersucht, wie dieses Spielformat zur Förderung der Inklusion beitragen kann.
- Die Bedeutung von Psychomotorik für die Entwicklung von Kindern mit Behinderung
- Die Rolle des Spiels in der Inklusion
- Die Herausforderungen und Chancen der Integration von Kindern mit Behinderung in der AHS
- Die Gestaltung von inklusiven Lernumgebungen im Kontext der Psychomotorik
- Die Bedeutung von Teamarbeit und Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Sonderpädagogischen Fachkräften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und skizziert den Forschungsrahmen. Kapitel 2 erläutert die wichtigsten Begrifflichkeiten, die für die Arbeit relevant sind, wie z.B. AHS, SPZ, SPF, Integration, Teamteaching und Psychomotorik. Kapitel 3 formuliert die Hypothese der Arbeit. Kapitel 4 beleuchtet die Bedeutung der Psychomotorik in der Entwicklungsphase der 10-14 Jährigen und diskutiert verschiedene Ansätze der psychomotorischen Förderung. In Kapitel 5 wird das Spiel als grundlegende Persönlichkeitsentwicklung des Menschen betrachtet und verschiedene Spieltheorien vorgestellt. Die Kapitel 6 bis 8 (nicht in dieser Vorschau enthalten) untersuchen die Anwendung des psychomotorischen (Frei-)Spiels in der AHS-Integrationsklasse und analysieren dessen Einfluss auf die Inklusion von Kindern mit Behinderung.
Schlüsselwörter
Inklusion, Behinderung, Psychomotorik, (Frei-)Spiel, AHS-Integrationsklasse, Teamteaching, Entwicklungspsychologie, Spieltheorien, Inklusives Lernen, Förderung, Teamarbeit.
- Quote paper
- Matthias Bischoff (Author), 2015, Wie lässt sich die Inklusion von Kindern mit Behinderung fördern? Zu den Möglichkeiten des psychomotorischen (Frei-)Spiels in einer AHS-Integrationsklasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320175