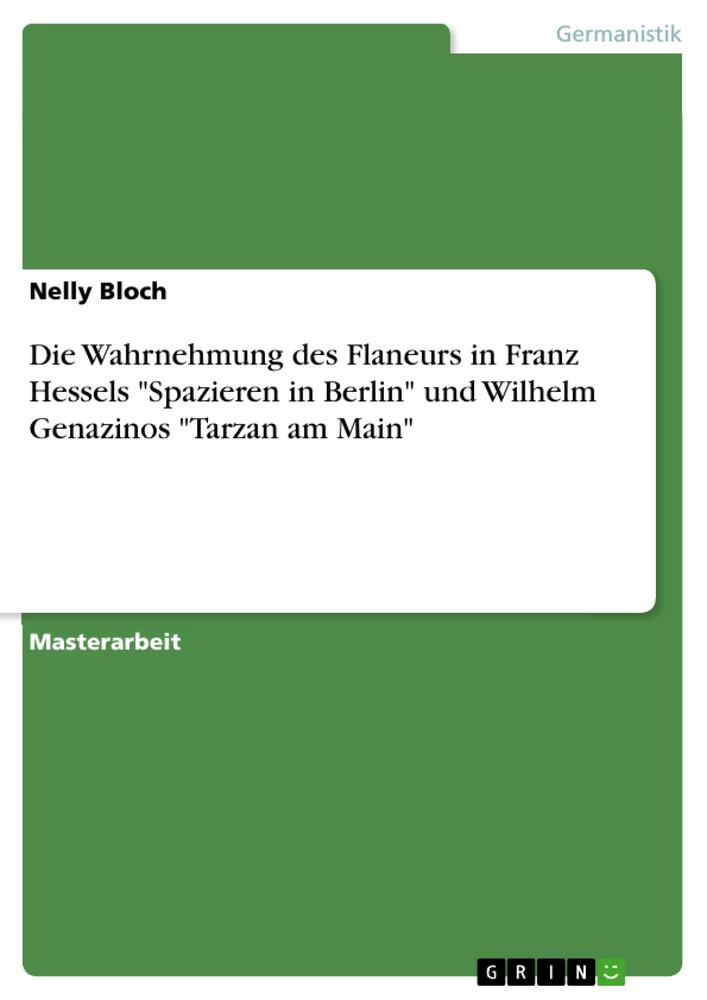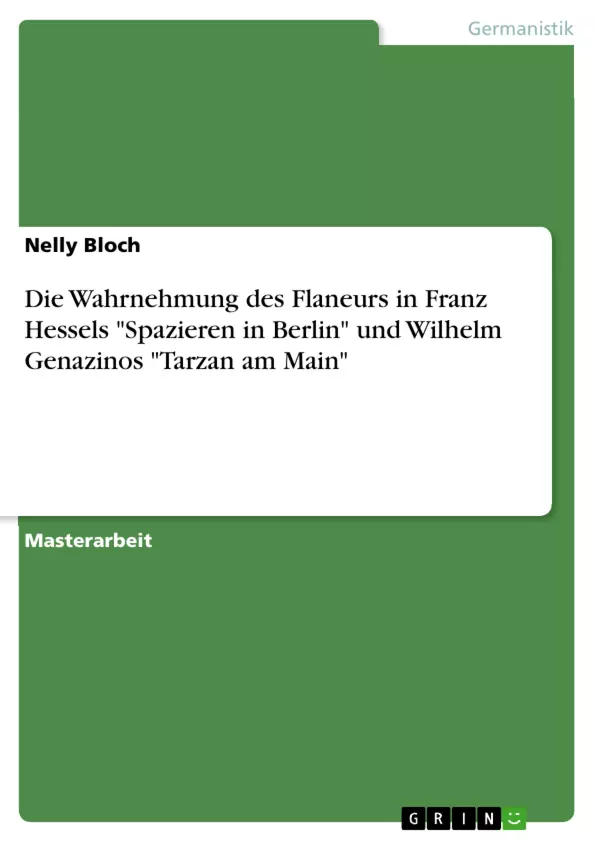„Langsam durch die belebten Straßen zu gehen, ist ein besonderes Vergnügen. Man wird überspielt von der Eile der anderen, es ist ein Bad in der Brandung“ (Hessel 1984: 7).
So beschreibt Franz Hessel seine Flanerie durch Berliner Straßen, die er durch die Menschenmenge genießt. Seit Mitte der achtziger Jahre ist eine Textform wiederentdeckt worden, die den Spaziergang als Medium moderner Großstadterfahrung betrachtet. Es scheint eine Berliner Spezialität zu sein, wie es Sprengel richtig feststellt. Sogar Paris, die Geburtsstätte der Flanerie, hat keine vergleichbare Tradition. Bis heute wird Berlin die Aura der bekannten „Goldenen Zwanziger“ nachgesagt, sodass Literaturhistoriker und Verleger sich den über die damalige bewegte Weltstadt berichtenden Berlin-Flaneuren widmen.
Zu finden war die literarische Flanerie als „kleine Form“ in den Feuilletons der überregionalen Presse. So erfahren die Leser, wie die Berliner ihre Kindheit und Jugend in der jungen Reichshauptstadt verbrachten und empfanden. Außerdem erzählten Nicht-Einheimische von ihren ersten Erfahrungen mit Berlin und verglichen diese Stadt mit ihren Herkunftsorten.
Auch Korrespondenten der Frankfurter und süddeutscher Zeitungen zeigten in ihren Berichten die Begegnung mit der preußischen Metropole.
Viele Berlin-Flaneure werden heute wiederentdeckt, ihre Texte werden gesammelt und publiziert. Erste Doktorarbeiten erschienen ab den achtziger Jahren und setzten sich somit
wissenschaftlich mit der Flanerie als literarischer Form einer Stadterfahrung auseinander.
Nicht zuletzt hat die kleine Form die damaligen Berlin-Romane wie etwa von Hermann oder Döblin beeinflusst.
Wenn wir heute an das Wort ‚flanieren‘ denken, dann verbinden wir damit oft einen gemütlichen Stadtbummel in der Stadt. Schon der französische Literat Louis-Sébastien Mercier thematisierte in seinem Buch „Tableau de Paris“ (1781), einer Sammlung von kurzen Prosastücken, Bräuche, Verhaltensarten, Gegenstände und Örtlichkeiten, die dem freien Autor während seiner täglichen Spaziergänge in Paris aufgefallen waren.
Doch der aus dem Französischen stammende Begriff hatte früher eine weitere Bedeutung inne, und zwar die des Flanierens als Lebenseinstellung. Dazu gehört der passionierte Autor Franz Hessel, der als Liebhaber der Metropolen Berlin und Paris gilt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Literarische Flanerie im 19. Jahrhundert
- 2.1 Was ist ein Flaneur?
- 2.2 Das Feuilleton: Inhalt und Form der Flaneurtexte
- 2.3 Vorbild: Charles Baudelaire
- 3 Berliner Flaneure bis 1933
- 3.1 Benjamins Einbahnstraße und Passagen-Werk
- 3.2 Kracauers melancholische Flanerie
- 3.3 Walsers experimentelles Flanieren
- 3.4 Das Ende der literarischen Flanerie nach 1933
- 4 Flaneure ab 1980 in Deutschland
- 4.1 Tendenzen des urbanen Müßiggangs
- 4.2 Urbane Müßiggänger in Berlin
- 5 Die Wahrnehmung der Flaneure in Berlin und Frankfurt
- 5.1 Reales Flanieren: Tiergarten
- 5.2 Reales Flanieren: Am Stadtrand
- 5.3 Voyeuristisches Flanieren: Der Verdächtige
- 5.4 Voyeuristisches Flanieren: Von meinem Arbeitszimmer aus
- 5.5 Flanieren als Kindheitserinnerung: Die Paläste der Tiere
- 5.6 Flanieren als Kindheitserinnerung: Ein Trost während meines Schulwegs
- 5.7 Gedankliches Flanieren ohne einen Ich-Erzähler: Der Pendler hat inzwischen eine Geliebte
- 6 Die Wahrnehmung des Flaneurs am Beispiel von Franz Hessels Spazieren in Berlin und Wilhelm Genazinos Tarzan am Main
- 6.1 Reales Flanieren: Der Vergleich
- 6.2 Voyeuristisches Flanieren: Der Vergleich
- 6.3 Flanieren als Kindheitserinnerung: Der Vergleich
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit setzt sich zum Ziel, die Wahrnehmung des Flaneurs anhand der Werke „Spazieren in Berlin“ von Franz Hessel und „Tarzan am Main“ von Wilhelm Genazino zu vergleichen. Dabei werden die unterschiedlichen Formen des Flanierens untersucht und die Wahrnehmungsobjekte, die Sprache, die Melancholie und Entfremdungsgefühle der beiden Flaneure gegenübergestellt.
- Die Entwicklung der literarischen Flanerie im 19. und 20. Jahrhundert
- Die unterschiedlichen Formen des Flanierens: Reales Flanieren, Voyeuristisches Flanieren, Flanieren als Kindheitserinnerung, Gedankliches Flanieren
- Die Wahrnehmungsobjekte der Flaneure: Stadtlandschaft, Menschen, Alltagsleben
- Die sprachliche Gestaltung der Flaneurtexte: Sprache, Stil, Metaphern
- Die Bedeutung von Melancholie und Entfremdungsgefühlen in der Flanerie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der literarischen Flanerie ein und stellt die beiden zu vergleichenden Autoren Franz Hessel und Wilhelm Genazino sowie die Forschungsfrage vor. Kapitel 2 befasst sich mit der historischen Entwicklung der Flanerie im 19. Jahrhundert, wobei die Rolle von Charles Baudelaire als Vorbild für die literarische Flanerie hervorgehoben wird. Kapitel 3 widmet sich den Berliner Flaneuren bis 1933, darunter Walter Benjamin, Siegfried Kracauer und Robert Walser. Kapitel 4 gibt einen Überblick über Flaneure ab 1980 in Deutschland. Im fünften Kapitel werden die Wahrnehmung von Hessel und Genazino anhand einzelner Episoden aus deren Flaneurwerken vorgestellt. Das sechste Kapitel vergleicht die drei Flanierarten und die Wahrnehmung der urbanen Müßiggänger hinsichtlich besonderer Merkmale, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Flanerie, urbaner Müßiggang, Wahrnehmung, Stadtlandschaft, Menschen, Alltagsleben, Sprache, Stil, Metaphern, Melancholie, Entfremdungsgefühle, Franz Hessel, Wilhelm Genazino, Spazieren in Berlin, Tarzan am Main, Charles Baudelaire, Walter Benjamin, Siegfried Kracauer, Robert Walser.
Häufig gestellte Fragen
Was charakterisiert einen 'Flaneur'?
Ein Flaneur ist ein urbaner Müßiggänger, der langsam durch die Straßen geht, das Alltagsleben beobachtet und das Flanieren als Lebenseinstellung begreift.
Welche Autoren werden in der Arbeit primär verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Wahrnehmung des Flaneurs in Franz Hessels „Spazieren in Berlin“ und Wilhelm Genazinos „Tarzan am Main“.
In welchem Medium wurde die literarische Flanerie oft veröffentlicht?
Die literarische Flanerie fand ihren Platz oft als „kleine Form“ in den Feuilletons der überregionalen Presse.
Welche Rolle spielt Charles Baudelaire für die Flanerie?
Baudelaire gilt als das große Vorbild der literarischen Flanerie und prägte das Bild des Beobachters in der modernen Großstadt.
Was sind die verschiedenen Formen des Flanierens?
Die Arbeit unterscheidet zwischen realem, voyeuristischem, gedanklichem Flanieren sowie dem Flanieren als Kindheitserinnerung.
Warum ist Berlin für die Geschichte der Flanerie so bedeutend?
Berlin entwickelte in den „Goldenen Zwanzigern“ eine eigene Tradition der Flanerie, die bis heute Literaturhistoriker und Verleger fasziniert.
- Arbeit zitieren
- Nelly Bloch (Autor:in), 2015, Die Wahrnehmung des Flaneurs in Franz Hessels "Spazieren in Berlin" und Wilhelm Genazinos "Tarzan am Main", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320256