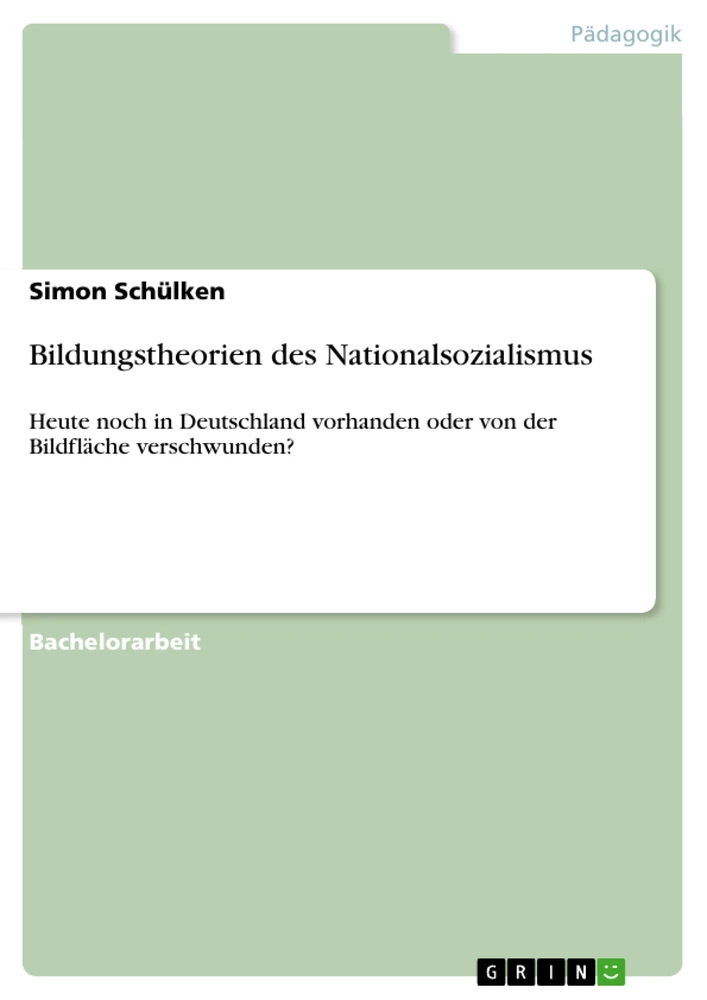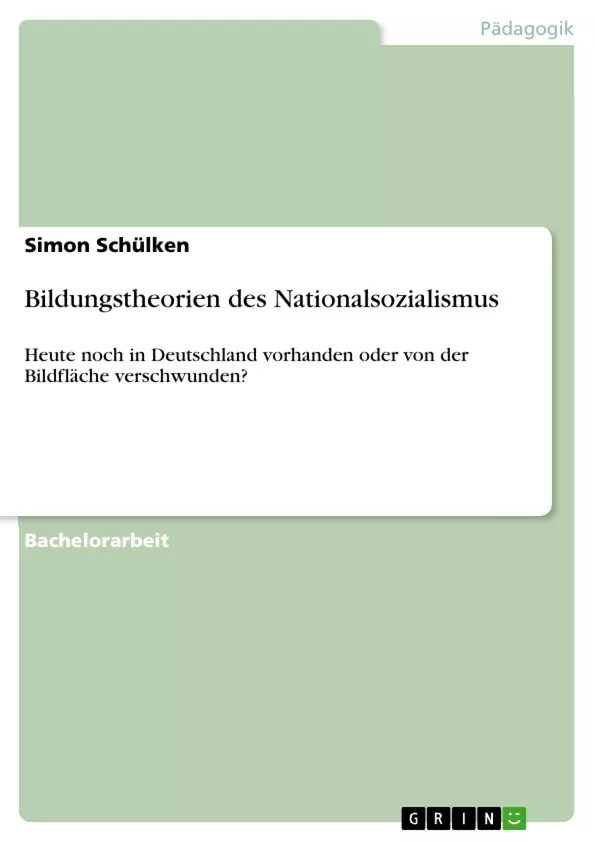Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit den nationalsozialistischen Bildungstheorien in der Zeit von 1933-1945, um anschließend Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu heutigen Bildungstheorien herauszuarbeiten. Die Zeit von 1933-1945 ist von religiöser und politischer Verfolgung und von Gewalt und Tod geprägt. Die Nationalsozialisten stellen in dieser Zeit die Regierung in einem Staat mit Führer und Reichskanzler Adolf Hitler an der Spitze. Mit der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 endete die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten.
Schon 1921 verhalf Adolf Hitler der NSDAP zu ihrem allmählichen Aufstieg und baute sie in der Folgezeit zunehmend aus. Hierzu gehörten z.B. die Aufstellung der SS und die Bildung der HJ. Die NSDAP konnte sich allerdings zunächst nicht wirklich durchsetzen. Die 1929 aufgekommene Weltwirtschaftskrise, ausgelöst durch den sogenannten Schwarzen Freitag am 25. Oktober 1929, war eine der wichtigsten Bedingungen für den Aufstieg der Nationalsozialisten. Die mit der Weltwirtschaftskrise einhergehende Arbeitslosigkeit begründete einen massenhaften Andrang neuer Parteigenossen innerhalb der NSDAP. Mit Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30.01.1933 gelang es den Nationalsozialisten, die Macht über das Deutsche Reich an sich zu reißen.
Um die Bildungstheorien der Nationalsozialisten näher beleuchten zu können, werde ich mit der vor der Zeit des Nationalsozialismus angewandten Bildungstheorie der Reformpädagogik in der Weimarer Republik beginnen. Anschließend beleuchte ich den Übergang der Weimarer Republik zum Deutschen Reich und zum nationalsozialistischen Staat durch die Machtergreifung Hitlers. Um die Bildungstheorien der Nationalsozialisten besser nachvollziehen zu können, gehe ich auf die verschiedenen vorherrschenden Menschenbilder während dieser Zeit und die allgemeine Erziehung ein. Dieses Kapitel wird neben den allgemeinen Schuländerungen die Formationserziehung der HJ beleuchten und sich mit den sog. Eliteschulen des NS-Regimes beschäftigen. Danach werde ich die Evolutionstheorie des Sozialdarwinismus, dessen Hitler ein großer Vertreter war, vorstellen. Anschließend stelle ich das heutige Bildungssystem vor und gehe auf die heute angewandten Bildungstheorien ein, um abschließend Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb der Bildungstheorien und des Schulwesens herauszuarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Reformpädagogik in der Weimarer Republik
- 2.1 Arbeitsschulen
- 2.2 Landerziehungsheime
- 2.3 Waldorfschule
- 3.0 Machtergreifung Hitlers im Jahre 1933
- 4.0 Menschenbild im Nationalsozialismus
- 4.1 Leitbilder der neuen Pädagogik ab 1933
- 4.1.1 Körper, Charakter und Geist
- 4.1.2 Gleichschaltung, Gemeinschaftsgefühl und Unterordnung
- 4.1.3 Rassegedanke
- 4.2 Ideologie der Erziehung
- 5.0 Erziehung
- 5.1 Formationserziehung am Beispiel der Hitler-Jugend
- 5.2 Allgemeine Änderungen im Schulwesen
- 5.3 Nationalpolitische Erziehungsanstalten und Adolf-Hitler-Schulen im Vergleich
- 5.3.1 Nationalpolitische Erziehungsanstalten
- 5.3.2 Adolf-Hitler-Schulen
- 5.4 Generelle Wichtigkeit der Jugend
- 6.0 Bildungstheorie im Nationalsozialismus
- 7.0 Heutiges Schulsystem
- 8.0 Bildungstheorien heutzutage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Analyse der Bildungstheorien im Nationalsozialismus und deren möglicher Präsenz im heutigen deutschen Schulsystem. Die Arbeit untersucht die Entstehung der nationalsozialistischen Bildungsideologie im Kontext der Reformpädagogik der Weimarer Republik sowie die konkreten Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis.
- Die Transformation der Bildungsideale von der Weimarer Republik zum Nationalsozialismus.
- Die Entwicklung des Menschenbildes im Nationalsozialismus und seine Auswirkung auf die Bildungstheorie.
- Die konkrete Umsetzung von nationalsozialistischen Bildungsidealen in der Praxis, insbesondere in der Hitlerjugend und den Nationalpolitischen Erziehungsanstalten.
- Die Relevanz der nationalsozialistischen Bildungstheorie für das heutige deutsche Schulsystem.
- Die Analyse aktueller Bildungstheorien im Kontext der historischen Entwicklungen des Nationalsozialismus.
Zusammenfassung der Kapitel
- 1.0 Einleitung: Einleitung in die Thematik der Bildungstheorien im Nationalsozialismus und deren aktuelle Relevanz.
- 2.0 Reformpädagogik in der Weimarer Republik: Überblick über die wichtigsten Reformpädagogischen Strömungen der Weimarer Republik und deren Einfluss auf die Bildungsideale der Zeit.
- 3.0 Machtergreifung Hitlers im Jahre 1933: Analyse der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen nach der Machtergreifung Hitlers und deren Auswirkungen auf das Bildungssystem.
- 4.0 Menschenbild im Nationalsozialismus: Diskussion des Menschenbildes im Nationalsozialismus und dessen Verbindung zur Bildungstheorie.
- 5.0 Erziehung: Analyse der nationalsozialistischen Erziehungsideale und ihrer Umsetzung in der Praxis, insbesondere in der Hitlerjugend und den Nationalpolitischen Erziehungsanstalten.
- 6.0 Bildungstheorie im Nationalsozialismus: Zusammenfassung der wichtigsten Bildungstheorien des Nationalsozialismus und deren Einfluss auf das Schulsystem.
- 7.0 Heutiges Schulsystem: Analyse des heutigen deutschen Schulsystems im Kontext der historischen Entwicklungen des Nationalsozialismus.
- 8.0 Bildungstheorien heutzutage: Überblick über aktuelle Bildungstheorien und deren Verhältnis zu den historischen Entwicklungen des Nationalsozialismus.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Bildungstheorien im Nationalsozialismus, insbesondere in Bezug auf die Transformation von Reformpädagogik, die Entwicklung des Menschenbildes, die konkrete Umsetzung von Bildungsidealen in der Hitlerjugend und den Nationalpolitischen Erziehungsanstalten, sowie die Relevanz für das heutige deutsche Schulsystem und die aktuellen Bildungstheorien. Die Arbeit untersucht die Konzepte von Gleichschaltung, Gemeinschaftsgefühl, Unterordnung, Rassegedanke und Formationserziehung.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterschied sich die NS-Erziehung von der Reformpädagogik?
Während die Reformpädagogik der Weimarer Republik das Kind ins Zentrum stellte, fokussierte die NS-Ideologie auf Gleichschaltung, Rassegedanken und die Unterordnung unter die Volksgemeinschaft.
Was waren die Leitbilder der Pädagogik ab 1933?
Die Erziehung sollte primär den Körper stählen, den Charakter im Sinne des Regimes formen und den Geist der Ideologie von Rasse und Gemeinschaft unterwerfen.
Was war die Aufgabe der Hitler-Jugend (HJ) im Bildungssystem?
Die HJ diente der „Formationserziehung“ außerhalb der Schule, um Jugendliche frühzeitig ideologisch zu indoktrinieren und auf ihre Rolle im NS-Staat vorzubereiten.
Was waren Nationalpolitische Erziehungsanstalten (Napola)?
Dies waren Eliteschulen des NS-Regimes, die darauf ausgelegt waren, den künftigen Führungsnachwuchs für Staat und Partei unter strenger Disziplin auszubilden.
Welche Rolle spielte der Sozialdarwinismus in der Bildungstheorie?
Hitler war ein Vertreter des Sozialdarwinismus, was dazu führte, dass Bildung als ein Kampf ums Dasein verstanden wurde, in dem nur die „Starken“ und „Rassereinen“ gefördert werden sollten.
- Arbeit zitieren
- Simon Schülken (Autor:in), 2015, Bildungstheorien des Nationalsozialismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320293