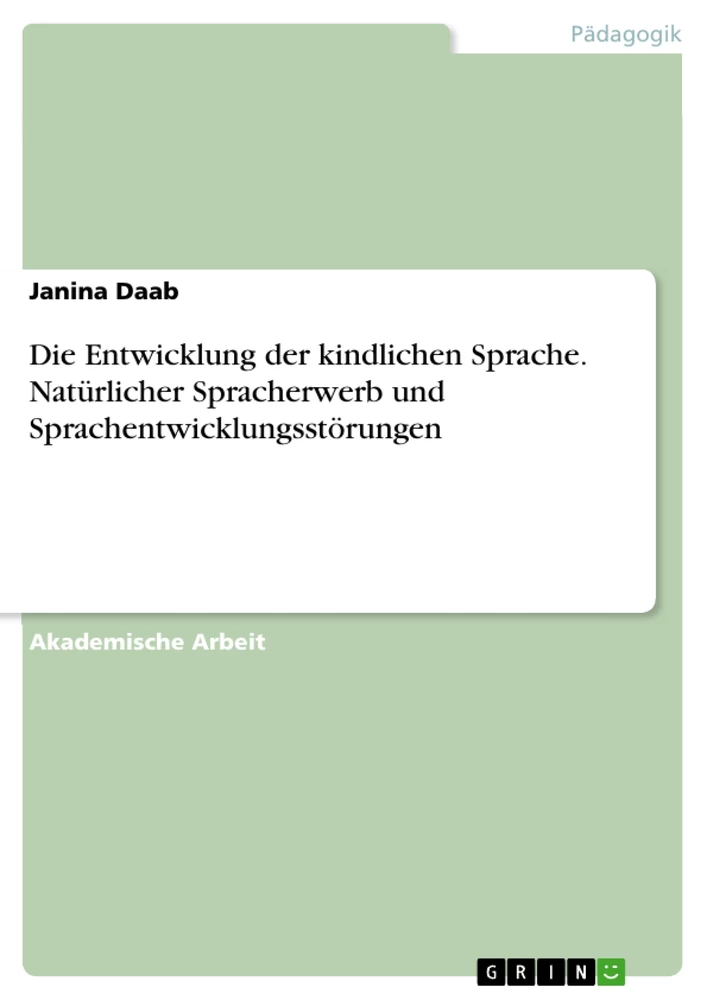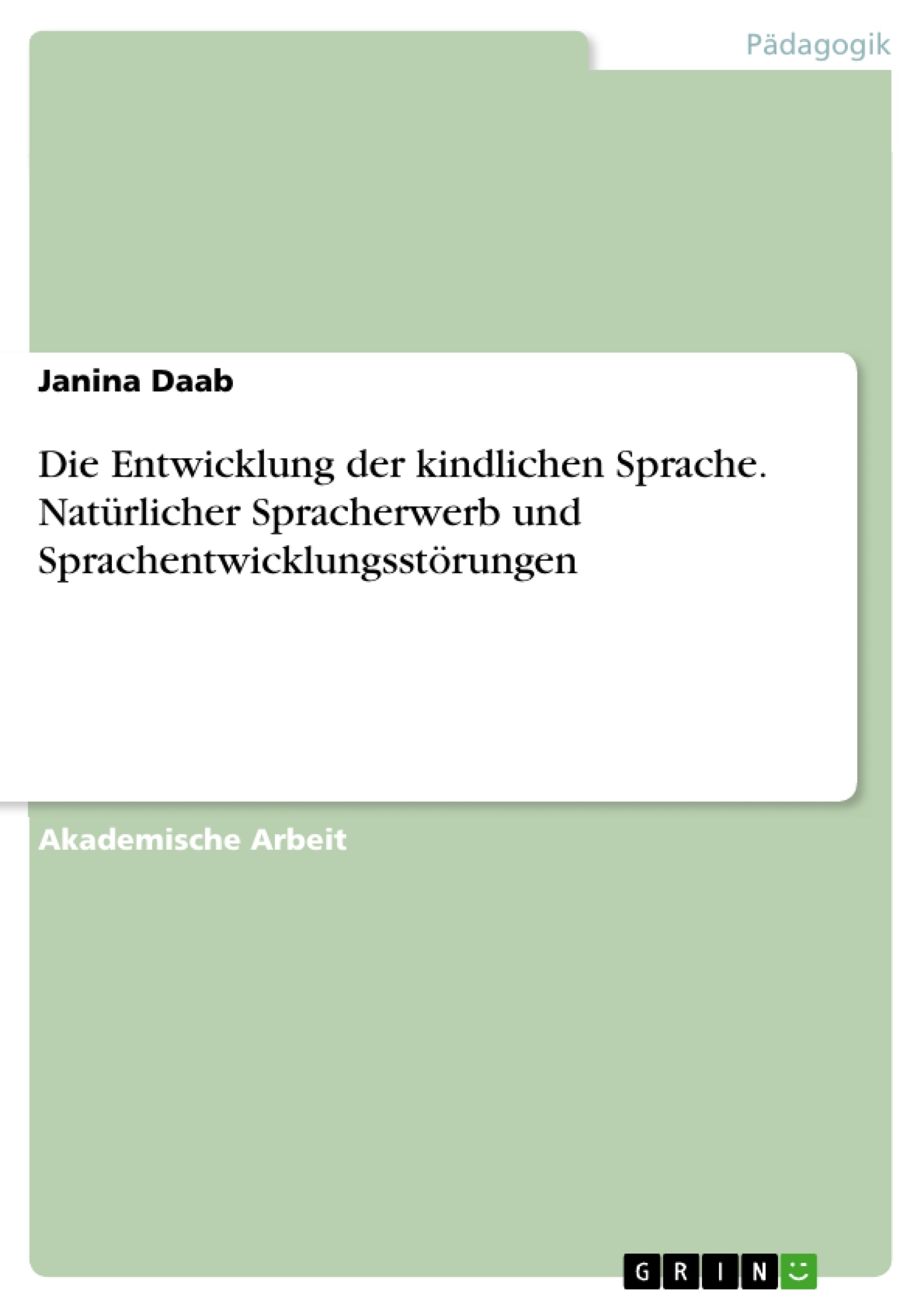Die Fähigkeit, Sprache zu erwerben und Sprache zu gebrauchen, ist im Menschen angelegt. Der Erwerb der Sprache selbst ist ein Lern- und Entwicklungsprozess, der einerseits die Sprachfähigkeit als Anlage voraussetzt, andererseits aber weitgehend von der Umwelt des Kindes abhängig ist, sich also nur in einer sprechenden Umgebung vollziehen kann. Fehlen die sprachlichen Anregungen und sozialen Kontakte zwischen Eltern und Kind, so kann es zu Störungen der Sprache kommen. Das heißt nicht, dass allein die Eltern für spezifische Sprachentwicklungsstörungen ihrer Kinder verantwortlich sind. Vielmehr sind Sprachentwicklungsstörungen sicherlich multikausal bedingt.
Die vorliegende Arbeit beleuchtet den natürlichen Prozess der kindlichen Sprachentwicklung und geht auf ausgewählte Erscheinungsformen von Sprachentwicklungsstörungen ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung der kindlichen Sprache
- Der Entwicklungsbereich der Wahrnehmung
- Voraussetzungen / Bedingungen für den ungehinderten Spracherwerb
- Bestimmende Faktoren
- familiäre Sozialisationsprozessen
- Ebenen der Sprachentwicklung
- Die pragmatisch-kommunikative Ebene
- Die phonetisch-phonologische Ebene
- Die semantisch-lexikalische Ebene
- Die syntaktisch-morphologische Ebene
- Die Entwicklung des Sprachverständnisses
- Die Entwicklung des Redeflusses
- Die Entwicklung des Sprachgefühls
- Zum zeitlichen Verlauf von Sprachentwicklungsprozessen
- Zusammenfassung
- Störungen der Sprachentwicklung
- Der Begriff der Sprachentwicklungsstörung
- Ausgewählte Erscheinungsformen
- Störungen auf der phonetisch-phonologischen Ebene
- Störungen auf der semantisch-lexikalischen Ebene
- Störungen auf der syntaktisch-morphologischen Ebene
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der kindlichen Sprache und beleuchtet die Faktoren, die diese Entwicklung beeinflussen. Sie untersucht sowohl den natürlichen Spracherwerb als auch die Herausforderungen, die mit Sprachentwicklungsstörungen verbunden sind.
- Die Bedeutung der Wahrnehmung für die Sprachentwicklung
- Die Rolle der Umwelt und der familiären Sozialisation
- Die verschiedenen Ebenen der Sprachentwicklung
- Die Charakteristika und Ursachen von Sprachentwicklungsstörungen
- Der Zusammenhang zwischen Sprachentwicklungsstörungen und anderen Entwicklungsbereichen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung des Spracherwerbs für die menschliche Entwicklung heraus und betont die Interaktion zwischen dem Kind und seiner Umwelt. Kapitel 2 widmet sich der Entwicklung der kindlichen Sprache und beleuchtet die Rolle der Wahrnehmung, die Voraussetzungen für den Spracherwerb sowie die verschiedenen Ebenen der Sprachentwicklung. Kapitel 3 untersucht Sprachentwicklungsstörungen, definiert den Begriff und beschreibt verschiedene Erscheinungsformen.
Schlüsselwörter
Spracherwerb, Sprachentwicklung, Sprachentwicklungsstörung, Wahrnehmung, Motorik, Kognition, Sozialisation, Kommunikation, Phonetik, Phonologie, Semantik, Lexik, Syntax, Morphologie, Sprachverständnis, Redefluss, Sprachgefühl.
Häufig gestellte Fragen
Welche Faktoren beeinflussen die kindliche Sprachentwicklung?
Die Sprachentwicklung ist ein Zusammenspiel aus biologischer Anlage (Sprachfähigkeit), Wahrnehmung, Kognition und einer anregenden sozialen Umwelt (familiäre Sozialisation).
Was sind die verschiedenen Ebenen der Sprachentwicklung?
Dazu gehören die phonetisch-phonologische Ebene (Aussprache), die semantisch-lexikalische Ebene (Wortschatz), die syntaktisch-morphologische Ebene (Grammatik) und die pragmatisch-kommunikative Ebene (Sprachverwendung).
Wann spricht man von einer Sprachentwicklungsstörung?
Eine Störung liegt vor, wenn die Sprachentwicklung zeitlich oder inhaltlich deutlich von der Norm abweicht, was sich in Problemen bei der Lautbildung, dem Wortschatz oder dem Satzbau äußern kann.
Sind Eltern allein für Sprachentwicklungsstörungen verantwortlich?
Nein, Sprachentwicklungsstörungen sind meist multikausal bedingt. Zwar ist eine sprechende Umgebung wichtig, aber auch organische, kognitive oder genetische Faktoren spielen eine Rolle.
Welche Rolle spielt die Wahrnehmung beim Spracherwerb?
Die auditive und visuelle Wahrnehmung sind die Grundvoraussetzung, um Laute zu unterscheiden, Wörter zu erkennen und die Verbindung zwischen Objekten und ihren Bezeichnungen zu lernen.
- Citar trabajo
- Janina Daab (Autor), 2003, Die Entwicklung der kindlichen Sprache. Natürlicher Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320430