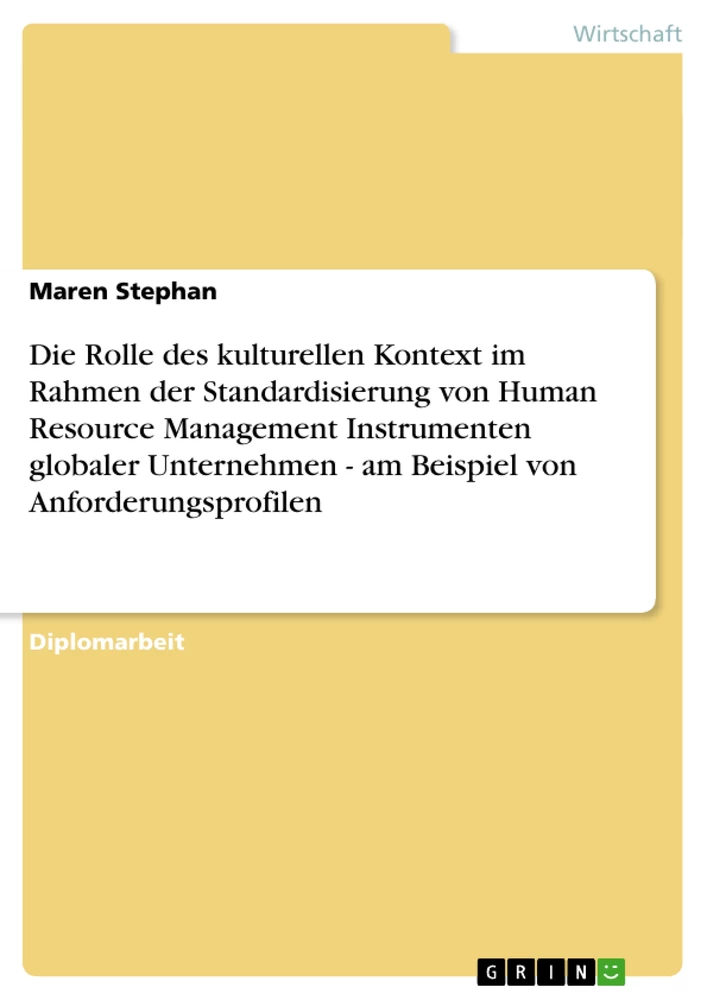Globale Organisationen sind internationale Unternehmen, die weitestgehend nur in globalen Branchen vertreten sind und sich einem globalen Wettbewerb stellen müssen. Charakteristisch für globale Unternehmen ist das Bestreben, über die weltweite Koordination aller Unternehmensaktivitäten Skalen- und Synergieeffekte zu realisieren und simultan alle weltweit relevanten Märkte zu bedienen (Gabler, 1997). Was der Ausdruck „global“, der das Modewort des derzeitigen Business darstellt, eigentlich bedeutet, bzw. welche Implikationen die Globalisierung für diverse Unternehmensbereiche besitzt, wird dabei oft nicht bedacht (Grün, 2000).
Mit der Dynamik der Veränderung, die hauptsächlich durch das Internet und neue Kommunikationstechnologien die sekundenschnelle Datenübertragung ermöglichen, bedingt ist, schrumpfen geographische Distanzen und nationale Grenzen (Fuchs, 2000). Die direkten Konsequenzen des digitalen Zeitalters sind einerseits, daß die Globalisierung und der beschleunigte Wandel in der internationalen organisationalen Umwelt immer mehr Organisationen zwingen, sich außerhalb ihrer nationalen Grenzen zu bewegen. Andererseits steigt die Komplexität der interorganisationalen Beziehungen zwischen den Unternehmen und ihren Stakeholdern an, so daß selbst international Unternehmensgrenzen transparent werden. Der steigende Wettbewerb aufgrund der globalen Tätigkeiten der Organisationen weltweit zwingt die Unternehmen zur stärkeren Wettbewerbsfähigkeit. Daher suchen die Organisationen nach Strategien zur Steigerung der Produktivität und Effektivität. Auf der Suche nach den „Best Practice“ zur Lösung der Probleme der steigenden Komplexität orientieren sich Organisationen auch an Organisationen im Ausland.
Trotz dieser fortschreitenden Globalisierung bleiben lokale und regionale Unterschiede bestehen. Kulturelle und nationale Unterschiede spielen nach wie vor eine Schlüsselrolle in der internationalen Welt des Business. Während uns die internationalen Geschäftstätigkeiten einander näher bringen, ist dieser Prozeß begleitet von einer starken konterkarierenden Kraft, welche uns auf unsere kulturellen Traditionen und Gewohnheiten zurückbesinnen läßt (Beaman & Walker, 2000). Die Balance der Dualitäten der Globalisierung und dem simultanen Erfordernis der Berücksichtigung lokaler Besonderheiten kennzeichnet die entscheidende Aufgabe, welcher das Human Resource Management eines globalen Unternehmens gegenübergestellt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Herausforderung „Globalisierung“
- Aufbau der Arbeit
- Strategisches Human Resource Management
- Der Michigan-Ansatz des Strategischen Human Resource Management
- Rolle der Organisationskultur im Strategischen Human Resource Management
- Charakterisierung der Organisationskultur
- Organisationskultur und Human Resource Management
- Organisationskultur und Struktur
- Organisationskultur und Strategie
- Integrationsfunktion der Organisationskultur
- Anforderungsprofile als Instrument im Rahmen des Human Resource Management
- Begriffsabgrenzung
- Erstellung von Anforderungsprofilen
- Funktionen der Anforderungsprofile
- Darstellung des kulturellen Kontextes des Strategischen Human Resource Management
- Definition und Konzeptualisierung des Kulturbegriffs
- Definition des Kulturbegriffs
- Ebenen der Kultur
- Externe Adaption
- Interne Integration
- Verbindende Annahmen
- Implikationen der Kultur für das Human Resource Management
- Kulturvergleichende Managementforschung
- Kulturgebundene Ansätze
- Kulturfreie Ansätze
- Parallele Betrachtungsweise von Kontingenzfaktoren, ökonomischen Bestimmungsvariablen und Kultur
- Transnationales Modell als Strategie zur Standardisierung von Human Resource Management Instrumenten in globalen Unternehmen
- Transnationales Modell des Human Resource Management
- Transnationale Strategie als Chance zur Standardisierung von Human Resource Management Instrumenten
- Zusammenspiel der Landeskultur und der Organisationskultur unter Berücksichtigung der individuellen Ebene
- Interdependenzen zwischen der Landeskultur und der Organisationskultur
- Dimensionen der Organisationskultur von globalen Organisationen
- Verknüpfung der Ebenen der Organisationskultur und der Landeskultur mit der Individualebene des Mitarbeiters einer Organisation
- Darstellung der Untersuchung
- Beschreibung des Unternehmens SAP
- Fragestellung der empirischen Untersuchungen
- Forschungsstrategie
- Qualitative Voruntersuchung
- Methodische Vorgehensweise der qualitativen Voruntersuchung
- Konstruktion des Interviewleitfadens
- Beschreibung der Stichprobe
- Durchführung der Interviews
- Interpretation der Ergebnisse
- Darstellung der Ergebnisse
- Existenz, Charakteristika & Implementierung von Anforderungsprofilen
- Nutzen, Risiken & „Fit mit der Unternehmenskultur“
- Quantitative Erhebung
- Darstellung des Forschungsdesign
- Konstruktion des Fragebogens
- Konstruktion der Anforderungsprofile
- Methodische Vorgehensweise
- Durchführung der Befragung
- Beschreibung der Stichprobe
- Auswertungsverfahren
- Analyse und Interpretation der Ergebnisse
- Datenreduktion
- Ergebnisse der Faktoranalyse
- Überprüfung der Faktoren
- Zusammenhang zwischen der Landeskultur und der Einstellung der Mitarbeiter gegenüber Anforderungsprofilen
- Nutzen eines (globalen) Job Profiling
- Risiko eines (globalen) Job Profiling
- Zusammenhang zwischen der Landeskultur und der Ausgestaltung von Anforderungsprofilen
- Zusammenhang zwischen der Landeskultur und der Organisationskultur
- Zusammenhang zwischen der Organisationskultur und der Einstellung der Mitarbeiter gegenüber Anforderungsprofilen
- Interaktionseffekte zwischen der nationalen Kultur und der Organisationskultur bezüglich der Einstellung gegenüber Anforderungsprofilen
- Dichotomisierung der Faktoren
- Nutzen eines (globalen) Job Profiling in Abhängigkeit der Organisationskultur und Landeskultur
- Risiko eines (globalen) Job Profiling in Abhängigkeit der Landeskultur und Organisationskultur
- Gesamtinterpretation der Hypothese 5
- Standardisierung von Human Resource Management Instrumenten in globalen Unternehmen
- Rolle des kulturellen Kontextes
- Interdependenzen zwischen Landeskultur und Organisationskultur
- Einfluss auf die Einstellung von Mitarbeitern gegenüber Anforderungsprofilen
- Effektive Anwendung von Anforderungsprofilen in verschiedenen Ländern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Standardisierung von Human Resource Management Instrumenten in globalen Unternehmen. Im Fokus steht dabei die Rolle des kulturellen Kontextes und die Frage, wie Anforderungsprofile trotz kultureller Unterschiede in verschiedenen Ländern effektiv eingesetzt werden können. Die Arbeit untersucht die Interdependenzen zwischen der Landeskultur und der Organisationskultur sowie die Auswirkungen auf die Einstellung von Mitarbeitern gegenüber Anforderungsprofilen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Herausforderungen der Globalisierung für Unternehmen beleuchtet und den Aufbau der Arbeit erläutert. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem strategischen Human Resource Management und dem Michigan-Ansatz. Hierbei wird die Bedeutung der Organisationskultur für das Human Resource Management und die Funktion von Anforderungsprofilen als Instrument im Rahmen des Human Resource Management näher beleuchtet. Kapitel 3 definiert den Kulturbegriff und seine verschiedenen Ebenen. Weiterhin werden kulturvergleichende Managementforschung und verschiedene Ansätze zur Berücksichtigung kultureller Einflüsse vorgestellt. Kapitel 4 befasst sich mit dem transnationalen Modell als Strategie zur Standardisierung von Human Resource Management Instrumenten in globalen Unternehmen. Es werden die Interdependenzen zwischen Landeskultur und Organisationskultur sowie die Verknüpfung mit der individuellen Ebene des Mitarbeiters beleuchtet. Die Darstellung der Untersuchung in Kapitel 5 beschreibt das Unternehmen SAP und die Fragestellung der empirischen Untersuchungen. Kapitel 6 präsentiert die qualitative Voruntersuchung, die die Existenz, Charakteristika und Implementierung von Anforderungsprofilen sowie deren Nutzen, Risiken und „Fit mit der Unternehmenskultur“ untersucht. Kapitel 7 beschreibt die quantitative Erhebung, das Forschungsdesign, die Konstruktion des Fragebogens und die methodische Vorgehensweise. Die Analyse und Interpretation der Ergebnisse umfasst die Datenreduktion, die Ergebnisse der Faktoranalyse, den Zusammenhang zwischen Landeskultur und der Einstellung der Mitarbeiter gegenüber Anforderungsprofilen sowie den Zusammenhang zwischen Landeskultur und Organisationskultur.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Human Resource Management, Globalisierung, Standardisierung, kultureller Kontext, Landeskultur, Organisationskultur, Anforderungsprofile, und Mitarbeiter-Einstellung. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen liefern wichtige Erkenntnisse über die Bedeutung des kulturellen Kontextes für die erfolgreiche Anwendung von Human Resource Management Instrumenten in globalen Unternehmen.
Häufig gestellte Fragen
Können HR-Instrumente in globalen Unternehmen standardisiert werden?
Die Arbeit untersucht, wie Unternehmen wie SAP versuchen, Instrumente wie Anforderungsprofile trotz kultureller Unterschiede weltweit einheitlich zu nutzen.
Welchen Einfluss hat die Landeskultur auf das Human Resource Management?
Kulturelle Unterschiede spielen eine Schlüsselrolle; sie beeinflussen die Akzeptanz und Wirksamkeit von globalen HR-Vorgaben auf lokaler Ebene.
Was ist das "Transnationale Modell" im HRM?
Es ist eine Strategie, die die Balance zwischen globaler Standardisierung (Effizienz) und lokaler Anpassung (Kulturrelevanz) sucht.
Welche Rolle spielen Anforderungsprofile bei SAP?
Anforderungsprofile dienen als Instrument zur Definition von Kompetenzen; die Arbeit analysiert deren Implementierung und den "Fit" mit der Unternehmenskultur.
Wie hängen Organisationskultur und Landeskultur zusammen?
Es bestehen starke Interdependenzen; die Organisationskultur kann eine integrierende Funktion übernehmen, muss aber die nationale Identität der Mitarbeiter berücksichtigen.
- Quote paper
- Maren Stephan (Author), 2001, Die Rolle des kulturellen Kontext im Rahmen der Standardisierung von Human Resource Management Instrumenten globaler Unternehmen - am Beispiel von Anforderungsprofilen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32046