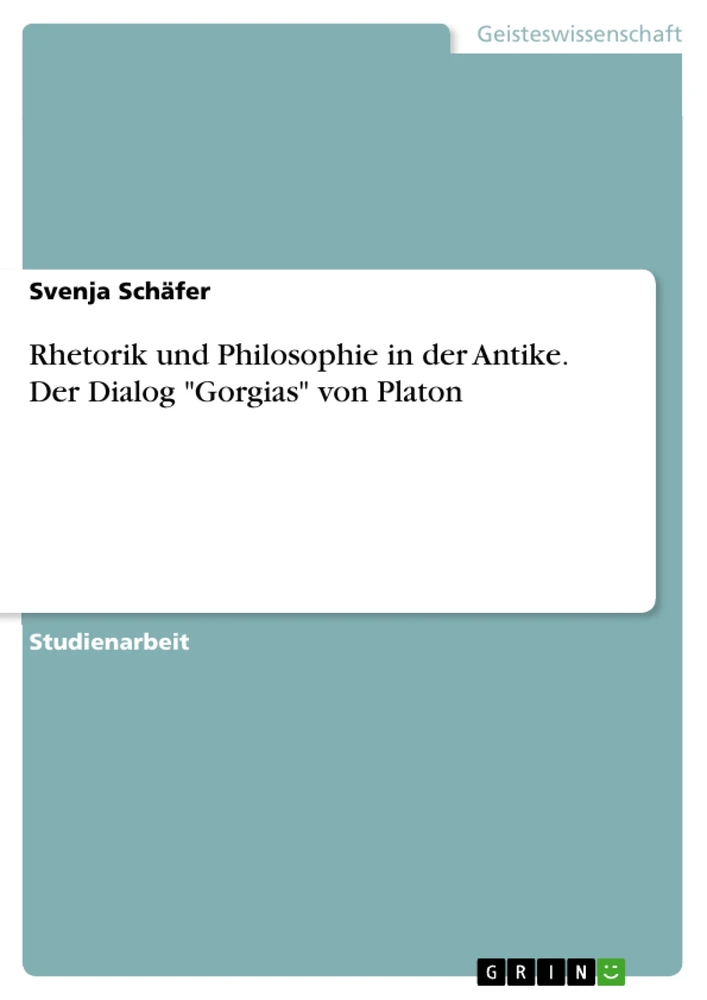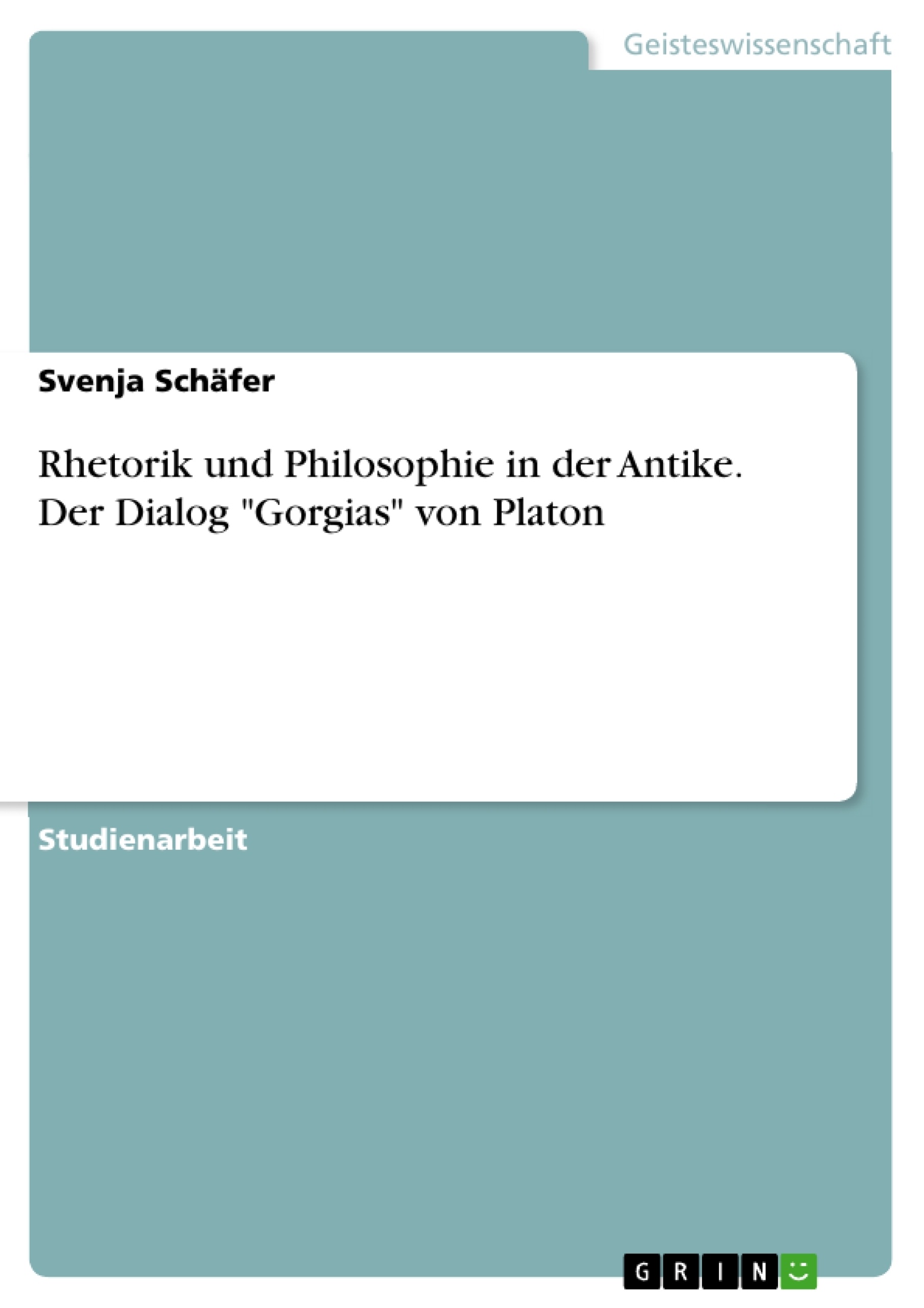In dieser Hausarbeit soll das Verhältnis zwischen Rhetorik und Philosophie in der Antike sowie Platons Stellung zur Rhetorik verdeutlicht werden. Als Grundlage dient hierfür ein Werk Platons, nämlich der Dialog „Gorgias“. Die zentrale These, die im Laufe dieser Hausarbeit genauer beleuchtet und bewiesen werden soll, lautet: „Die Stellung Platons zur Rhetorik, wie sie im Dialog „Gorgias“ zum Vorschein kommt, ist in ihren Grundzügen eine Darstellung des Verhältnisses zwischen den beiden rivalisierenden Schulen Rhetorik und Philosophie“.
Der platonische Dialog „Gorgias“ behandelt die zu Lebzeiten Platons aktuelle Debatte zwischen den Philosophen und den Rhetoren. Der antike Philosoph Platon, Schüler des immer wieder in seinen Werken als Protagonist auftretenden Sokrates, gründete im Jahre 387 v. Chr. eine Schule, in der er philosophisch-wissenschaftlichen Unterricht erteilte. So entstand die Akademie, die erste Philosophenschule Griechenlands. Die Akademie stand jedoch in einer Rivalität zu einer Schule der Beredsamkeit von Isokates, einem Lehrer der Rhetorik.
Platons kritische Haltung zu den Bestrebungen des Isokrates kommt unter anderem in einem seiner Dialoge, nämlich dem „Gorgias“ sehr gut zum Vorschein.
Die Besonderheit des „Gorgias“ ist, dass das Streitgespräch zwischen Platons Protagonisten Sokrates und den Rhetoren Gorgias, Polos und Kallikles auf zwei Ebenen verläuft; einerseits auf einer theoretischen Ebene, in dem definitorische Schlüsse gezogen werden und andererseits auf einer praktischen Ebene, in der die Vertreter der Rhetorik mit dem Philosophen Sokrates anhand einer rhetorisch fesselnden Gesprächsführung streiten. Sieger dieser Auseinandersetzung ist die Philosophie, denn keiner der Rhetoren schafft es, der dialektischen Einsicht des Sokrates Stand zu halten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtlicher Hintergrund
- Die Geschichte der Rhetorik
- Die Philosophie als Gegenströmung der Rhetorik
- Der Dialog „Gorgias“
- Das Gespräch zwischen Sokrates und Gorgias über die Beschaffenheit der Rhetorik
- Das Gespräch zwischen Sokrates und Polos
- Über die Rhetorik als Scheinkunst
- Die Macht der Rede
- Platons Haltung zur Rhetorik
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Platons Haltung zur Rhetorik, insbesondere wie sie im Dialog „Gorgias“ dargestellt wird. Ziel ist es, das Verhältnis zwischen Rhetorik und Philosophie im antiken Athen zu beleuchten und Platons kritische, aber auch potenziell konstruktive Perspektive auf die Rhetorik zu analysieren. Die Arbeit basiert auf einer Analyse des „Gorgias“ und einschlägiger Sekundärliteratur.
- Das Verhältnis von Rhetorik und Philosophie im antiken Athen
- Platons Kritik an der Rhetorik im „Gorgias“
- Die Darstellung der Rhetorik als Scheinkunst im „Gorgias“
- Die „Macht der Rede“ und ihre ethische Dimension
- Potenziell konstruktive Aspekte in Platons Kritik an der Rhetorik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die zentrale These vor: Platons Haltung zur Rhetorik im „Gorgias“ spiegelt das Spannungsverhältnis zwischen den rivalisierenden Schulen der Rhetorik und der Philosophie wider. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die verwendeten Quellen und Forschungsliteratur, unterstreicht die Aktualität des Themas – die Frage nach dem richtigen Leben und der Rolle der Rhetorik in der Politik – und setzt den Rahmen für die folgende Analyse.
Geschichtlicher Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext des Dialogs „Gorgias“, indem es den Antagonismus zwischen Rhetorik/Sophistik und Philosophie im 4./5. Jahrhundert v. Chr. beschreibt. Es bietet einen kurzen Überblick über Platons Leben und Wirken, seine Gründung der Akademie und deren Rivalität zu den Schulen der Beredsamkeit, und hebt die Bedeutung des Peloponnesischen Krieges und der Herrschaft der Dreißig Tyrannen als prägende Ereignisse für Platons Lebensweg und sein Verhältnis zur Politik hervor. Der Abschnitt betont die Abwendung vieler Athener von der Philosophie zugunsten der Rhetorik als ein zentrales Merkmal dieser Zeit.
Der Dialog „Gorgias“: Dieses Kapitel analysiert den platonischen Dialog „Gorgias“ als zentrale Quelle für die Untersuchung von Platons Haltung zur Rhetorik. Es beschreibt die zweigleisige Struktur des Dialogs – die theoretische Ebene der Definition und die praktische Ebene der rhetorischen Auseinandersetzung zwischen Sokrates und den Rhetoren Gorgias, Polos und Kallikles. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Rhetorik als eine Technik der Überzeugung, die unabhängig von Wahrheit und Gerechtigkeit eingesetzt werden kann. Die Kapitel unterstreichen, wie Sokrates durch dialektische Argumentation die Schwächen der rhetorischen Positionen aufdeckt und die Überlegenheit der philosophischen Methode demonstriert.
Platons Haltung zur Rhetorik: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Platons kritische Haltung gegenüber der Rhetorik, wie sie sich im „Gorgias“ und in anderen Schriften zeigt. Es werden die Argumente Platons gegen die Rhetorik als bloße Technik der Manipulation und die damit verbundenen ethischen Bedenken dargelegt. Die Analyse berücksichtigt dabei die unterschiedlichen Aspekte von Platons Kritik und betrachtet mögliche konstruktive Elemente in seinem Denken über Rhetorik, also die Frage, ob und wie Platons Kritik zur Verbesserung der Rhetorik beitragen konnte. Die Kapitel bewerten Platons Philosophie und ihre Auswirkungen auf das Verständnis von Rhetorik.
Schlüsselwörter
Platon, Rhetorik, Gorgias, Philosophie, Antike, Sokrates, Dialektik, Scheinkunst, Macht der Rede, Politische Philosophie, Ethik.
Häufig gestellte Fragen zu Platons Gorgias und seiner Haltung zur Rhetorik
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über eine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit Platons Haltung zur Rhetorik im Dialog „Gorgias“ auseinandersetzt. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse des Verhältnisses zwischen Rhetorik und Philosophie im antiken Athen und Platons kritischer, aber auch potenziell konstruktiver Perspektive auf die Rhetorik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Geschichtlicher Hintergrund, Der Dialog „Gorgias“, Platons Haltung zur Rhetorik und Schlussfolgerung. Der „Geschichtlicher Hintergrund“ beleuchtet den Kontext des Dialogs „Gorgias“, während das Kapitel „Der Dialog „Gorgias““ den Dialog selbst analysiert. „Platons Haltung zur Rhetorik“ konzentriert sich auf Platons Kritik an der Rhetorik und mögliche konstruktive Aspekte. Die Einleitung und Schlussfolgerung rahmen die Analyse ein.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These besagt, dass Platons Haltung zur Rhetorik im „Gorgias“ das Spannungsverhältnis zwischen den rivalisierenden Schulen der Rhetorik und der Philosophie im antiken Athen widerspiegelt. Platons Kritik an der Rhetorik wird im Kontext dieses historischen und philosophischen Antagonismus analysiert.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie das Verhältnis von Rhetorik und Philosophie im antiken Athen, Platons Kritik an der Rhetorik als bloße Technik der Manipulation, die Darstellung der Rhetorik als Scheinkunst im „Gorgias“, die „Macht der Rede“ und ihre ethische Dimension sowie potenziell konstruktive Aspekte in Platons Kritik.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer Analyse des platonischen Dialogs „Gorgias“ und einschlägiger Sekundärliteratur. Die genaue Quellenangabe wird in der vollständigen Arbeit aufgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Platon, Rhetorik, Gorgias, Philosophie, Antike, Sokrates, Dialektik, Scheinkunst, Macht der Rede, Politische Philosophie, Ethik.
Wie wird Platons Kritik an der Rhetorik dargestellt?
Platons Kritik an der Rhetorik im „Gorgias“ wird als eine Kritik an der bloßen Technik der Manipulation dargestellt, die unabhängig von Wahrheit und Gerechtigkeit eingesetzt werden kann. Die Arbeit untersucht jedoch auch potenziell konstruktive Elemente in Platons Denken über Rhetorik, die Frage also, ob und wie seine Kritik zur Verbesserung der Rhetorik beitragen könnte.
Welchen Stellenwert hat der Dialog „Gorgias“ in der Arbeit?
Der Dialog „Gorgias“ bildet die zentrale Quelle für die Untersuchung von Platons Haltung zur Rhetorik. Die Arbeit analysiert sowohl die theoretische als auch die praktische Ebene des Dialogs, um Platons Argumentation gegen die rhetorische Position zu verstehen.
Was ist das übergeordnete Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, das Verhältnis zwischen Rhetorik und Philosophie im antiken Athen zu beleuchten und Platons kritische, aber auch potenziell konstruktive Perspektive auf die Rhetorik zu analysieren.
- Arbeit zitieren
- Svenja Schäfer (Autor:in), 2016, Rhetorik und Philosophie in der Antike. Der Dialog "Gorgias" von Platon, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320490