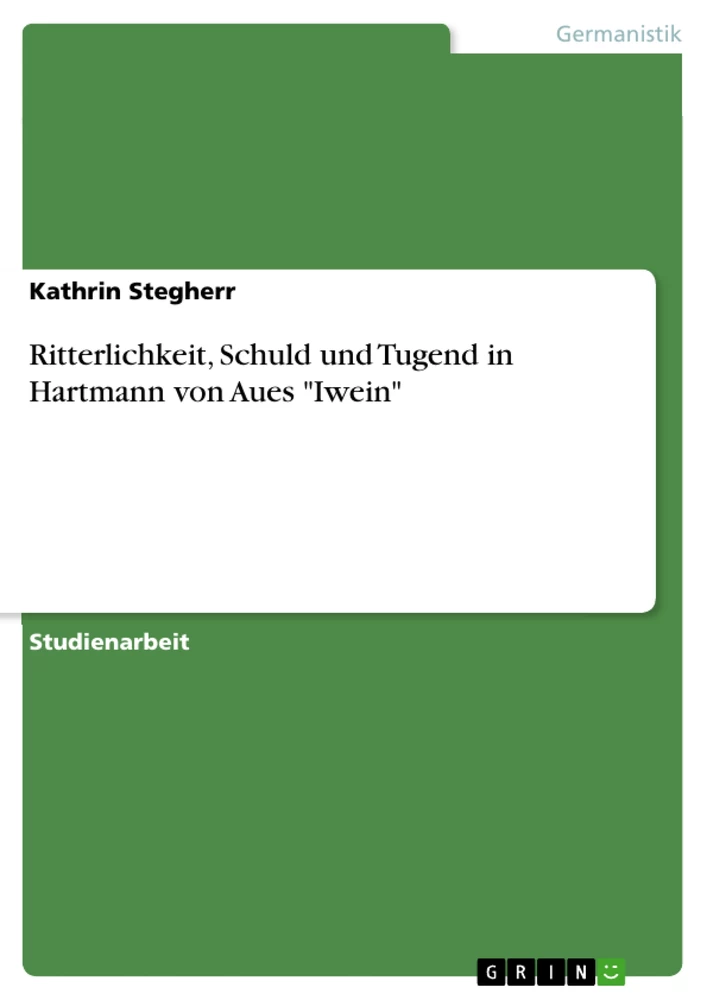Die Ritter im Mittelalter traten in der Realität, im Gegensatz zur höfischen Literatur, eben nicht immer als tugendhafte Kämpfer auf. Vielmehr entwickelte sich in der Literatur ein Ritterbegriff, der sich in der Wirklichkeit in keinster Weise widerspiegelte. Moralische Werte und Tugenden hatten keine erwähnenswerte Bedeutung für die Ritter des Mittelalters.
Aufgrund dieser Tatsache hatten es sich die höfischen Dichter zur Aufgabe gemacht, den Ritterbegriff in ihren Werken zu idealisieren. „Sie wollten (…) auf die gesellschaftliche Praxis Einfluß nehmen“ (Bumke 2008:432) und ihre Zuhörer durch die Veranschaulichung eines vollkommenen Ritters auf die Missstände aufmerksam machen. Auch in Hartmanns von Aue Artusroman „Iwein“ spielen ritterliche Tugenden eine tragende und leitende Rolle. Durch diese Tugenden werden Handlungsoptionen des guten Ritters festgelegt. Schon zu Beginn des Romans, bevor eine erste Handlung überhaupt einsetzt, wird von König Artus berichtet, der sämtliche ritterliche Tugenden besitzt und als Vorbild für die gesamte Ritterschaft gilt. Dem Text nach wird Artus wegen dieser Eigenschaften noch über den Tod hinaus bekannt und beliebt sein.
Der Prolog lässt erkennen, wie viel Bedeutung Hartmann „êre“, „saelde“ und „muote“, also allgemein den ritterlichen Tugenden, im Roman, zuspricht. Genannter Umstand wirft die Frage auf, ob Iwein den Idealen eines Ritters gerecht wird. Ritterlichkeit also, als einer der zentralen Leitbegriffe des Romans, soll in dieser Arbeit definiert und in Bezug auf Iwein analysiert werden. Ferner wird die Verknüpfung von Schuld und Tugend thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Ritterlichkeit - Realität und höfisches Ideal.
- Der Ritter und seine Tugendhaftigkeit...
- Ritterbegriff...
- Die höfischen Tugenden..
- Schuld und Tugend in Hartmanns Iwein......
- Iwein als tugendhafter Ritter..
- Literaturverzeichnis..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Ritterbegriff in Hartmanns von Aue Artusroman „Iwein“ und untersucht, wie der Protagonist Iwein den Idealen eines Ritters gerecht wird. Die Arbeit analysiert die Verknüpfung von Schuld und Tugend im Roman und beleuchtet die Bedeutung ritterlicher Tugenden im Kontext der höfischen Literatur des Mittelalters.
- Der Wandel des Ritterbegriffs vom einfachen Fußsoldaten zum höfischen Ideal.
- Die Rolle der christlichen Gebote und des antiken Tugendsystems in der Entwicklung der höfischen Tugenden.
- Die Bedeutung von Tugenden wie „triuwe“ und „staete“ in Hartmanns „Iwein“.
- Die Frage, ob Iwein den Idealen eines Ritters gerecht wird.
- Die Verbindung von Schuld und Tugend im Kontext der Handlung des Romans.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Diskrepanz zwischen dem realen Bild der Ritter im Mittelalter und dem idealisierten Ritterbild der höfischen Literatur. Es wird gezeigt, dass die Ritter des Mittelalters moralische Werte und Tugenden nicht hoch schätzten und die höfischen Dichter daher den Ritterbegriff in ihren Werken idealisieren mussten.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Ritterbegriff und den höfischen Tugenden. Es wird die Entwicklung des Begriffs „miles“ vom einfachen Soldaten zum schwergewappneten Reiter und schließlich zum höfischen Ideal analysiert. Es wird zudem die Bedeutung der christlichen Gebote und des antiken Tugendsystems für die Entwicklung der höfischen Tugenden erläutert.
Kapitel drei befasst sich mit der Rolle von Schuld und Tugend in Hartmanns „Iwein“. Es wird untersucht, wie Iwein mit den Herausforderungen der ritterlichen Tugenden umgeht und welche Konsequenzen seine Handlungen für ihn haben.
Kapitel vier analysiert Iweins Charakter und seine Entwicklung als tugendhafter Ritter. Es wird untersucht, ob er den Idealen der höfischen Literatur gerecht wird und welche Rolle die verschiedenen Tugenden in seinem Handeln spielen.
Schlüsselwörter
Ritterlichkeit, höfische Literatur, Iwein, Hartmann von Aue, Tugenden, Schuld, triuwe, staete, miles, chevalier, Ritterbegriff, höfisches Ideal, christliche Gebote, antikes Tugendsystem.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterschied sich das reale Rittertum vom höfischen Ideal?
In der Realität waren Ritter oft wenig tugendhaft. Die höfische Literatur idealisierte den Ritterbegriff bewusst, um auf gesellschaftliche Missstände einzuwirken und moralische Vorbilder zu schaffen.
Welche Rolle spielt König Artus in Hartmanns "Iwein"?
König Artus wird im Prolog als das vollkommene Vorbild für die gesamte Ritterschaft dargestellt, der alle ritterlichen Tugenden wie "êre" und "saelde" verkörpert.
Was bedeuten die Begriffe "triuwe" und "staete"?
"Triuwe" steht für Treue und Zuverlässigkeit, während "staete" Beständigkeit bedeutet. Beides sind zentrale ritterliche Tugenden, die das Handeln eines idealen Ritters leiten sollten.
Wird Iwein den ritterlichen Idealen im Roman gerecht?
Die Arbeit analysiert Iweins Entwicklung und untersucht, wie er mit Schuld und der Herausforderung, den hohen moralischen Anforderungen der Ritterlichkeit zu entsprechen, umgeht.
Was ist die Bedeutung des Begriffs "miles"?
Der Begriff "miles" wandelte sich im Mittelalter vom einfachen Fußsoldaten zum schwerbewaffneten Reiter (Ritter) und schließlich zum Träger eines ethisch fundierten Standesideals.
- Citar trabajo
- Kathrin Stegherr (Autor), 2012, Ritterlichkeit, Schuld und Tugend in Hartmann von Aues "Iwein", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320494