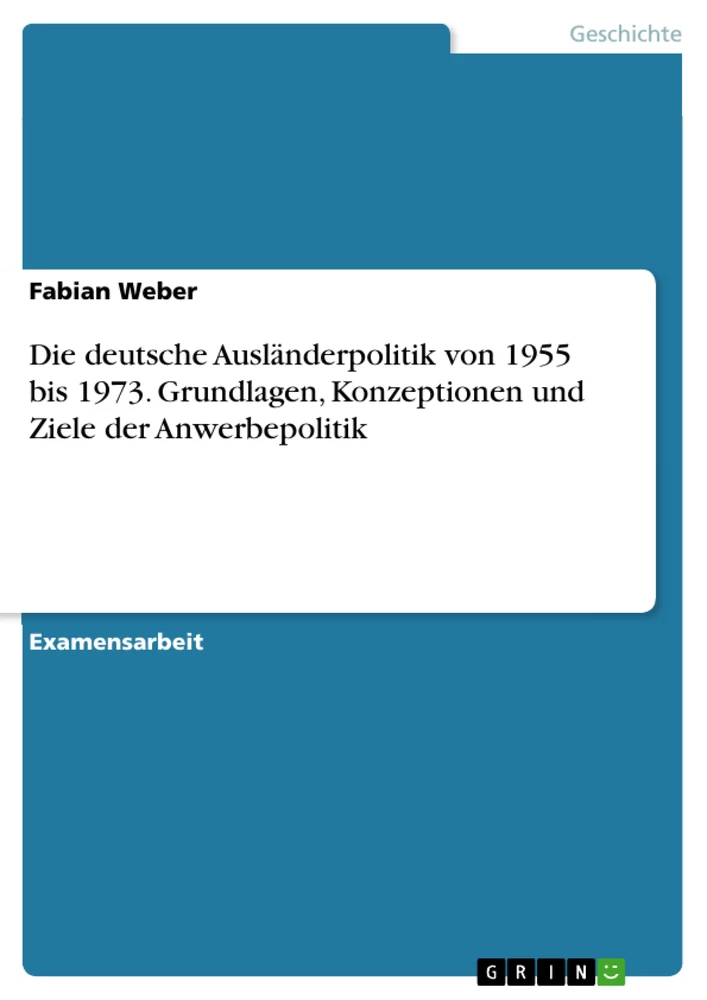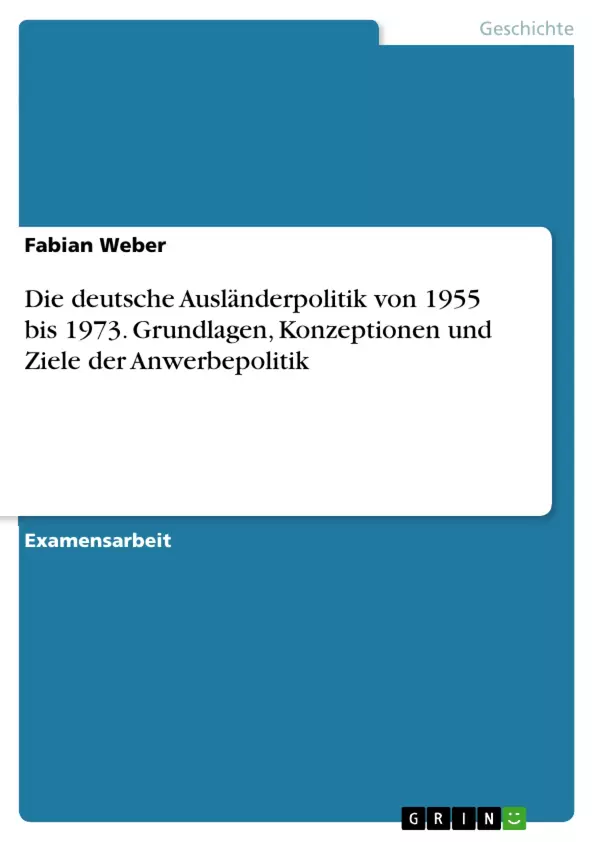Als die Bundesrepublik Deutschland (BRD) in der aktiven Phase der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte (1955 bis 1973) die Anwerbeabkommen schloss, handelte es sich dabei keineswegs um eine Grundsatzentscheidung in kultureller, sozialer und demographischer Hinsicht.
Vielmehr ging es in erster Linie darum, den akuten Arbeitskräftebedarf, der damals in der BRD herrschte, mittels der „Hereinnahme“ ausländischer Arbeitskräfte zu decken. Diese wurden inoffiziell „Gastarbeiter“ genannt, da man davon ausging, dass ihr Aufenthalt nur von vorübergehender Natur bleiben sollte. Am Ende der „Gastarbeiterperiode“ lebten jedoch ca. 3. Mio. Zuwanderer dauerhaft in Deutschland.
Insofern stellt sich die Frage, wie eine als temporär angedachte Arbeitsmigration in einen faktischen Einwanderungsprozess umschlagen konnte? Angesichts des unumstrittenen Arbeitskräftemangels dominierte lange Zeit die einhellige Forschungsmeinung, die Anwerbevereinbarungen seien allein aus arbeitsmarktpolitischem Interesse erfolgt. Dementsprechend wäre die Initiative zu den Abkommen von der BRD ausgegangen.
Um diese Einschätzung bestätigen zu können, besteht die Absicht der vorliegenden Arbeit darin, die Grundlagen der deutschen Ausländerpolitik von 1955 – 1973 aufzuzeigen, die darauf aufbauende Konzeption zu analysieren und zu prüfen, was die Ziele dieser Politik waren. Darüber hinaus soll untersucht werden, ob sich in der gegenwärtigen Forschung an der eindimensionalen Betrachtung der Anwerbeabkommen als rein arbeitsmarktpolitische Maßnahmen festhalten lässt und welche Faktoren zum Scheitern dieses Vorhabens führten.
Daher werden in einem einleitenden Kapitel die Grundlagen der deutschen Ausländerpolitik von 1955 – 1973, deren Ursprünge in das Wilhelminische Kaiserreich zurückreichen, dargelegt.
Dazu werden zunächst die Leitlinien einer idealtypischen „Gastarbeiter“-Politik untersucht und die Entstehung des Modells Saisonarbeit im Kaiserreich sowie die Weiterentwicklung dieses Instrumentariums beleuchtet. Des Weiteren werden die darauf aufbauende Konzeption der Ausländerpolitik und die damit verbundene Zielsetzung untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 GRUNDLAGEN – KONZEPTIONEN – ZIELE
- 2.1 Elemente einer idealtypischen "Gastarbeiter"-Politik
- 2.2 Modell Saisonarbeit im Kaiserreich und Weiterentwicklung
- 2.3 Vorteile der „,Gastarbeit“.
- 3 VON DEN ANFÄNGEN BIS ZUR VOLLBESCHÄFTIGUNG (1955-1959/60)
- 3.1 Demographische, wirtschaftliche und ausländerrechtliche Rahmenbedingungen
- 3.1.1 Demographische Entwicklung der deutschen Bevölkerung und des Arbeitsmarktes
- 3.1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
- 3.1.3 Ausländerrechtliche Regelungen im Bereich Einreise, Aufenthalt und Arbeitsmarktzugang.
- 3.2 Die deutsch-italienische Anwerbevereinbarung.
- 3.2.1 Die deutsch-italienischen Handelsgespräche seit 1953...
- 3.2.2 Der Anwerbevertrag mit Italien.
- 3.3 Vollbeschäftigung
- 3.1 Demographische, wirtschaftliche und ausländerrechtliche Rahmenbedingungen
- 4 VOM MAUERBAU BIS ZUR WIRTSCHAFTSREZESSION 1966/67
- 4.1 Wendepunkt am Arbeitsmarkt
- 4.2 Geburt und Scheitern einer Rotationspolitik - Der deutsch-türkische Anwerbevertrag von 1961 und die Neufassung von 1964.
- 4.2.1 Vorgeschichte, Hintergründe und Interessen
- 4.2.2 Der deutsch-türkische Anwerbevertrag 1961.
- 4.2.3 Die Neufassung von 1964.
- 4.3 Keine Arbeitskräfte außereuropäischer Herkunft! Außenpolitische Raison oder was verbirgt sich dahinter?
- 4.4 Die Grundsätze der Ausländerpolitik – Einwanderungsland wider Willen?
- 4.5 Wirtschaftsrezession 1966/67.
- 5 VON DER MASSENANWERBUNG BIS ZUM ANWERBESTOPP (1968-1973)
- 5.1 Neukonzeption der Ausländerpolitik oder kollektive Erkenntnisverweigerung?
- 5.2 Faktische Niederlassung
- 5.3 Der Anwerbestopp von 1973 und die Folgen..
- 6 FAZIT UND PERSPEKTIVEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der deutschen Ausländerpolitik in der Zeit von 1955 bis 1973. Sie untersucht die Entwicklung der Politik von den Anfängen der „Gastarbeiter“-Anwerbung bis zum Anwerbestopp im Jahr 1973. Die Arbeit analysiert die zugrundeliegenden Konzepte und Ziele der Ausländerpolitik sowie die relevanten Rahmenbedingungen.
- Entwicklung der „Gastarbeiter“-Politik in Deutschland
- Einfluss von demographischen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren auf die Ausländerpolitik
- Anwerbeabkommen mit verschiedenen Ländern
- Wandel der Ausländerpolitik von der Anwerbung zur Integration
- Kritik und Kontroversen der „Gastarbeiter“-Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und definiert die zentralen Begriffe der Arbeit. Kapitel zwei beleuchtet die theoretischen Grundlagen und Konzepte der „Gastarbeiter“-Politik. Die Kapitel drei und vier analysieren die Entwicklung der deutschen Ausländerpolitik in den Jahren 1955 bis 1967. Dabei wird insbesondere auf die Rolle der demographischen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen eingegangen. Kapitel fünf behandelt die Jahre 1968 bis 1973, in denen die Ausländerpolitik neu konzipiert wurde und der Anwerbestopp erfolgte. Das sechste und letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und bietet einen Ausblick auf die weitere Entwicklung der deutschen Ausländerpolitik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen „Gastarbeiter“, „Ausländerpolitik“, „Anwerbung“, „Integration“, „demographische Entwicklung“, „wirtschaftliche Rahmenbedingungen“, „politische Rahmenbedingungen“, „Anwerbeabkommen“, „Anwerbestopp“, „Deutschland“ und „1955-1973“.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der deutschen Anwerbepolitik zwischen 1955 und 1973?
Primäres Ziel war die Deckung des akuten Arbeitskräftebedarfs in der Industrie durch ausländische "Gastarbeiter".
Warum wurde der Begriff "Gastarbeiter" verwendet?
Man ging davon aus, dass der Aufenthalt der Arbeitskräfte nur vorübergehend (temporär) sein würde und sie nach einiger Zeit in ihre Heimat zurückkehren.
Wann fand der Anwerbestopp statt?
Infolge der Wirtschaftskrise wurde im Jahr 1973 ein offizieller Anwerbestopp für ausländische Arbeitskräfte verhängt.
Mit welchen Ländern schloss die BRD Anwerbeabkommen?
Das erste Abkommen wurde 1955 mit Italien geschlossen, gefolgt unter anderem von der Türkei (1961), Griechenland und Spanien.
Warum wurde Deutschland trotz anderer Planung zum Einwanderungsland?
Viele Arbeiter blieben dauerhaft, holten ihre Familien nach und die geplante Rotationspolitik scheiterte an wirtschaftlichen und sozialen Realitäten.
- Citation du texte
- Fabian Weber (Auteur), 2014, Die deutsche Ausländerpolitik von 1955 bis 1973. Grundlagen, Konzeptionen und Ziele der Anwerbepolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320519