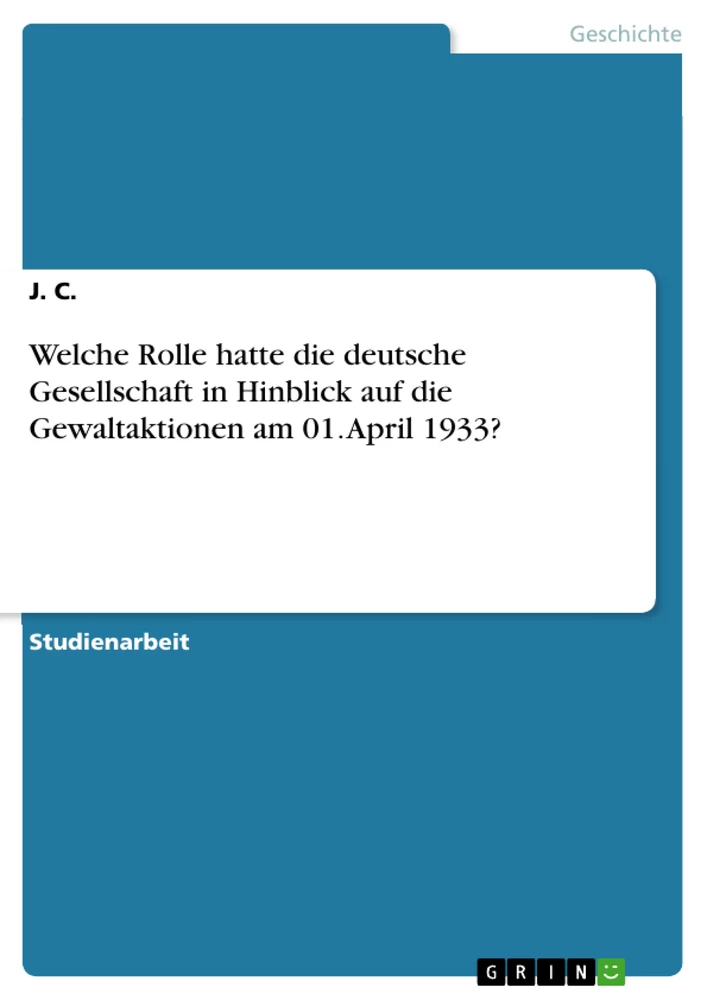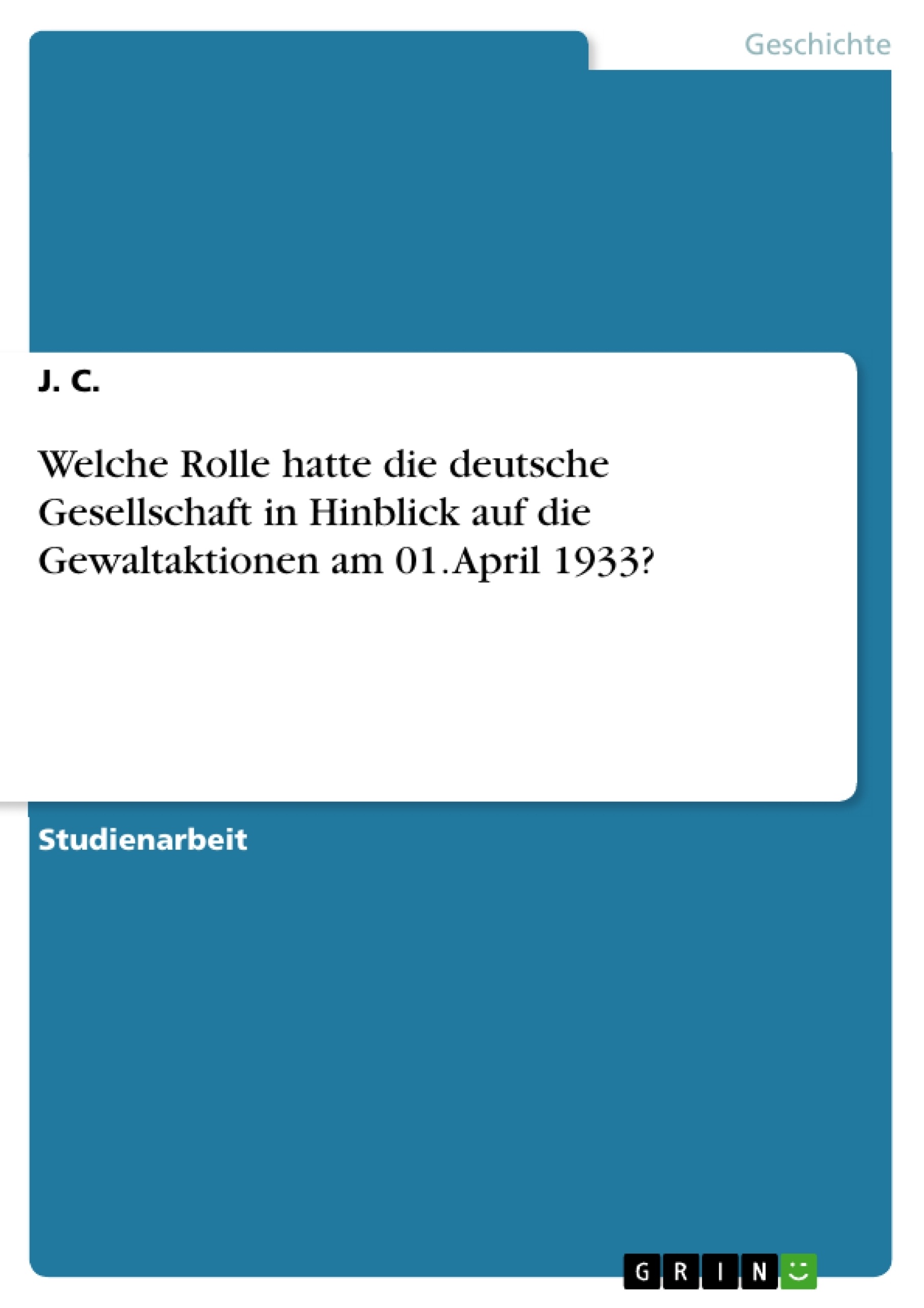Die Seminararbeit in vier Teile unterteilt. Zu Beginn soll der Boykott vom 01. April 1933 exemplarisch zur Veranschaulichung der Boykottbewegungen zwischen 1933 und 1935 dienen. Im Anschluss daran sollen die verschiedenen „Akteure“ des Boykotts skizziert werden, wobei festzustellen sein wird, dass es sowohl aktive als auch passive Akteure gegeben hat. Im Weiteren soll die Rolle der „Volksgemeinschaft“ aufgezeigt werden, um daran anschließend die gegensätzlichen Standpunkte von Hans Mommsen und Michael Wildt zu erläutern. Abschließend wird ein Fazit auf Basis der Bearbeitung der Leitfrage gezogen.
Die Jahre 1933-1935 waren für die Juden in Deutschland einschneidend, denn ihr Alltag wurde geprägt durch Boykottbewegungen, Ausgrenzung und Gewaltaktionen.
In der vorliegenden Seminararbeit soll es um die Boykottbewegungen im Jahre 1933 gehen. Dieses Jahr wurde für die Analyse deswegen ausgewählt, weil sie die radikalen Anfänge der Judenverfolgung in Deutschland veranschaulichen und exemplarisch für die folgenden Jahre dienen. Allen voran stellt sich in Hinblick auf die Boykottbewegungen die Frage nach den Akteuren - aktive wie passive - sowie die Rolle der deutschen Gesellschaft, auch in Hinblick auf die Gewaltausschreitungen innerhalb der Boykottaktionen.
Es werden unterschiedliche Meinungen und verschiedene Perspektiven, die unterschiedliche Blickwinkel in Hinblick auf die Ausschreitungen zeigen, analysiert. Dies ist vor allem deshalb wichtig, um sich ein breites Bild darüber machen zu können, welche „Meinung“ am ehesten zugetroffen haben könnte und wie sich das Verhältnis von „deutsch“ und „jüdisch“ in der Gesellschaft verschob. Gerade in Hinblick auf die Gewaltaktionen innerhalb der Boykottbewegungen gibt es unterschiedliche Berichte und Meinungen über den Ausgangspunkt der Gewalt. Ging die Gewalt von der deutschen Gesellschaft oder vom NS-Regime aus? Welche Rolle spielte hierbei die „Volksgemeinschaft“?
Um diese letzte Frage zu beantworten, werden zwei gegensätzliche Standpunkte veranschaulicht, zum einen der Standpunkt Hans Mommsens und zum anderen der Standpunkt Michael Wildts, um auch hier deutlich zu zeigen, dass die Forschung sich, bis heute, mit diesem Thema auseinandersetzt. Die Kontroversen und strittigen Positionen sind bis heute nicht eindeutig geklärt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Boykott vom 01. April 1933
- „Akteure“ des Boykotts
- Die Rolle der „Volksgemeinschaft“
- Hans Mommsen
- Michael Wildt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Boykottbewegungen gegen Juden in Deutschland im Jahr 1933, die als Beginn der systematischen Verfolgung angesehen werden können. Im Fokus stehen die Rolle der deutschen Gesellschaft, die Akteure der Boykottbewegungen und die Frage nach der Herkunft der Gewalt. Die Arbeit untersucht verschiedene Perspektiven und Meinungen, um ein umfassendes Bild der damaligen Situation zu zeichnen.
- Die Rolle der deutschen Gesellschaft im Kontext der Boykottbewegungen
- Die Akteure der Boykottbewegungen, sowohl aktive als auch passive
- Die Frage nach der Herkunft der Gewalt innerhalb der Boykottaktionen
- Die unterschiedlichen Perspektiven auf die Boykottbewegungen
- Die Bedeutung der „Volksgemeinschaft“ im Kontext der antisemitischen Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Boykottbewegungen gegen Juden in Deutschland im Jahr 1933 ein und stellt die zentrale Leitfrage der Arbeit: Welche Rolle hatte die deutsche Gesellschaft in Hinblick auf die Gewaltaktionen am 01. April 1933? Das zweite Kapitel beschreibt den Boykott vom 01. April 1933 als exemplarischen Fall für die Boykottbewegungen zwischen 1933 und 1935. Es werden die Aktionen im Vorfeld des Boykotts sowie die Rolle der NSDAP und der SA-Verbände beleuchtet. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den „Akteuren“ des Boykotts, wobei sowohl aktive als auch passive Akteure betrachtet werden. Es stellt sich die Frage, inwieweit und auf welche Weise die deutsche Gesellschaft an den Boykottaktionen teilnahm. Das vierte Kapitel behandelt die Rolle der „Volksgemeinschaft“ im Kontext der Boykottbewegungen und analysiert die gegensätzlichen Standpunkte von Hans Mommsen und Michael Wildt.
Schlüsselwörter
Boykottbewegung, Antisemitismus, Judenverfolgung, NS-Regime, Volksgemeinschaft, Gewaltaktionen, deutsche Gesellschaft, Akteure, Perspektiven, Hans Mommsen, Michael Wildt.
Häufig gestellte Fragen
Was geschah beim Judenboykott am 01. April 1933?
Es war eine vom NS-Regime organisierte Aktion, bei der jüdische Geschäfte, Arztpraxen und Anwaltskanzleien systematisch boykottiert und die Inhaber schikaniert wurden.
Welche Rolle spielte die deutsche Gesellschaft bei diesem Boykott?
Die Arbeit untersucht, inwieweit die Bevölkerung aktiv teilnahm oder passiv zusah und welche Verantwortung die "Volksgemeinschaft" an den Gewaltausschreitungen trägt.
Wie unterscheiden sich die Thesen von Mommsen und Wildt?
Hans Mommsen und Michael Wildt vertreten gegensätzliche Standpunkte zur Frage, ob die Gewalt eher von der Basis der Gesellschaft oder zentral gesteuert vom Regime ausging.
Wer waren die Hauptakteure der Boykottbewegungen?
Neben der NSDAP und SA-Verbänden als aktive Akteure spielten auch die passiven Zuschauer in der deutschen Gesellschaft eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Ausgrenzung.
Warum wird das Jahr 1933 als einschneidend für Juden betrachtet?
Die Boykottbewegungen von 1933 markieren den radikalen Beginn der systematischen Verfolgung und die Verschiebung des Verhältnisses von "deutsch" und "jüdisch" in der Gesellschaft.
- Quote paper
- J. C. (Author), 2016, Welche Rolle hatte die deutsche Gesellschaft in Hinblick auf die Gewaltaktionen am 01. April 1933?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320566