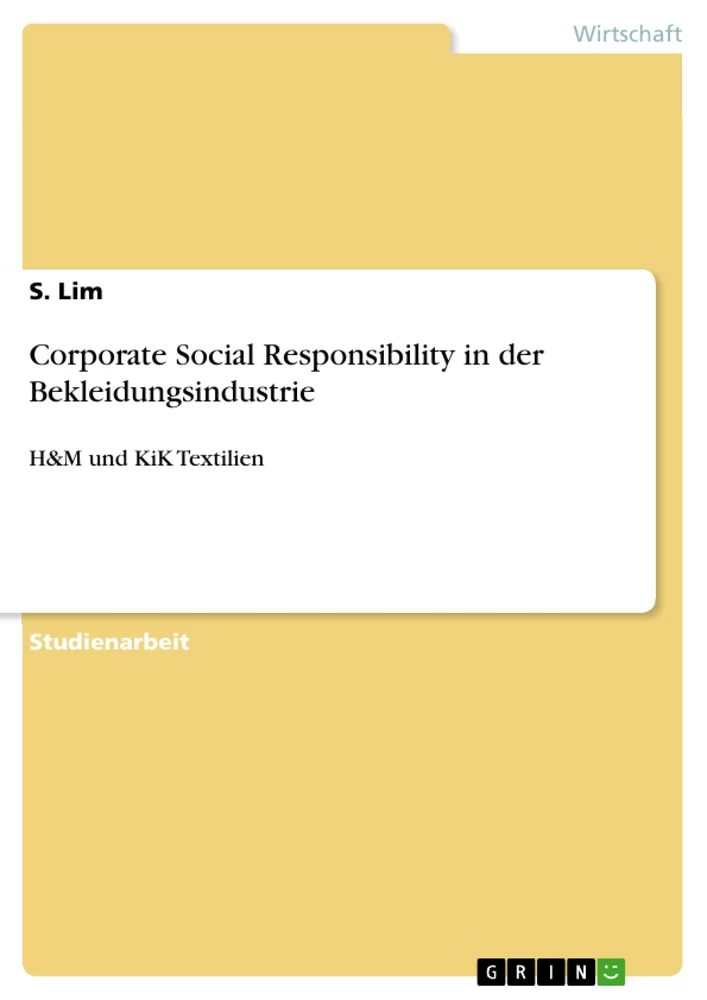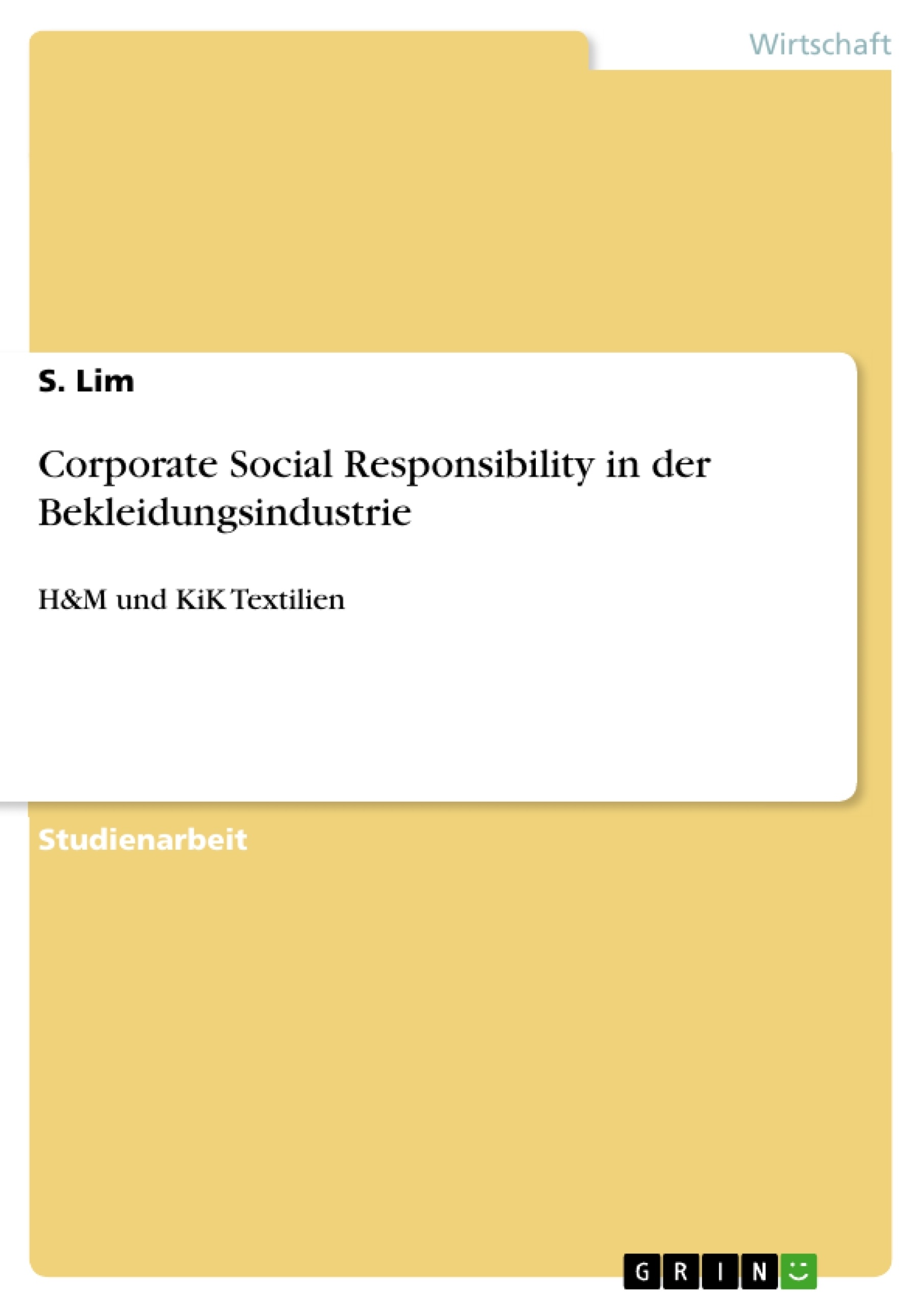Die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen gewinnt zunehmend an Bedeutung und wird in der wissenschaftlichen Literatur mit dem Begriff Corporate Social Responsibility (CSR) beschrieben. Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, inwiefern CSR in Bekleidungsunternehmen umgesetzt wird und ob es Unterschiede zwischen einem Discounter und einem höherpreisigen Handelsunternehmen gibt.
Hierfür werden zunächst die Begriffe Bekleidungsindustrie und CSR in Abgrenzung zu ähnlichen Konzepten definiert. Um einen besseren Einblick in CSR zu erhalten, wird die Bedeutung von CSR für Unternehmen erläutert, sodass im nächsten Schritt auf die möglichen Instrumente und Maßnahmen zur Erfüllung der Stakeholder-Anforderungen an die Unternehmen eingegangen wird. In Kapitel 4 erfolgt die Theorie-Praxis-Reflexion, indem die CSR-Strategien von H&M Hennes & Mauritz AB (H&M) als höherpreisiges Unternehmen und KiK Textilien und Non-Food GmbH als Textildiscounter dargestellt und in der kritischen Würdigung analysiert werden. Eine Zusammenfassung der Erkenntnisse sowie ein Ausblick bilden den Abschluss dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffliche Grundlagen
- 2.1 Begriffsdefinition Bekleidungsindustrie
- 2.2 Abgrenzung von CSR, Corporate Citizenship und Nachhaltigkeit
- 3 Grundlagen der CSR
- 3.1 Bedeutung von CSR für Unternehmen
- 3.2 Instrumente und Maßnahmen von CSR
- 4 Praxisbeispiele aus der Bekleidungsindustrie
- 4.1 Darstellung der CSR-Strategie von H&M
- 4.2 Darstellung der CSR-Strategie von KiK
- 4.3 Vergleich und kritische Würdigung
- 5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Corporate Social Responsibility (CSR) in der Bekleidungsindustrie. Sie untersucht, wie CSR in Unternehmen umgesetzt wird und ob es Unterschiede zwischen einem Discounter und einem höherpreisigen Handelsunternehmen gibt.
- Begriffsdefinition und Abgrenzung von CSR, Corporate Citizenship und Nachhaltigkeit
- Bedeutung von CSR für Unternehmen
- Instrumente und Maßnahmen von CSR
- Darstellung der CSR-Strategie von H&M und KiK
- Vergleich und kritische Würdigung der CSR-Strategien von H&M und KiK
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz von CSR in der heutigen Zeit dar und beschreibt den Hintergrund der Arbeit.
Im zweiten Kapitel werden die Begriffe Bekleidungsindustrie und CSR definiert und von ähnlichen Konzepten abgegrenzt.
Kapitel 3 beleuchtet die Bedeutung von CSR für Unternehmen und erläutert die verschiedenen Instrumente und Maßnahmen, die zur Erfüllung der Stakeholder-Anforderungen eingesetzt werden können.
Im vierten Kapitel werden die CSR-Strategien von H&M und KiK vorgestellt und miteinander verglichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Corporate Social Responsibility (CSR), Bekleidungsindustrie, Nachhaltigkeit, Stakeholder, Instrumente und Maßnahmen von CSR, sowie Praxisbeispiele aus der Bekleidungsindustrie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Corporate Social Responsibility (CSR)?
CSR beschreibt die freiwillige Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung durch Unternehmen, die über gesetzliche Anforderungen hinausgeht.
Wie unterscheiden sich CSR und Nachhaltigkeit?
Die Arbeit grenzt CSR von ähnlichen Konzepten wie Corporate Citizenship und allgemeiner Nachhaltigkeit ab, um die spezifische Unternehmensverantwortung zu klären.
Wie setzt H&M seine CSR-Strategie um?
H&M wird als Beispiel für ein höherpreisiges Unternehmen analysiert, das spezifische Instrumente zur Erfüllung von Stakeholder-Anforderungen einsetzt.
Gibt es Unterschiede bei der CSR-Umsetzung bei Discountern wie KiK?
Die Arbeit vergleicht die Ansätze von KiK mit denen von H&M und untersucht, inwieweit Preismodelle die CSR-Maßnahmen beeinflussen.
Welche Maßnahmen nutzen Bekleidungsunternehmen für CSR?
Typische Maßnahmen umfassen Arbeitsstandards in der Lieferkette, Umweltzertifikate und Berichterstattung gegenüber Stakeholdern.
- Quote paper
- S. Lim (Author), 2014, Corporate Social Responsibility in der Bekleidungsindustrie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320640