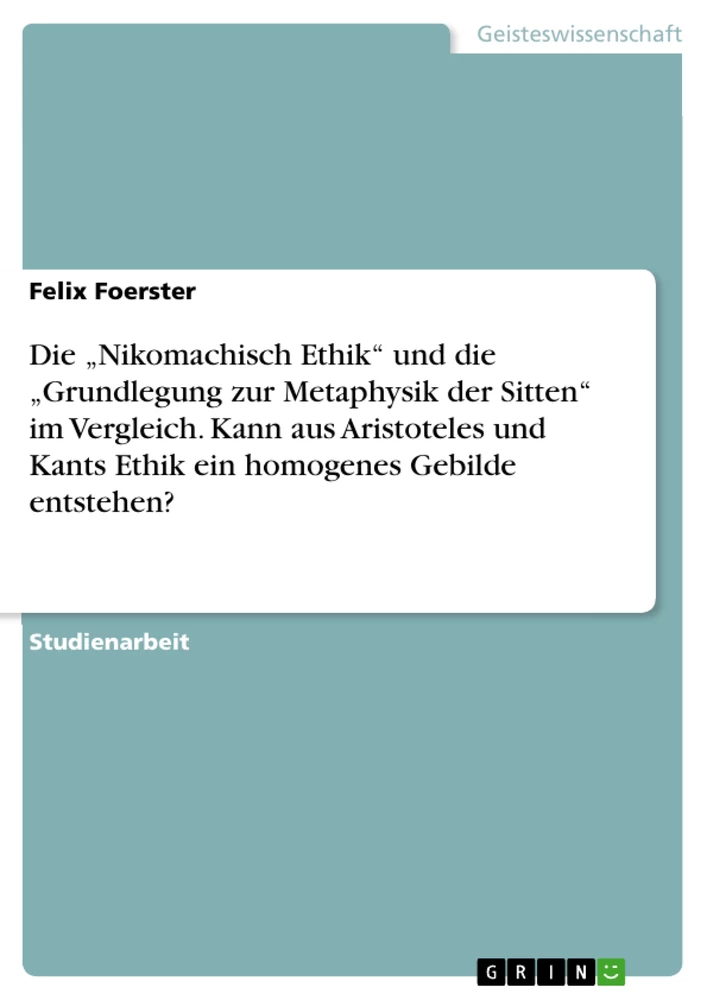In dieser Untersuchung wird geprüft, ob die „Nikomachische Ethik“ von Aristoteles und die „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ von Kant vergleichbar sind, ja sogar eine homogene Moralphilosophie bilden könnten.
Mehr als zweitausend Jahre trennen die beiden Philosophen Aristoteles, der ca. 384 v. Chr. geboren wurde, und Kant, der im Jahr 1724 zur Welt kam. Sie beide haben mit ihren philosophischen Werken Anerkennung und Würde erlangt. Und trotz der großen zeitlichen Diskrepanz ist es möglich Analogien zwischen ihren Schriften, der „Nikomachischen Ethik“ von Aristoteles und der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ von Kant, zu finden.
Aristoteles Ethik basiert auf dem Prinzip der Eudaimonia, eine Tugendlehre, die durch die Mitte von Laster und Übermaß definiert ist. Das Glück bzw. die Glückseligkeit des Menschen steht im Vordergrund. Er definiert die Glückseligkeit als, das Tätigsein der Seele gemäß der vollkommensten und besten Arete (Gutheit) und das ein ganzes Leben lang.
Wohin gegen Kants Ethik der Vernunft, Pflicht und einem autonomem Willen gewidmet ist. Dies spiegelt sich im Kategorischen Imperativ, einem synthetisch-praktischen Satz a priori, den er beweisen will, wider. Eine von mehreren Versionen des kategorischen Imperativs lautet: „ (…) handle in Beziehung auf ein jedes vernünftige Wesen (auf dich selbst und andere) so, daß es in deiner Maxime zugleich als Zweck an sich selbst gelte (...).“(GMS 438).
Um die Analogien besser nachvollziehen zu können, wird Schritt für Schritt jeder einzelne Begriff geprüft und verglichen. Bei fast keiner Definition der Termini ist die Herleitung oder Gewichtung für die jeweilige Moralphilosophie dieselbe. Deshalb werden die Untersuchungen derselben Wörter, trotz meiner Meinung nach ähnlicher Akzentuierungen, unterschiedlich lange sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Vernunft
- Die Vernunft bei Aristoteles
- Die Vernunft bei Kant
- Die Vernunft im Vergleich
- Das „Gute“
- Das „Gute“ bei Aristoteles
- Das „Gute“ bei Kant
- Das „Gute“ im Vergleich
- Die Glückseligkeit
- Die „Eudiamonia“ bei Aristoteles
- Die Tugendlehre
- Die Glückseligkeit bei Aristoteles
- Die Glückseligkeit bei Kant
- Die Glückseligkeit im Vergleich
- Die „Eudiamonia“ bei Aristoteles
- Die Pflicht
- Die Pflicht bei Kant
- Die Definition von Pflicht
- Der Unterschied von „hypothetischem“ und „kategorischem“ Imperativ
- Die Rolle der Pflicht bei Kant
- Die Pflicht und Freiheit bei Aristoteles
- Die Pflicht bei Aristoteles
- Die Pflicht im Vergleich
- Die Pflicht bei Kant
- Die Freiheit
- Die Freiheit bei Aristoteles
- Die Freiheit bei Kant
- Die Freiheit im Vergleich
- Die Moralphilosophie im Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob die „Nikomachische Ethik“ von Aristoteles und die „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ von Kant vergleichbar sind und ob sie eine homogene Moralphilosophie bilden könnten.
- Die Rolle der Vernunft in der Ethik von Aristoteles und Kant
- Die Bedeutung des „Guten“ in beiden Werken
- Die Konzepte von Glückseligkeit und Pflicht bei Aristoteles und Kant
- Der Zusammenhang von Freiheit und Pflicht in den beiden Ethiken
- Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Moralphilosophien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und skizziert die wichtigsten Analogien zwischen der Ethik von Aristoteles und Kant. Es werden die zentralen Begriffe der beiden Philosophen, wie Vernunft, Freiheit, Glückseligkeit und Pflicht, kurz vorgestellt.
Das Kapitel über die Vernunft analysiert die Rolle der Vernunft in den beiden Werken, wobei Aristoteles' Ergon-Argument im Fokus steht. Es wird untersucht, ob die Vernunft bei Aristoteles und Kant eine vergleichbare Rolle spielt.
Das Kapitel über das „Gute“ befasst sich mit der Idee des „Guten“ bzw. des „Guten Willens“ bei Aristoteles und Kant. Es wird untersucht, wie das „Gute“ in beiden Werken definiert wird und welche Bedeutung es für die Ethik hat.
Das Kapitel über die Glückseligkeit analysiert die Konzepte von „Eudiamonia“ bei Aristoteles und Glückseligkeit bei Kant. Es wird untersucht, wie die beiden Philosophen Glückseligkeit definieren und welche Rolle sie für das gute Leben spielt.
Das Kapitel über die Pflicht untersucht die Konzepte von Pflicht bei Kant und die Verbindung von Pflicht und Freiheit bei Aristoteles. Es wird untersucht, wie die beiden Philosophen Pflicht definieren und welche Rolle sie in ihren Ethiken spielt.
Das Kapitel über die Freiheit analysiert die Konzepte von Freiheit bei Aristoteles und Kant. Es wird untersucht, wie die beiden Philosophen Freiheit verstehen und welche Bedeutung sie für die Ethik hat.
Das Kapitel über die Moralphilosophie im Vergleich untersucht, ob die Ethiken von Aristoteles und Kant trotz ihrer grundlegenden Verschiedenheit ein homogenes Gebilde abgeben können. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Moralphilosophien aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Vernunft, „Gutes“, Glückseligkeit, Pflicht und Freiheit in den Werken von Aristoteles und Kant. Es werden die jeweiligen Definitionen und die Rolle dieser Begriffe in den beiden Moralphilosophien analysiert und verglichen.
Häufig gestellte Fragen
Lassen sich die Ethiken von Aristoteles und Kant vereinen?
Die Arbeit untersucht, ob trotz über 2000 Jahren Zeitunterschied Analogien bestehen. Während beide nach einer Moralphilosophie suchen, unterscheiden sich ihre Ansätze (Tugendethik vs. Pflichtethik) in Herleitung und Gewichtung stark.
Was ist der Kern von Aristoteles' "Eudaimonia"?
Eudaimonia (Glückseligkeit) ist das höchste Gut und wird durch ein Tätigsein der Seele gemäß der vollkommensten Tugend (Arete) definiert. Es geht um die "Mitte" zwischen den Lastern.
Wie unterscheidet sich Kants Begriff der Pflicht von Aristoteles?
Für Kant ist Handeln aus Pflicht der Kern der Moral, geleitet durch den Kategorischen Imperativ. Bei Aristoteles ist Tugend eher eine Charaktereigenschaft, die durch Gewöhnung und Einsicht zur richtigen Handlung führt.
Welche Rolle spielt die Vernunft in beiden Werken?
Beide sehen die Vernunft als zentral an. Aristoteles nutzt das Ergon-Argument (die spezifische Funktion des Menschen), während Kant die Vernunft als Quelle des autonomen Willens und des moralischen Gesetzes betrachtet.
Was ist der "Kategorische Imperativ"?
Es ist Kants oberstes Prinzip der Moral: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Er dient als objektives Prüfverfahren für moralisches Handeln.
- Arbeit zitieren
- Felix Foerster (Autor:in), 2015, Die „Nikomachisch Ethik“ und die „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ im Vergleich. Kann aus Aristoteles und Kants Ethik ein homogenes Gebilde entstehen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320652