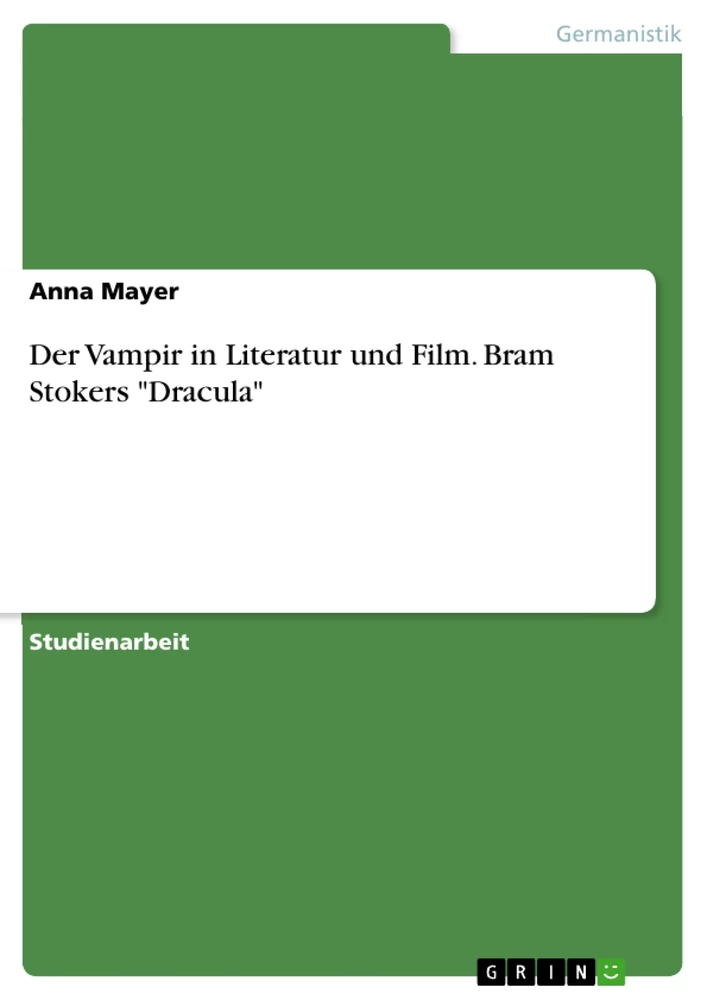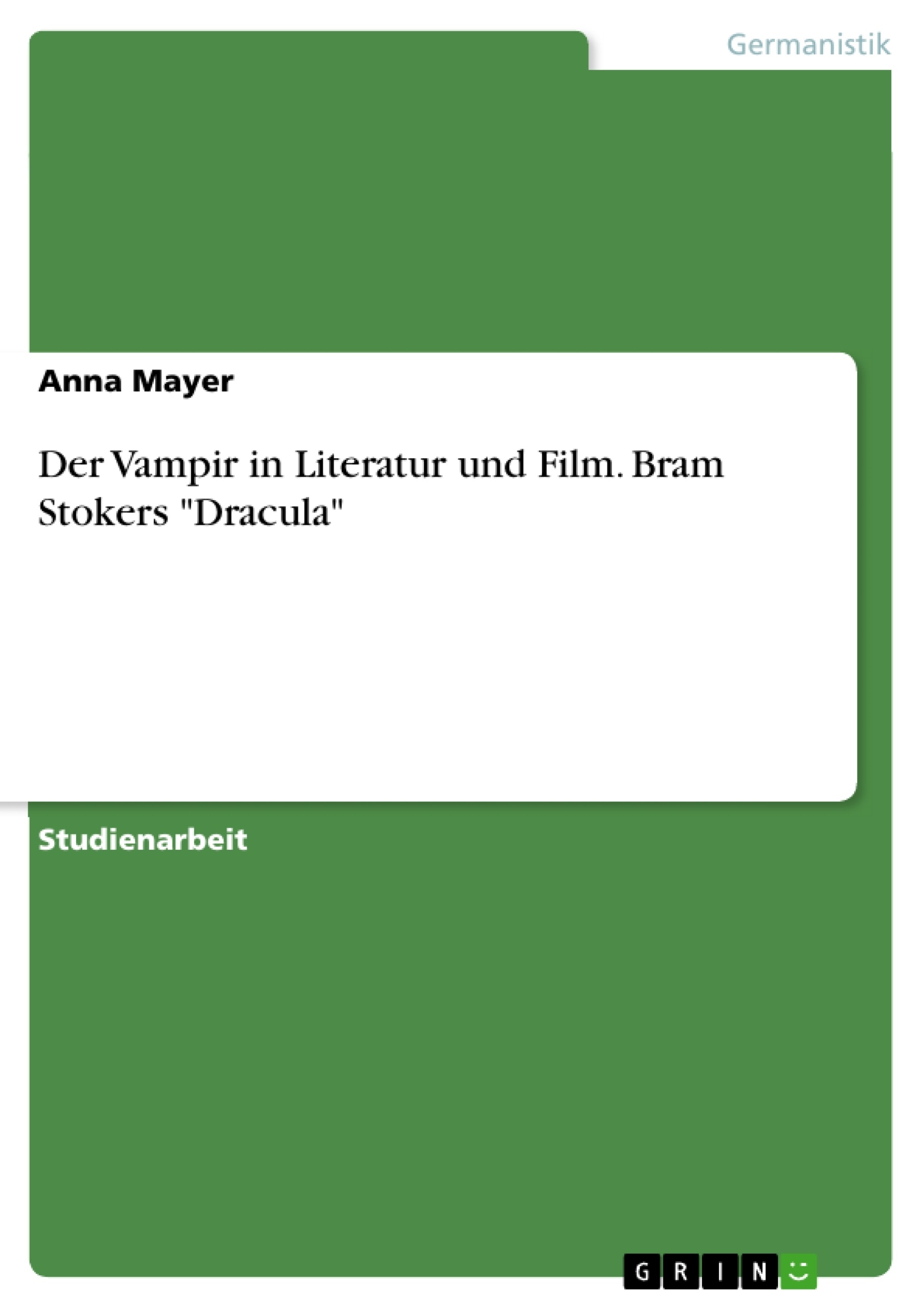Im ersten Abschnitt geht es um den Inhalt von Bram Stokers Roman "Dracula". Dieser soll anhand der wichtigsten Passagen des Romans näher besprochen werden und anhand von diesen genauer ausgeführt werden. Die Protagonisten und ihre Intentionen sollen vorgestellt werden. Die wichtigsten Figuren, die im Roman vorkommen, sollen analysiert und ihre Rolle für den Verlauf der Handlung soll untersucht werden.
Der zweite Teil der Arbeit setzt es sich zum Ziel den Aufbau des Textes näher zu betrachten. Das Wie steht hier im Vordergrund. Es soll aufgezeigt werden, welche verschiedenen Textgestalten der Roman präsentiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhalt
- Die Ereignisse auf Burg Dracula
- Mina und Lucy, die beiden konträren Frauenfiguren des Romans
- Minas Tagebuch und die Ereignisse in Whitby
- Lucys Krankheit und ihre Vernichtung
- Die Suche nach Dracula
- Draculas Angriff auf Mina
- Draculas Flucht, seine Verfolgung und Vernichtung
- Aufbau
- Jonathan Harkers Tagebuch
- Briefwechsel zwischen Mina Murry und Lucy Westenra
- Tagebucheintragungen Minas über die Ereignisse in Whitby
- Phonographische Aufzeichnungen/Tagebuch von Dr. Seward
- Jonathan Harkers letzte Notiz
- Zum zeitlichen Aufbau des Textes
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Bram Stokers Roman "Dracula", indem sie zunächst den Inhalt und die wichtigsten Figuren, insbesondere Mina und Lucy, untersucht. Es werden verschiedene Forschungstheorien zu den Geschlechterrollen im Roman vorgestellt und kritisch bewertet. Im zweiten Teil steht der Aufbau des Romans im Fokus, wobei die verschiedenen Erzählperspektiven und die zeitliche Struktur analysiert werden.
- Inhaltliche Analyse von Bram Stokers "Dracula"
- Untersuchung der weiblichen Figuren Mina und Lucy und ihrer Bedeutung
- Analyse der Geschlechterrollen im Roman
- Erforschung der verschiedenen Erzählperspektiven
- Analyse der zeitlichen Struktur des Romans
Zusammenfassung der Kapitel
2.1 Die Ereignisse auf Burg Dracula: Das Kapitel beginnt mit Jonathan Harkers Tagebuchaufzeichnungen, der von seinem Vorgesetzten nach Transsylvanien geschickt wird, um mit Graf Dracula einen Immobilienkaufvertrag zu besiegeln. Schon auf dem Weg dorthin erhält er unheilvolle Warnungen von Einheimischen. Auf der Burg erlebt er zunächst einen scheinbar normalen Aufenthalt, doch nach und nach fallen ihm seltsame Vorkommnisse auf: Abwesenheit von Spiegeln, das Fehlen von Dienerschaft, das geheimnisvolle Verhalten Draculas und die zunehmende Einschränkung seiner Bewegungsfreiheit. Jonathan wird zum Gefangenen, der seine Erfahrungen minutiös in seinem Tagebuch festhält, um den drohenden Wahnsinn zu bekämpfen. Die Beschreibungen schaffen eine Atmosphäre von wachsenden Unbehagen und Hilflosigkeit.
Schlüsselwörter
Bram Stoker, Dracula, Vampirroman, Geschlechterrollen, Viktorianische Ära, Erzählperspektiven, zeitliche Struktur, Mina Harker, Lucy Westenra, Transsilvanien.
Häufig gestellte Fragen zu Bram Stokers "Dracula" - Inhaltsübersicht
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Bram Stokers Roman "Dracula". Der Fokus liegt auf der inhaltlichen Analyse, der Untersuchung der weiblichen Figuren Mina und Lucy, der Analyse der Geschlechterrollen, der Erforschung der Erzählperspektiven und der Analyse der zeitlichen Struktur des Romans. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Inhaltsangabe, eine Beschreibung des Aufbaus, eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste von Schlüsselbegriffen.
Welche Themen werden im Roman "Dracula" behandelt?
Die Arbeit untersucht verschiedene Themen, darunter die Ereignisse auf Burg Dracula, die Gegenüberstellung der Frauenfiguren Mina und Lucy, Minas Tagebucheinträge und die Geschehnisse in Whitby, Lucys Krankheit und Tod, die Suche nach Dracula, Draculas Angriff auf Mina, Draculas Flucht und Vernichtung. Zusätzlich werden die Geschlechterrollen im viktorianischen Kontext und der Einfluss der verschiedenen Erzählperspektiven analysiert.
Welche Kapitel werden in der Zusammenfassung behandelt?
Die Zusammenfassung konzentriert sich zunächst auf die Ereignisse auf Burg Dracula, basierend auf Jonathan Harkers Tagebuchaufzeichnungen. Weitere Kapitel behandeln die Charaktere Mina und Lucy, sowie die Analyse ihrer Rolle im Roman. Die Zusammenfassung beinhaltet ebenfalls eine Analyse des Aufbaus des Romans, einschließlich der verschiedenen Erzählformen (Tagebücher, Briefe, Aufzeichnungen).
Wie ist der Roman aufgebaut?
Der Roman verwendet verschiedene Erzählperspektiven und -formen: Jonathan Harkers Tagebuch, den Briefwechsel zwischen Mina und Lucy, Minas Tagebucheinträge, die phonographischen Aufzeichnungen von Dr. Seward und schließlich Jonathan Harkers letzte Notiz. Die Analyse des Aufbaus konzentriert sich auf diese verschiedenen Perspektiven und die zeitliche Struktur des Romans.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Roman und die Analyse?
Die Schlüsselwörter umfassen: Bram Stoker, Dracula, Vampirroman, Geschlechterrollen, Viktorianische Ära, Erzählperspektiven, zeitliche Struktur, Mina Harker, Lucy Westenra, Transsilvanien.
Welche Figuren werden besonders untersucht?
Die Arbeit untersucht insbesondere die weiblichen Figuren Mina und Lucy Westenra und deren konträren Charaktere und Rollen im Roman. Ihre Bedeutung im Kontext der Geschlechterrollen der viktorianischen Ära wird analysiert.
Welche Zielsetzung verfolgt diese Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Bram Stokers "Dracula" durch eine eingehende inhaltliche und strukturelle Analyse zu verstehen. Dabei werden insbesondere die Geschlechterrollen und die verschiedenen Erzählperspektiven beleuchtet und kritisch bewertet.
Welche Forschungsansätze werden verwendet?
Die Arbeit präsentiert und bewertet verschiedene Forschungstheorien zu den Geschlechterrollen im Roman. Die genauen Ansätze werden im Haupttext detailliert erläutert.
- Quote paper
- Anna Mayer (Author), 2016, Der Vampir in Literatur und Film. Bram Stokers "Dracula", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320722