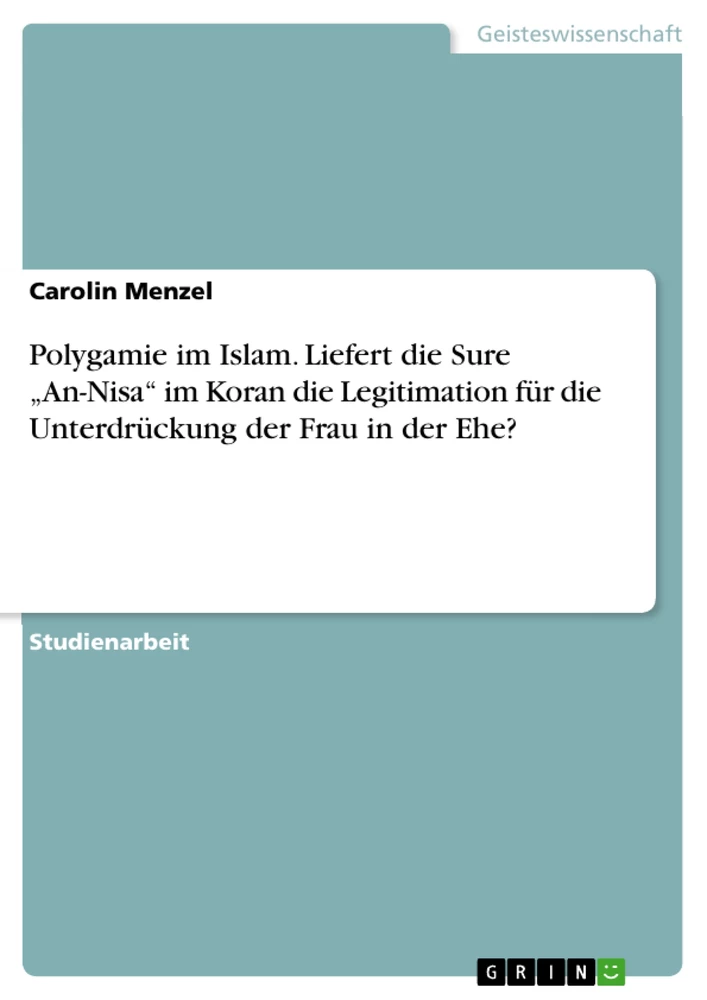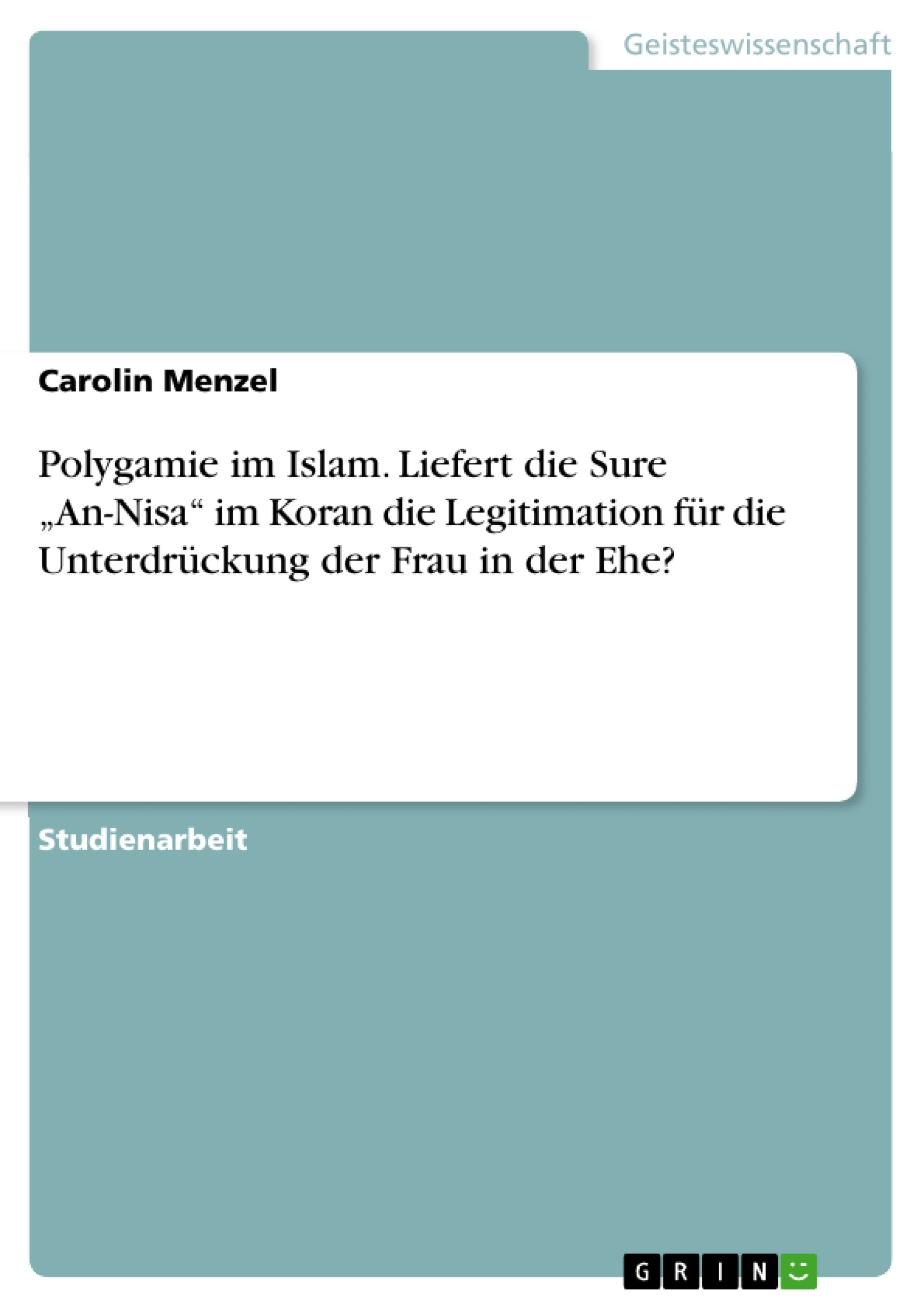In dieser Arbeit soll der Umgang des Islams mit der Polygamie beleuchtet werden. Ist das Vorrecht dem Mann von Gott gegeben, dass ihm seine Ehefrauen bedingungslos ausgeliefert sind und von seiner Willkür ihr ganzes Leben abhängen?
Vorangestellt soll die Polygamie als solches definiert und in ihren anfänglichen Formen erläutert werden, um eine erste Orientierung zu schaffen, in welchem Kulturkreis und welcher Weltauffassung man sich bewegt. Anschließend wird Bezug zu dem Koran hergestellt, um zuletzt kurz auf die heutige Lage und Tunesiens Wandel einzugehen.
Polygamie – oft bekommt man dieses Wort zu hören, zumeist mit gefestigten negativen Meinungen dahinter und allenfalls mit dem Islam in Verbindung gebracht. Doch Polygamie ist keinesfalls eine Erfindung des Islams, sondern eine schon Jahrhunderte zuvor praktizierte Eheform, was die westliche Welt gekonnt außer Acht lässt. Von dem Islam aufgegriffen und im Koran verankert wird sie bis in unsere heutige Zeit praktiziert. Doch kann sich die islamische Rechtsschule gegen Kritiken wehren, die besagen, dass er mit seiner Polygamie die Frauen bewusst unterdrücke? Und wie ist der gesetzliche Beschluss bezüglich des Umgangs mit Eheformen in nicht laizistischen Staaten?
Vielerorts werden die Missstände unter Einfluss des Westens erkannt und einer Unterdrückung der Frau durch den Koran entgegengetreten. Prototyp eines solchen Landes ist Tunesien. Reformer haben besonders im 20. Jahrhundert stark für Frauen gekämpft und die Schaffung eines sozialeren Systems erwirkt. Die größte Errungenschaft ihres Wirkens ist das offizielle Verbot der Polygamie in der tunesischen Verfassung.
- Quote paper
- Carolin Menzel (Author), 2016, Polygamie im Islam. Liefert die Sure „An-Nisa“ im Koran die Legitimation für die Unterdrückung der Frau in der Ehe?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320784