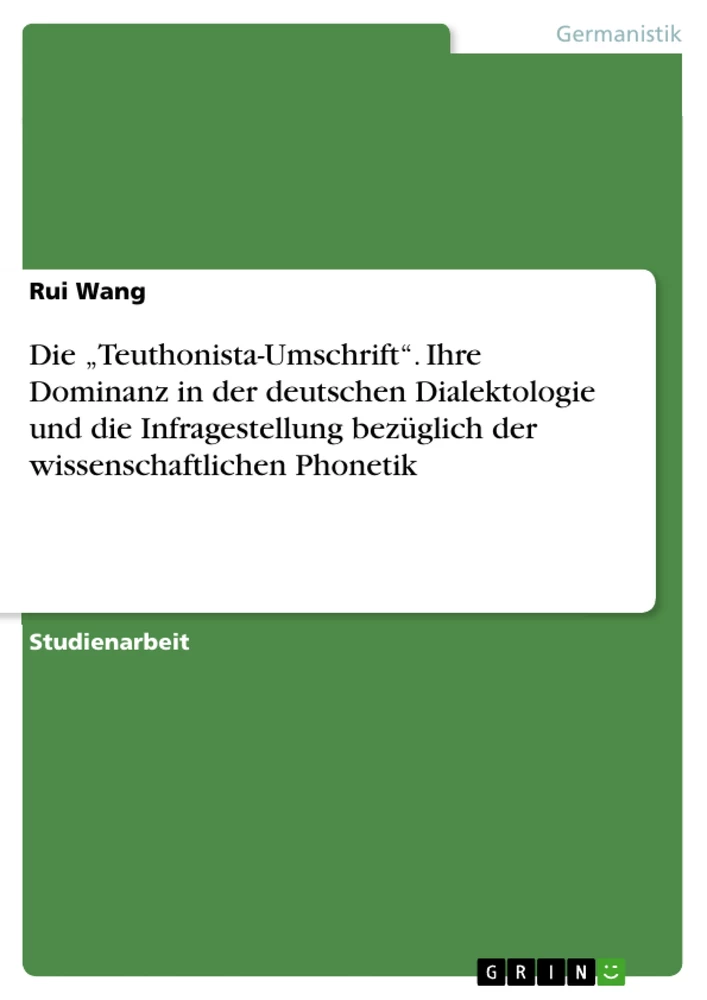Für die Dialektforschung spielt das Transkriptionssystem eine wichtige Rolle, die akustischen Formen der Sprache möglichst detailliert zu verschriftlichen. Zwar kann man mit dem Alphabet der Standardsprache manche lautlichen Verhältnisse darstellen, aber es gibt mehr Laute als Buchstaben, d.h. die Buchstaben können mehrere Laute vertreten. Es ist daher notwendig, die Transkriptionssysteme zu entwickeln.
Seit dem sechzehnten Jahrhundert wurden zahlreiche Transkriptionssysteme entworfen, die allerdings nicht in weiteren Kreisen verbreitet wurden. Deswegen werde ich am Anfang des zweiten Kapitels die Anforderungen an phonetischer Umschrift darstellen, um zu erklären, warum die ehemaligen Transkriptionssysteme nicht durchgesetzt werden konnten. Der große Teil des Kapitels zwei beschäftigt sich um die Darstellung der verschiedenen Transkriptionsmöglichkeiten. Es gibt zwei unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Transkription, nämlich phonetische und phonologische Lautumschreibung.
In Kapitel drei geht es um die Frage, warum die Teuthonista in der deutschen Dialektologie weit verbreitet ist. Zuerst werde ich von der Entwicklungsgeschichte der Teuthonista ausgehen, um zu erklären, warum die Teuthonista mit historischer Rücksicht eingehalten werden soll. Anschließend handelt es sich um die Ablehnung der API-Transkription durch die deutsche Dialektologie. Dazu werde ich hauptsächlich die im API selbst verankerten Gründe darstellen. Dann geht es um die praktischen Vorteile der Teuthonista für die Feldforschung, die von Ruoff (1973) zusammengefasst werden. Zum Schluss dieses Kapitels werde ich ein Beispiel des Siebenbürgisch-Sächsischen Wörterbuch einführen, in denen einige von der Teuthonista abweichende Symbolisierungen vorkommen.
In Kapitel vier geht es um die Infragestellung in Bezug auf die wissenschaftliche Phonetik. Zuerst werde ich das Theorie-Defizit der Teuthonista untersuchen.
Zum Schluss geht es um die immer größere Verbreitung der API-System, besonders um die auf deutsche Verhältnisse abgefasste neue API-Lautschrift.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die bisherigen Umschriftsysteme und ihre Grenzen
- Phonetische und phonologische Lautumschrift
- Organisch-nichtalphabetischen und die Auditiv-alphabetischen Systeme
- Die ,,Teuthonista-Umschrift\" in der deutschen Dialektologie
- Die Entwicklungsgeschichte der Teuthonista
- Ablehnung der API-Transkription durch die deutsche Dialektologie
- Teuthonista in der Feldforschung
- Anwendung der Teuthonista am Beispiel des Siebenbürgisch-Sächsischen Wörterbuchs
- Der Vergleich zwischen Teuthonista- und API-System
- Theorie-Defizit der Teuthonista
- PHONAI- Deutsche Reihe
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Dominanz der „Teuthonista-Umschrift“ in der deutschen Dialektologie und deren Infragestellung bezüglich der wissenschaftlichen Phonetik. Sie analysiert die Entwicklung und Verbreitung der Teuthonista, beleuchtet die Gründe für die Ablehnung des Internationalen Phonetischen Alphabets (API) und untersucht die theoretischen Defizite der Teuthonista im Vergleich zum API.
- Entwicklungsgeschichte der Teuthonista-Umschrift
- Vergleich zwischen Teuthonista und API-System
- Theorie-Defizit der Teuthonista
- Anforderungen an ein phonetisches Transkriptionssystem
- Praktische Anwendung der Teuthonista in der Feldforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Dialektforschung und die Bedeutung von Transkriptionssystemen ein. Sie erläutert die Notwendigkeit der Entwicklung von Transkriptionssystemen und stellt die verschiedenen Arten von Lautumschreibungen vor, die in der Vergangenheit verwendet wurden.
Kapitel zwei untersucht die bisherigen Umschriftsysteme und ihre Grenzen. Es werden die phonetische und phonologische Lautumschrift sowie die organisch-nichtalphabetischen und auditiv-alphabetischen Systeme vorgestellt und analysiert.
Kapitel drei konzentriert sich auf die Teuthonista-Umschrift in der deutschen Dialektologie. Es beleuchtet die Entwicklungsgeschichte der Teuthonista, die Gründe für die Ablehnung des API und die praktischen Vorteile der Teuthonista in der Feldforschung.
Kapitel vier widmet sich dem Vergleich zwischen Teuthonista und API-System. Es analysiert die theoretischen Defizite der Teuthonista und beleuchtet die wachsende Verbreitung des API-Systems in der deutschen Sprachwissenschaft.
Schlüsselwörter
Teuthonista-Umschrift, API-Transkription, phonetische Lautumschrift, phonologische Lautumschrift, deutsche Dialektologie, wissenschaftliche Phonetik, Feldforschung, Transkriptionssystem, Lautumschreibung, Theorie-Defizit, Sprachwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Teuthonista-Umschrift“?
Die Teuthonista ist ein spezielles Transkriptionssystem, das in der deutschen Dialektologie verwendet wird, um lautliche Feinheiten von Dialekten detaillierter als mit der Standardschrift festzuhalten.
Warum wird das internationale API-System in der deutschen Dialektologie oft abgelehnt?
Die Ablehnung begründet sich oft durch historische Traditionen in der deutschen Forschung sowie durch spezifische praktische Vorteile der Teuthonista bei der Feldforschung.
Was ist der Unterschied zwischen phonetischer und phonologischer Lautumschrift?
Die phonetische Umschrift zielt auf die exakte akustische Wiedergabe der Laute ab, während die phonologische Umschrift nur die bedeutungsunterscheidenden Merkmale (Phoneme) berücksichtigt.
Welche theoretischen Defizite weist die Teuthonista auf?
Kritiker bemängeln ein fehlendes einheitliches theoretisches Fundament im Vergleich zur wissenschaftlich fundierten Phonetik des API-Systems.
In welchem bekannten Werk wird die Teuthonista beispielsweise angewendet?
Ein Anwendungsbeispiel ist das Siebenbürgisch-Sächsische Wörterbuch, wobei dort teilweise Abweichungen von der Standard-Teuthonista vorkommen.
Gibt es eine Annäherung zwischen den Systemen?
Ja, es gibt Bestrebungen, wie die neue API-Lautschrift, die speziell auf deutsche Verhältnisse angepasst wurde, um die Vorteile beider Ansätze zu vereinen.
- Quote paper
- Rui Wang (Author), 2014, Die „Teuthonista-Umschrift“. Ihre Dominanz in der deutschen Dialektologie und die Infragestellung bezüglich der wissenschaftlichen Phonetik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320812