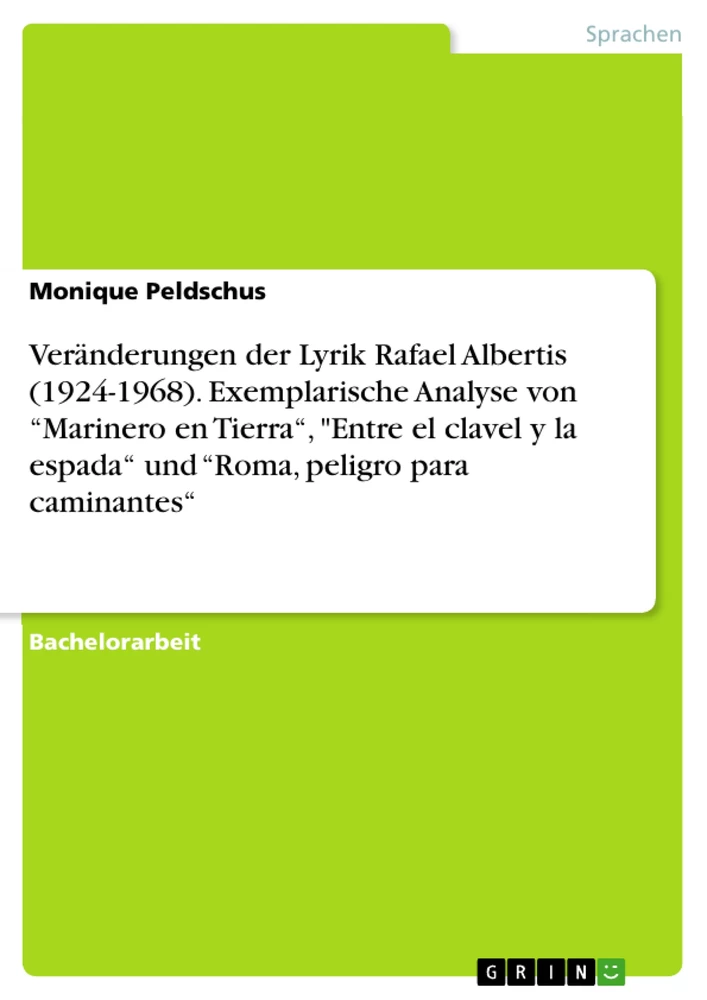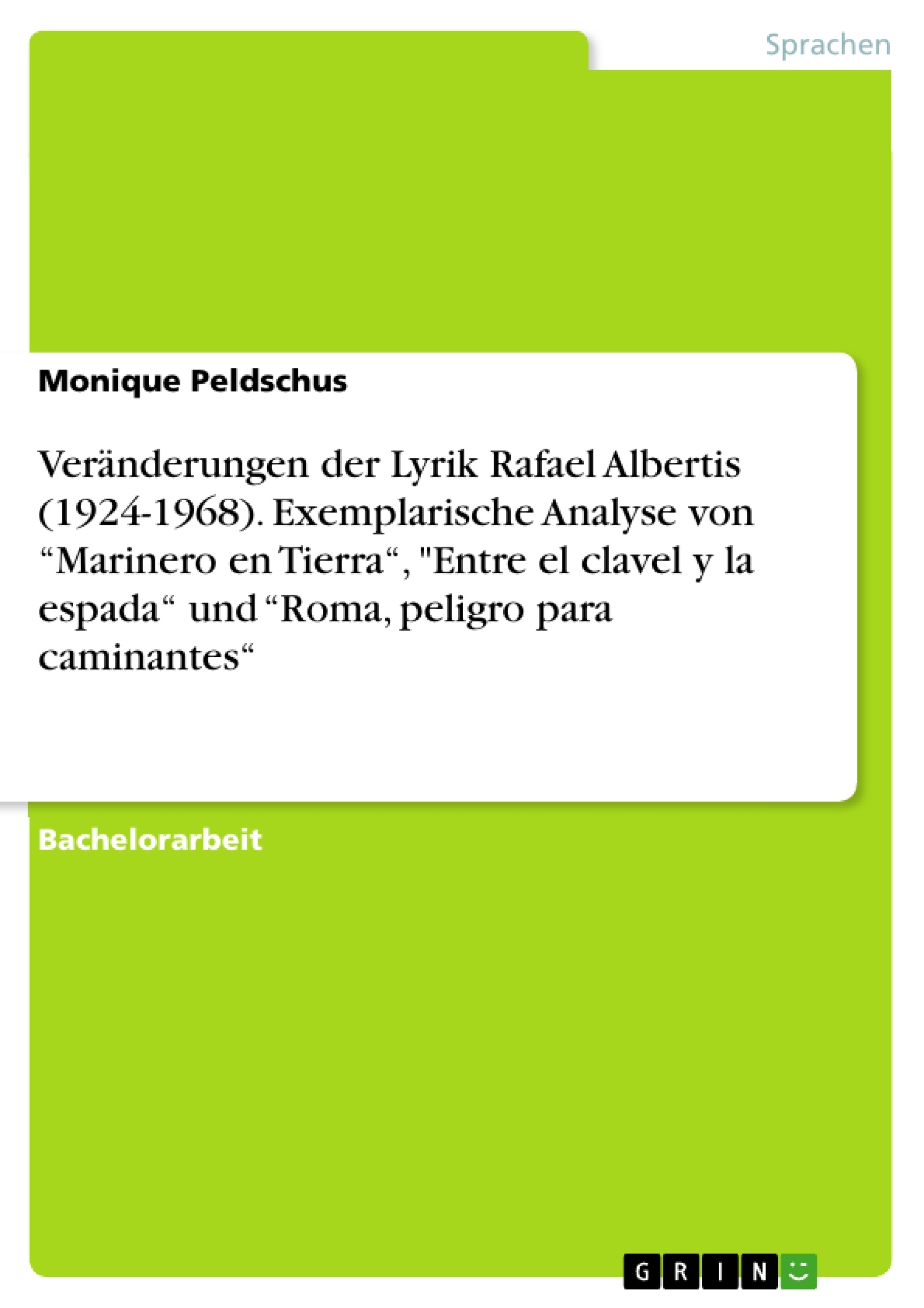Rafael Alberti war einer der bedeutendsten spanischen Dichter des 20. Jahrhunderts. Aufgrund seines hohen Alters durchlebte er turbulente Zeiten. Er erfuhr den Einfluss der Avantgarde, war Mitglied der spanischen Dichtergeneration der zwanziger Jahre und litt unter dem spanischen Bürgerkrieg. Aus dem argentinischen Exil heraus wurde er stiller Zeuge der Weltkriege und kehrte erst nach 37 Jahren wieder in seine Heimat zurück.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll die Veränderung der Lyrik Rafael Albertis zwischen 1924 und 1968 aufgezeigt werden. Nach einer kurzen Biografie, einer Erklärung seines dichterischen Stils und einer Beleuchtung seines Lebens im Exil folgen detaillierte Analysen der Werke „Marinero en Tierra“, „Entre el clavel y la espada“ und „Roma, peligro para caminantes“. Als Grundlage dienen jeweils drei, beziehungsweise fünf Gedichte, welche aus verschiedenen Kapiteln der jeweiligen Werke ausgewählt wurden, um so ein Spektrum dieser aufzufächern und die komplexe Thematik greifbar zu machen.
Mit Hilfe einer ausführlichen Schlussbemerkung sollen die Analyseergebnisse zusammen getragen werden und Unterschiede, sowie Gemeinsamkeiten der Werke, aus welchen die Veränderungen der Lyrik des Poeten hervorgehen, werden herausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Rafael Alberti (1902 - 1999): Eine kurze Biografie
- II.I. Der dichterische Stil
- II.II. Das Leben im Exil
- III. Die Sehnsucht nach dem Meer in "Marinero en Tierra"
- III.I Der Aufbau
- III.II Stil
- III.III Zentrale Thematik
- III.IV Analyse
- III.V Zusammenfassung
- IV. Das Leben Albertis im argentinischen Exil „Entre el clavel y la espada“
- IV.I Aufbau und Darstellung der Thematik
- IV.II Analyse
- IV.III Zusammenfassung
- V. Poesía del destierro: "Roma, peligro para caminantes"
- V.I Aufbau und Darstellung der Thematik
- V.II Analyse
- V.III Zusammenfassung
- VI. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Veränderung der Lyrik Rafael Albertis zwischen 1924 und 1968. Sie analysiert die Werke „Marinero en Tierra“, „Entre el clavel y la espada“ und „Roma, peligro para caminantes“, um ein Spektrum der dichterischen Entwicklung Albertis aufzuzeigen.
- Die Entwicklung des dichterischen Stils Albertis in verschiedenen Epochen
- Die Auswirkungen des spanischen Bürgerkriegs und des Exils auf Albertis Werk
- Die Rolle des Meeres und der Heimat in Albertis Poesie
- Die Auseinandersetzung mit politischen und gesellschaftlichen Themen in Albertis Lyrik
- Die Veränderungen in Albertis Umgang mit Sprache und Form
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über das Leben und Werk Rafael Albertis sowie die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit.
Kapitel II gibt einen kurzen Einblick in das Leben Albertis, seine frühen Jahre und seine Erfahrungen während des Bürgerkriegs und des Exils.
Kapitel III analysiert das Werk „Marinero en Tierra“, das Albertis Sehnsucht nach dem Meer und seiner Heimat thematisiert.
Kapitel IV beleuchtet das Werk „Entre el clavel y la espada“, das die Zeit des Bürgerkriegs und die ersten Jahre im argentinischen Exil Albertis widerspiegelt.
Kapitel V untersucht das Werk „Roma, peligro para caminantes“, das aus der Perspektive des italienischen Exils geschrieben wurde.
Schlüsselwörter
Rafael Alberti, spanische Lyrik, Bürgerkrieg, Exil, Meer, Heimat, politische Poesie, Avantgarde, Generación del '27, „Marinero en Tierra“, „Entre el clavel y la espada“, „Roma, peligro para caminantes“
Häufig gestellte Fragen
Wer war Rafael Alberti?
Rafael Alberti (1902–1999) war einer der bedeutendsten spanischen Dichter des 20. Jahrhunderts und ein wichtiges Mitglied der "Generación del '27". Sein Werk wurde stark durch den Bürgerkrieg und sein langes Exil geprägt.
Welche Bedeutung hat das Meer in seinem Werk "Marinero en Tierra"?
Das Meer steht in diesem frühen Werk für die Sehnsucht nach seiner Heimat Cádiz und symbolisiert eine verlorene Unschuld sowie die emotionale Verbindung zur Natur.
Wie beeinflusste das Exil seine Lyrik?
In Werken wie "Entre el clavel y la espada" wird die Lyrik düsterer und politischer. Sie reflektiert den Schmerz über den Verlust der Heimat und die Erfahrungen des spanischen Bürgerkriegs.
Was thematisiert Alberti in "Roma, peligro para caminantes"?
Dieses Werk entstand während seines Aufenthalts in Italien und befasst sich mit der Rolle des Dichters in der Fremde sowie der Beobachtung einer fremden Stadt aus der Perspektive des Exilanten.
Wie wandelte sich Albertis Stil über die Jahrzehnte?
Sein Stil entwickelte sich von einer spielerischen, volksliednahen Avantgarde hin zu einer engagierten, teils surrealistischen und später melancholischen Exillyrik, die formale Strenge mit emotionaler Tiefe verbindet.
- Citar trabajo
- Monique Peldschus (Autor), 2015, Veränderungen der Lyrik Rafael Albertis (1924-1968). Exemplarische Analyse von “Marinero en Tierra“, "Entre el clavel y la espada“ und “Roma, peligro para caminantes“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320820