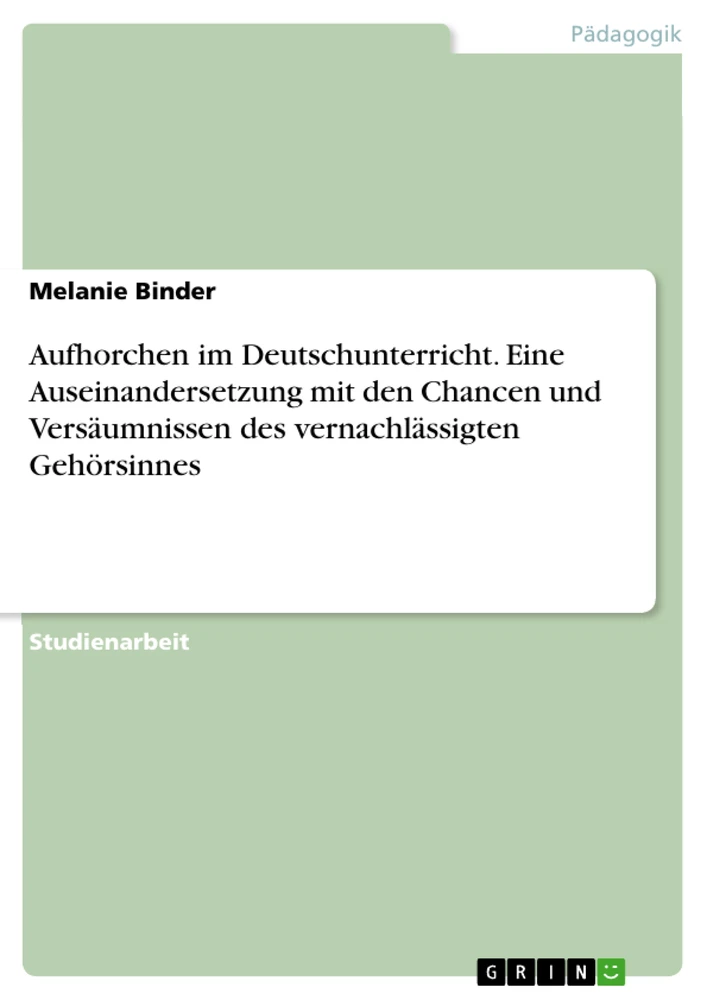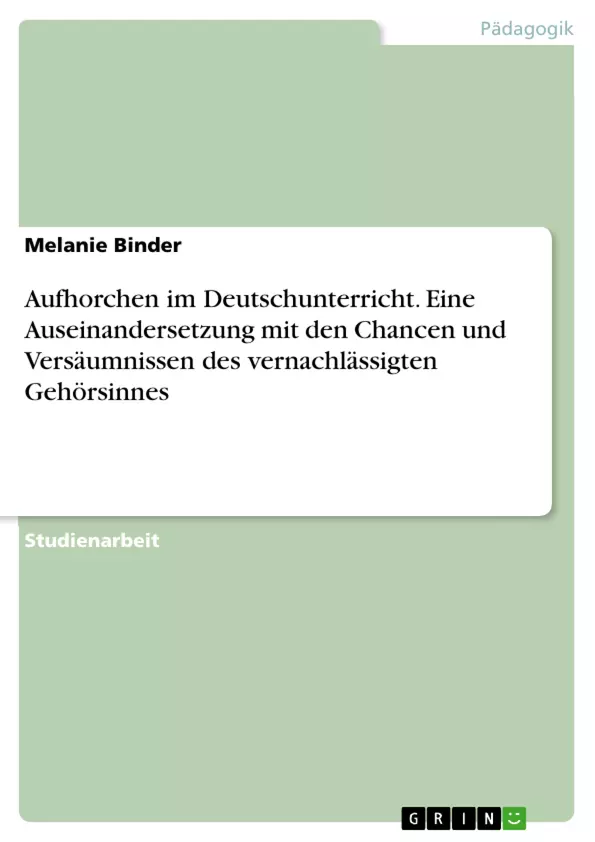Die vorliegende Seminararbeit entstand im Rahmen der Lehrveranstaltung SE Sprechen und Hören in einem integrativen Deutschunterricht. Die Seminararbeit soll eine vertiefende Auseinandersetzung mit der Thematik ermöglichen und veranschaulichen.
Wieso sind Hörübungen im Fremdsprachenunterricht ein essentieller Bereich und im muttersprachlichen Bereich hingegen nahezu überhaupt nicht? Wieso sind Vorträge (egal ob im schulischen oder außerschulischen Bereich) ohne visuelle Veranschaulichung so sehr verpönt und überhaupt nicht mehr vorstellbar? Sind Schulungen des auditiven Bereiches im Deutschunterricht vom Lehrplan überhaupt vorgesehen?
All diese Fragen habe ich versucht in eine Seminararbeit zu verpacken, die ein möglichst breites Spektrum abdecken soll. Beginnen werde ich mit Begriffsdefinitionen. Dabei sollen die Begrifflichkeiten Hörfertigkeit, Gehör und Verstehen analysiert und auch aus biologischer und psychologischer Sicht betrachtet werden. Das dritte Kapitel wird sich mit dem Hören in der Gesellschaft befassen. Dabei sollen seine veränderte Position in der Gesellschaft, die Überlagerung durch das Visuelle und die Gefahren von Dauerbeschallung sowie der Unterschätzung von Geräuschkulissen beleuchtet werden. Im 4. Kapitel „Hören im Lehrplan für den Deutschunterricht“ begebe ich mich auf die Suche nach den Verankerungen von Hörübungen und Hörtraining in den Bereichen Unterstufe, Oberstufe und BHS. Dabei werde ich mich auf die Lehrpläne für den Deutschunterricht beschränken. Am Ende soll eine Zusammenfassung der Ergebnisse folgen. Im letzten Hauptkapitel beschäftige ich mich mit vorhandener Literatur und den darin vorgestellten Hörübungen bzw. Höraufgaben. Für eine bessere Übersicht gliedert sich dieses Kapitel in vier Unterpunkte. Im letzten Kapitel werde ich meine Ergebnisse nochmals zusammenfassen, ein Resümee ziehen und schließlich einen Forschungsausblick wagen.
Bevor ich mit dem Verfassen meiner Seminararbeit beginne, möchte ich meine Forschungsfrage konkretisieren und die enthaltenen Unterpunkte auflisten: Inwiefern kann, soll oder muss das Lehren und Lernen des Hörens im Deutschunterricht verankert werden?
(1) Welche Stellung nimmt das Gehör in der Sinnhierarchie unserer Gesellschaft ein?;
(2) Ist die Schulung des Hörens und Zuhörens in den Lehrplänen für den Deutschunterricht verankert? Wenn ja, in welcher Weise und in welchem Ausmaß?;
(3) Wie kann das Hören Lehren und Lernen im Deutschunterricht umgesetzt werden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Hören in der Gesellschaft
- Der Gehörsinn: eine unverzichtbare menschliche Fähigkeit
- Über die visuelle Dominanz und die Verdrängung der Sinnlichkeit
- Die Gefahren des Hörens
- Hören im Lehrplan für den Deutschunterricht
- Das Hören im Gymnasiallehrplan für den Deutschunterricht: Unterstufe
- Das Hören im Gymnasiallehrplan für den Deutschunterricht: Oberstufe
- Das Hören im Lehrplan für den Deutschunterricht: BHS-Bereich
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Hören im Deutschunterricht
- Übungen zur Hörsensibilisierung
- Hörübungen für den Grammatik- und Rechtschreibbereich
- Hörübungen für den literarischen Bereich
- Übungen zur Schulung des aktiven Zuhörens
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit widmet sich der Frage nach der Rolle des Hörens im Deutschunterricht. Sie untersucht die Bedeutung des Gehörsinnes in der Gesellschaft und analysiert die Stellenwert von Hörübungen in Lehrplänen. Ziel der Arbeit ist es, die Chancen und Versäumnisse des vernachlässigten Gehörsinnes aufzuzeigen und konkrete Ansätze für die Integration von Hörtraining im Deutschunterricht zu erarbeiten.
- Der Gehörsinn als unverzichtbare menschliche Fähigkeit und seine Bedeutung für den Deutschunterricht
- Visuelle Dominanz in der Gesellschaft und die Verdrängung des auditiven Wahrnehmens
- Analyse der Verankerung von Hörübungen im Deutschunterricht in verschiedenen Schulformen
- Vorstellung von verschiedenen Hörübungen und deren Einsatzmöglichkeiten im Deutschunterricht
- Die Notwendigkeit einer verstärkten Berücksichtigung des Gehörsinnes im Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer genauen Definition der Begriffe Hörfertigkeit, Gehör und Verstehen, wobei diese aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven beleuchtet werden. Im Anschluss wird der veränderte Stellenwert des Hörens in der heutigen Gesellschaft diskutiert, wobei die Dominanz des Visuellen, die Gefahren von Dauerbeschallung und die unterschätzte Bedeutung von Geräuschkulissen thematisiert werden. Das vierte Kapitel widmet sich der Analyse des Lehrplans für den Deutschunterricht, um die Verankerung von Hörübungen und Hörtraining in den verschiedenen Schulformen zu erforschen. Hierbei werden die Unterstufe, die Oberstufe und der BHS-Bereich in den Fokus gerückt. Abschließend werden in einem separaten Kapitel verschiedene Hörübungen und Höraufgaben vorgestellt, die sich in vier Unterpunkte gliedern: Übungen zur Hörsensibilisierung, Hörübungen für den Grammatik- und Rechtschreibbereich, Hörübungen für den literarischen Bereich und Übungen zur Schulung des aktiven Zuhörens.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Themen des Hörens und Zuhörens im Deutschunterricht. Hierbei spielen die Begriffe Hörfertigkeit, Gehör, auditives System, visuelle Dominanz, Geräuschkulissen, Lehrplananalyse, Hörübungen und aktive Zuhören eine wichtige Rolle. Die Arbeit analysiert den Stellenwert des Hörens in der Gesellschaft und in der Didaktik des Deutschunterrichts, um schließlich konkrete Handlungsempfehlungen für die Integration von Hörtraining in den Unterricht zu liefern.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird der Gehörsinn im Deutschunterricht oft vernachlässigt?
Während Hörübungen im Fremdsprachenunterricht Standard sind, dominiert im muttersprachlichen Deutschunterricht oft das Visuelle, was zu einem Versäumnis bei der Schulung der auditiven Wahrnehmung führt.
Ist das Hörtraining in den Lehrplänen für Deutsch vorgesehen?
Die Arbeit analysiert die Lehrpläne für Unterstufe, Oberstufe und BHS und untersucht, in welcher Weise und in welchem Ausmaß die Schulung des Hörens dort tatsächlich verankert ist.
Was ist der Unterschied zwischen Hören und aktivem Zuhören?
Hören ist ein biologischer Vorgang, während aktives Zuhören eine kognitive und soziale Fertigkeit ist, die gezielt geschult werden muss, um Informationen zu verarbeiten und Empathie zu zeigen.
Welche Arten von Hörübungen können im Unterricht eingesetzt werden?
Es gibt Übungen zur Hörsensibilisierung, Aufgaben für den Grammatik- und Rechtschreibbereich sowie Hörübungen für den literarischen Bereich.
Welche Gefahren bestehen durch die visuelle Dominanz in der Gesellschaft?
Die Überlagerung durch visuelle Reize führt dazu, dass die auditive Aufmerksamkeit sinkt und die Fähigkeit, in einer lauten Umgebung (Dauerbeschallung) differenziert wahrzunehmen, verkümmert.
Wie hängen Hören und Verstehen aus psychologischer Sicht zusammen?
Verstehen setzt eine erfolgreiche auditive Verarbeitung voraus; die Arbeit beleuchtet diese Schnittstelle zwischen Biologie und kognitiver Psychologie.
- Quote paper
- Mag.a Melanie Binder (Author), 2014, Aufhorchen im Deutschunterricht. Eine Auseinandersetzung mit den Chancen und Versäumnissen des vernachlässigten Gehörsinnes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320951