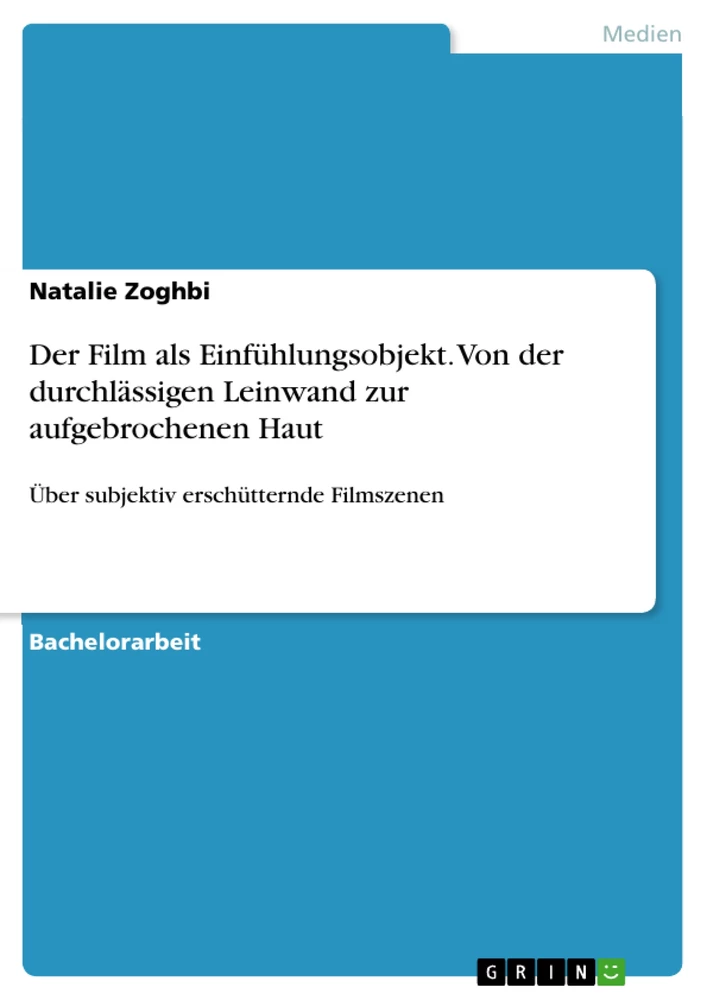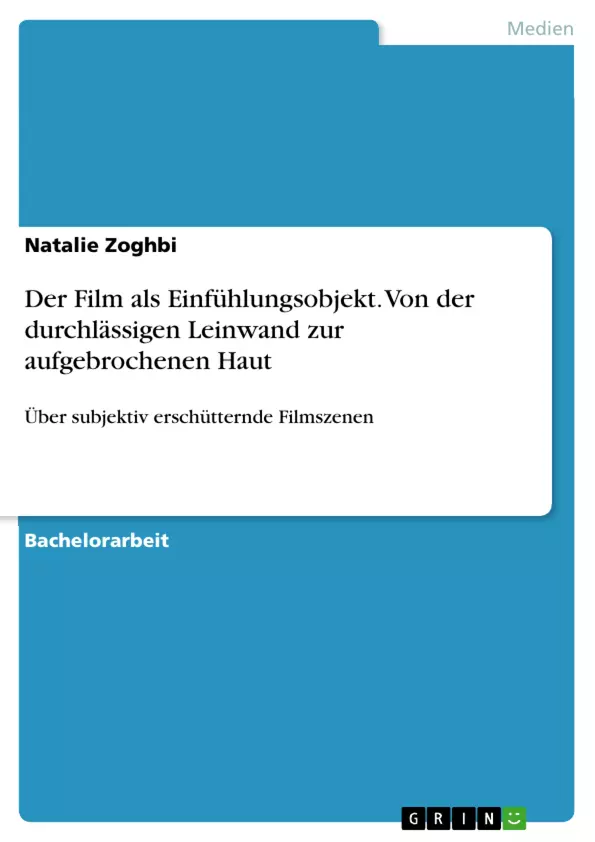Was sagt eine Filmszene? Was bin ich angesichts dieser Szene? Und kann man diese beiden Fragen überhaupt voneinander trennen? – Filme laden den Zuschauer zu sich ein, ziehen und zerren an ihm, bis er eintritt; bis er in die Handlung eindringt, mit den Figuren mitfühlt und sich zu den dargestellten Ereignissen positioniert – als Zeuge, Täter oder Opfer. Zugleich bleibt doch der Zuschauer auch selbst gegenwärtig, vergisst nie ganz seine eigene Präsenz, seinen Körper, seine Differenz zum Gezeigten. Denn der Film wirkt durch ihn, mit ihm, in ihm.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich anhand dreier unterschiedlicher Herangehensweisen Ansätze aufzeigen, welche die subjektive Positionierung des Zuschauerkörpers zur Leinwand sowie die Beeinflussung des Körpers durch das Betrachtete nahezu unabhängig von inhaltlichen und technischen Wirkungsstrategien des Films behandeln. Der vermeintliche Verlust des Selbst durch Kontemplation wird dabei dem stetigen Selbstbewusstsein des Zuschauers gegenübergestellt und schließlich gar vereint, sodass die Subjektivität in der Filmerfahrung signifikant an Bedeutung gewinnt. Genre und Darstellungsweise werden zweitrangig und der Erfahrungsraum der Filmrezeption dringt tief in die gelebte Realität des Zuschauers ein.
Um diese Thesen zu untermauern, sollen filmwissenschaftliche Ansätze zusammengebracht werden mit philosophischen Positionen, welche unabhängig vom Medium Film entwickelt wurden und sich auf zwischenmenschliche, ethische oder anderweitig theoretische Fragestellungen beziehen. Diese Theorien auf die Erfahrung von Filmszenen anzuwenden, umfasst die Annahme, dass der Film ein machtvolles und einflussreiches Gegenüber des rezipierenden Subjekts ist, dessen Interaktionspotential mit dem Zuschauer nicht zu unterschätzten ist.
Obgleich der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit abseits von narrativen und technischen Strategien liegt, möchte ich diese als Einstieg doch kurz andeuten. Denn auch wenn an dieser Stelle keine Fokussierung auf entsprechende Wirkungsweisen erfolgt, sind sie in ihrer Geltung und Relevanz dennoch allzeit präsent und sollten darum nicht gänzlich außer Acht gelassen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Einführung in die Problemstellung
- Exkurs: Narration und Technik
- Titel und Thesen
- Von der durchlässigen Leinwand zur aufgebrochenen Haut
- Subjektivität
- Erschütterung
- Ziel und Aussicht
- Der performative Film
- Benennung und Ansprache
- Zum Beispiel: Ein subjektiver Erfahrungsbericht
- Der Film als Einfühlungsobjekt
- Identifikation, Empathie, Mitleid
- Einfühlung
- Menschsein und Selbst
- Der phänomenologische Film
- Synästhesie
- Die Erfahrung eines Anderen erfahren
- Interobjektivität
- Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Filmszenen die subjektive Positionierung des Zuschauers zur Leinwand und die Beeinflussung seines Körpers durch das Betrachtete beeinflussen. Sie beleuchtet die Interaktion zwischen Film und Zuschauer unabhängig von inhaltlichen und technischen Wirkungsstrategien des Films. Die Arbeit zeigt, wie der vermeintliche Verlust des Selbst durch Kontemplation dem stetigen Selbstbewusstsein des Zuschauers gegenübergestellt und schließlich vereint wird, wodurch die Subjektivität in der Filmerfahrung an Bedeutung gewinnt. Sie verbindet filmwissenschaftliche Ansätze mit philosophischen Positionen, die unabhängig vom Medium Film entwickelt wurden.
- Die subjektive Positionierung des Zuschauers zur Leinwand
- Die Beeinflussung des Körpers durch das Betrachtete
- Der vermeintliche Verlust des Selbst durch Kontemplation
- Die Bedeutung der Subjektivität in der Filmerfahrung
- Die Verbindung von filmwissenschaftlichen und philosophischen Ansätzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung ein und stellt die Frage nach dem Verhältnis von Filmszene und Zuschauer. Sie stellt die These auf, dass der Film das rezipierende Subjekt beeinflusst und dessen Subjektivität in der Filmerfahrung eine zentrale Rolle spielt.
Kapitel 1.1 beleuchtet verschiedene Ansätze der Filmtheorie und Dramentheorie, die sich mit der Frage beschäftigen, wie Filme den Zuschauer in ihren Bann ziehen und beeinflussen können. Es werden die Bedeutung von Handlung, dramatischen Wendepunkten, Figuren und technischen Entscheidungen für die Involvierung des Zuschauers erläutert.
Kapitel 2 untersucht den performativen Film und beleuchtet, wie Filme den Zuschauer durch Benennung und Ansprache in die Handlung einbeziehen. Ein Beispiel für einen subjektiven Erfahrungsbericht veranschaulicht diese These.
Kapitel 3 analysiert den Film als Einfühlungsobjekt. Es werden die Konzepte von Identifikation, Empathie und Mitleid sowie der Begriff der Einfühlung diskutiert, um die Einbindung des Zuschauers in die Filmerfahrung zu verstehen.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem phänomenologischen Film und untersucht, wie die Erfahrung eines Anderen durch synästhetische Wahrnehmungen und Interobjektivität im Film vermittelt wird.
Abschließende Bemerkungen fassen die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen der Subjektivität, der Filmerfahrung, der Interaktion zwischen Film und Zuschauer, dem performativen Film, dem Einfühlungsobjekt, dem phänomenologischen Film und der Synästhesie. Sie untersucht, wie die subjektive Positionierung des Zuschauers zur Leinwand und die Beeinflussung seines Körpers durch das Betrachtete die Filmerfahrung prägen.
Häufig gestellte Fragen
Wie interagiert der Körper des Zuschauers mit der Leinwand?
Die Arbeit untersucht, wie Filme den Zuschauer physisch und emotional beeinflussen, sodass die Grenze zwischen Gezeigtem und eigenem Körper verschwimmt.
Was bedeutet „Einfühlung“ im Kontext der Filmrezeption?
Einfühlung beschreibt den Prozess, bei dem der Zuschauer durch Identifikation und Empathie tief in die Handlung und das Erleben der Figuren eintaucht.
Welche Rolle spielt die Synästhesie beim Filmeschauen?
Synästhesie ermöglicht es dem Zuschauer, visuelle Reize auch als körperliche oder sensorische Empfindungen (z.B. Berührung oder Kälte) wahrzunehmen.
Was ist ein „performativer Film“?
Ein Film, der den Zuschauer direkt anspricht oder einbezieht und ihn somit zum aktiven Teil des Geschehens macht.
Vergisst der Zuschauer im Kino seine eigene Präsenz?
Die Arbeit argumentiert, dass der Zuschauer trotz Kontemplation ein stetiges Selbstbewusstsein behält, was die Filmerfahrung zu einer hochgradig subjektiven Interaktion macht.
- Arbeit zitieren
- Natalie Zoghbi (Autor:in), 2014, Der Film als Einfühlungsobjekt. Von der durchlässigen Leinwand zur aufgebrochenen Haut, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321058