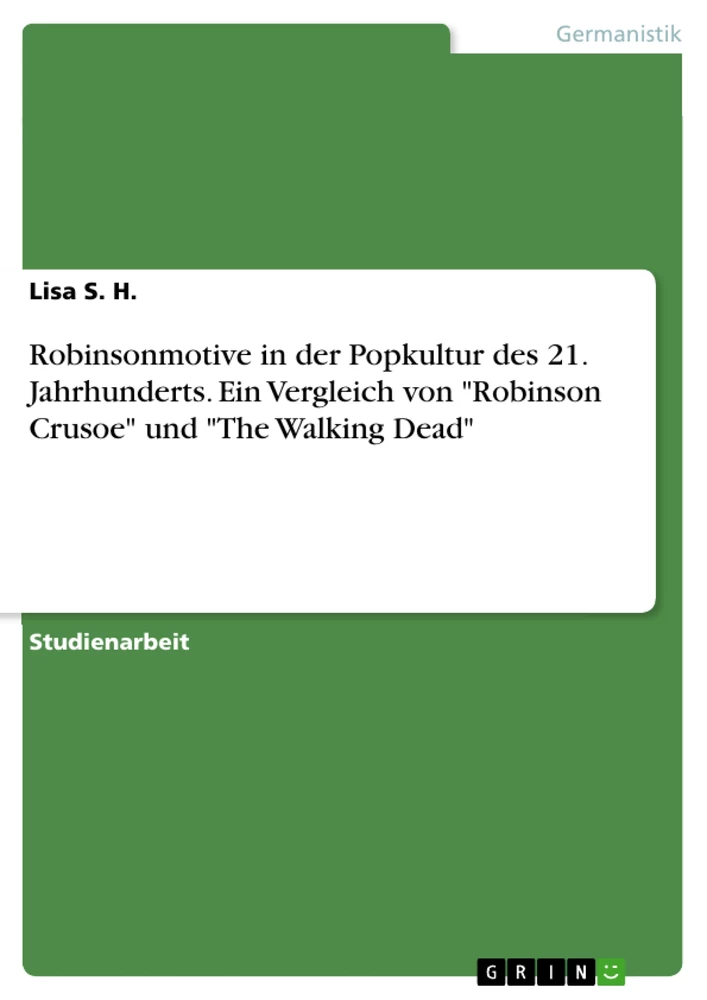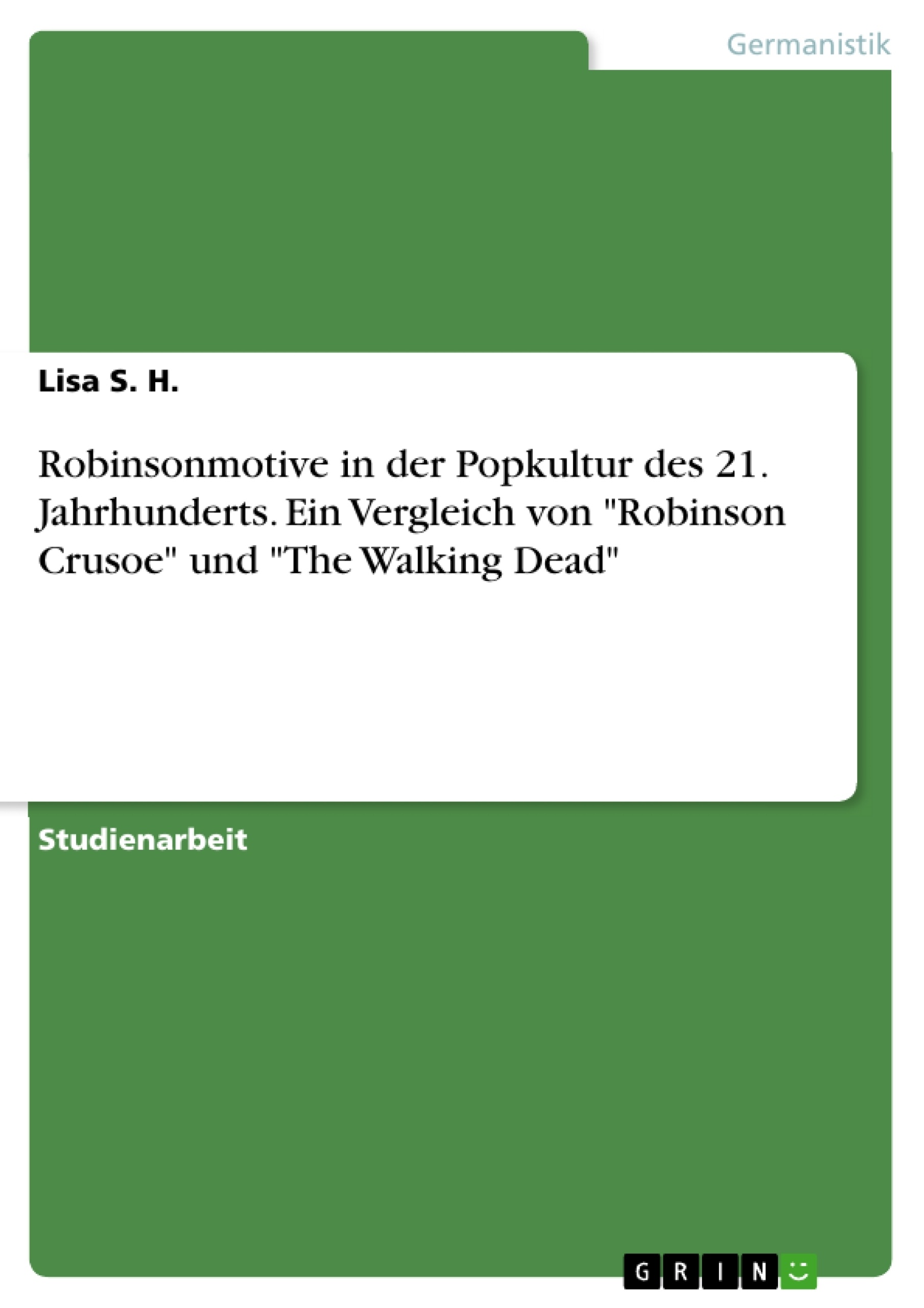Die folgende Hausarbeit stellt eine Analyse des populären Phänomens ‚The Walking Dead‘ bezüglich der Motive von Robinsonaden dar und versucht die Frage zu beantworten, ob es als Robinsonade charakterisiert werden kann oder nicht, und wie sich dies begründen lässt.
Daniel Defoes ‚Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe‘, das 1719 als erstes Werk einer Trilogie erschien, prägte sowohl den Namen, als auch den Beginn der literarischen Gattung der Robinsonade. Die Geschichte des schiffbrüchigen Robinsons, der auf einer einsamen Insel um sein Überleben kämpft, wird immer wieder in verschiedenen Variationen in Literatur, Film, Musik und Kunst aufgegriffen und hat schon seit einigen Jahren auch seinen Einzug in die populäre Massenkultur gefunden.
Um die Analyse zu bewerkstelligen, wird zu Anfang ein kurzer Erklärungsversuch des Begriffs ‚Popkultur‘ gegeben. Anschließend wird begründet, warum sich ‚The Walking Dead‘ besonders eignet, um Robinsonmotive in der Popkultur zu untersuchen. Dem folgend, werden aus schon vorhandener Forschungsliteratur drei zentrale Grundmotive der Robinsonade herausgearbeitet, um einen Überblick über die Gattung zu bekommen. Anschließend wird die Haupthandlung von ‚The Walking Dead‘ auf diese Grundmotive hin untersucht und diskutiert, ob und inwieweit sie sich als Robinsonade charakterisieren lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Popkultur
- The Walking Dead als Paradebeispiel der Popkultur
- Grundmotive der Robinsonade
- Isolation
- Überlebensbemühungen
- Physisches Überleben
- Psychisches Überleben
- Überleben als Gemeinschaft
- Die Reise ins Innere der Robinsonfigur
- Die Grundmotive der Robinsonade in The Walking Dead
- Das Motiv der Isolation in The Walking Dead
- Das Motiv der Überlebensbemühungen in The Walking Dead
- Physisches Überleben
- Psychisches Überleben
- Überleben als Gemeinschaft
- Das Motiv der Reise ins Innere der Robinsonfigur in The Walking Dead
- Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert das populäre Phänomen The Walking Dead im Hinblick auf die Motive von Robinsonaden. Sie untersucht, ob und inwieweit sich die Serie als Robinsonade charakterisieren lässt und beleuchtet die zugrundeliegenden Gründe.
- Die Bedeutung von Popkultur als kulturelles Phänomen
- The Walking Dead als Beispiel für die Verankerung von Robinsonmotiven in der Popkultur
- Analyse der zentralen Grundmotive der Robinsonade, wie Isolation, Überlebensbemühungen und die Reise ins Innere der Robinsonfigur
- Anwendung dieser Grundmotive auf die Handlung von The Walking Dead
- Diskussion der Frage, ob The Walking Dead als Robinsonade interpretiert werden kann
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Robinsonade ein und erläutert den Kontext der Analyse von The Walking Dead. Kapitel 2 definiert den Begriff der Popkultur und beleuchtet seine Bedeutung im Rahmen der heutigen Gesellschaft. In Kapitel 3 wird The Walking Dead als Paradebeispiel der Popkultur vorgestellt und seine vielseitigen medialen Ausdrucksformen analysiert. Kapitel 4 widmet sich der Gattung der Robinsonade und beleuchtet ihre zentralen Motive. In Kapitel 5 werden die Grundmotive der Robinsonade auf The Walking Dead angewandt und die Serie im Hinblick auf ihre Robinson-Charakteristika untersucht. Die Zusammenfassung und Schlussfolgerung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und zieht abschließende Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Popkultur, Robinsonade, The Walking Dead, Isolation, Überlebensbemühungen, Reise ins Innere der Robinsonfigur, Zombieapokalypse, Massenkultur, Mainstream, Medien, Fan-Praktiken, Moral, Ethik
Häufig gestellte Fragen
Kann „The Walking Dead“ als Robinsonade bezeichnet werden?
Die Arbeit untersucht diese These und zeigt auf, dass die Serie viele zentrale Motive der Gattung Robinsonade, wie Isolation und Überlebenskampf, in einem modernen Popkultur-Kontext nutzt.
Was sind die drei zentralen Grundmotive der Robinsonade?
Die zentralen Motive sind Isolation (räumlich oder gesellschaftlich), Überlebensbemühungen (physisch/psychisch) und die Reise ins Innere der Hauptfigur.
Wie wird das Motiv der Isolation in „The Walking Dead“ umgesetzt?
Statt einer einsamen Insel ist es die durch die Zombieapokalypse zerstörte Zivilisation, die die Protagonisten isoliert und sie zwingt, in einer feindlichen Umwelt zu überleben.
Was bedeutet „psychisches Überleben“ in diesem Zusammenhang?
Es beschreibt den Kampf der Charaktere, in einer moralisch zerfallenden Welt ihren Verstand und ihre Menschlichkeit zu bewahren.
Wer prägte den Begriff der Robinsonade?
Der Begriff leitet sich von Daniel Defoes Werk „Robinson Crusoe“ (1719) ab, das als Ursprung dieser literarischen Gattung gilt.
- Quote paper
- Lisa S. H. (Author), 2016, Robinsonmotive in der Popkultur des 21. Jahrhunderts. Ein Vergleich von "Robinson Crusoe" und "The Walking Dead", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321214