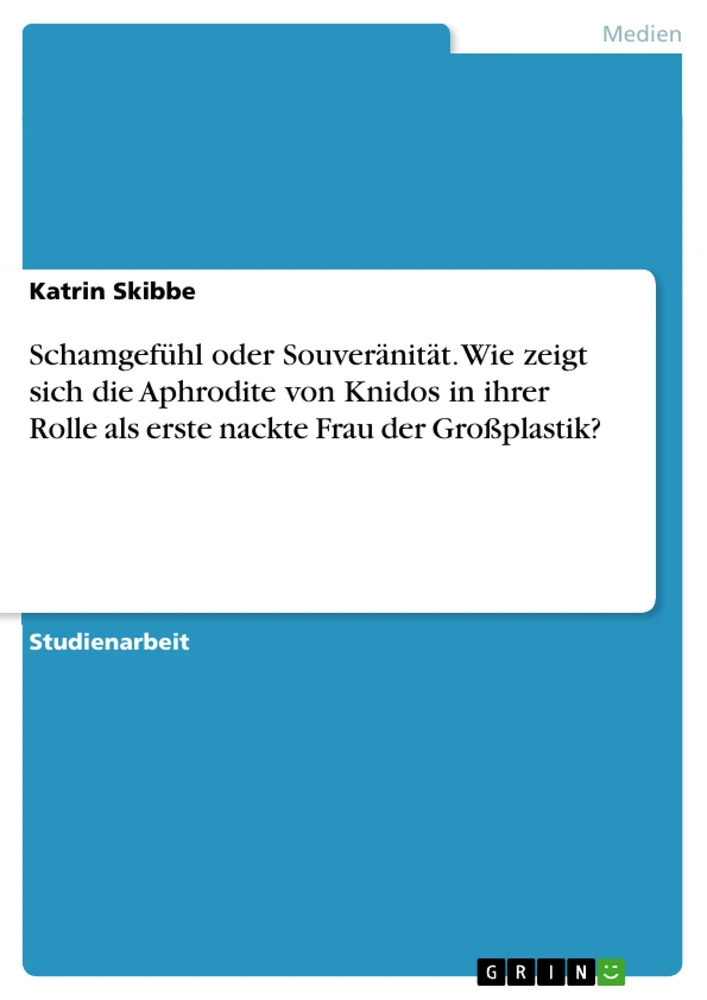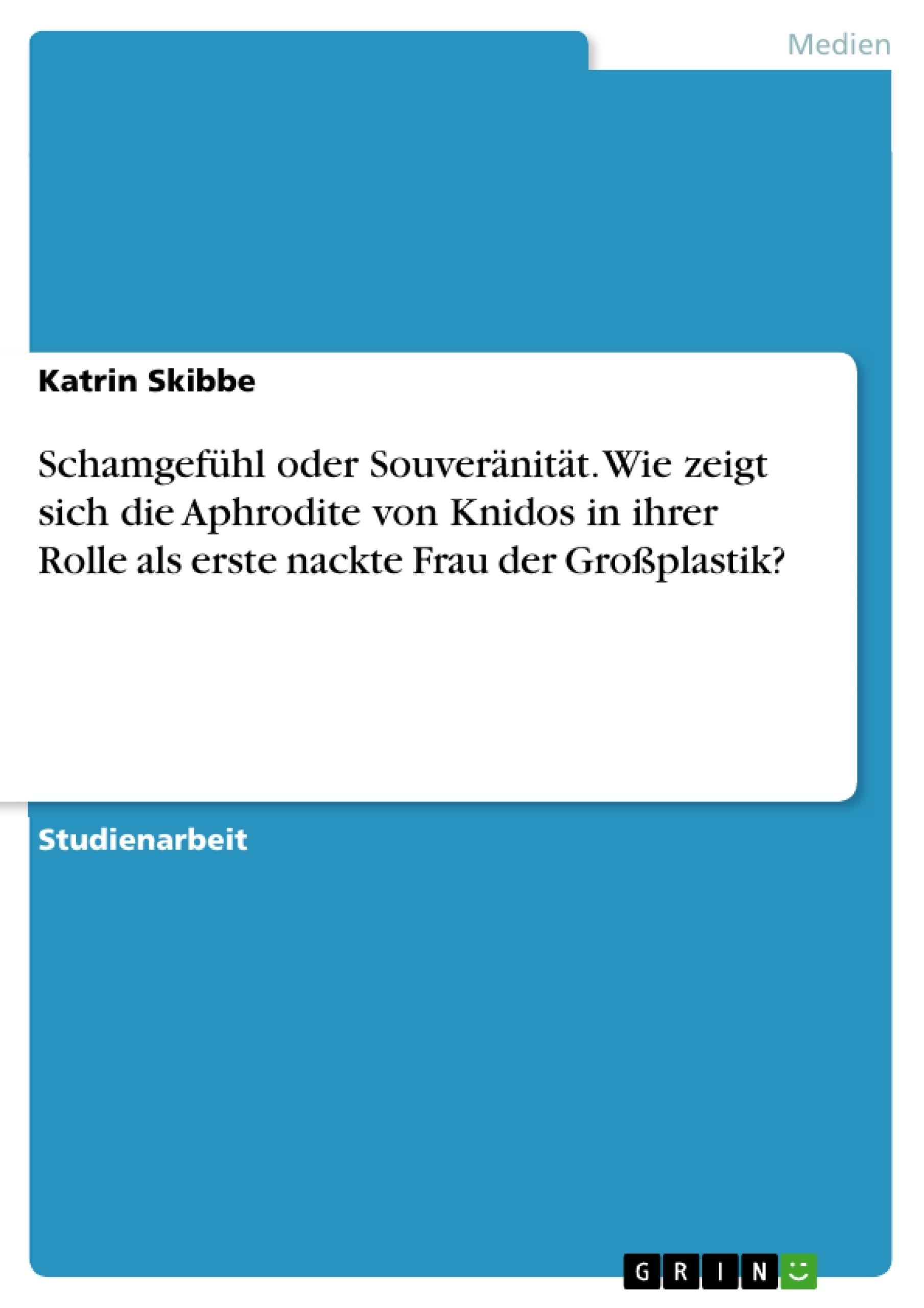Die Knidia gilt als das berühmteste Werk des Praxiteles und wurde schon in der Antike von den Autoren als weltbedeutendes Meisterstück bewundert. Neben dem olympischen Zeus und der Athena Parthenos ist sie die in der uns erhaltenen antiken Literatur am häufigsten genannte und am meisten gefeierte Plastik. Doch was machte sie so besonders? Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, ob die knidische Aphrodite eher Scham oder Souveränität in ihrer Rolle zeigt und was Praxiteles bewegt haben könnte, die Göttin in eben dieser speziellen Gestalt auszuarbeiten.
Die beiden erstgenannten Statuen wurden von den antiken Schriftstellern aus religiösen oder patriotischen Gefühlen heraus gerühmt. Aber „die knidische Aphrodite stand nicht an einem Ort, der den Griechen im Allgemeinen heilig und teuer war, sie war aus demselben Material gefertigt wie Hunderte von anderen Statuen, sie war nicht von ungewöhnlicher Größe, kurz, sie war von keinem äußeren Glanz umstrahlt. Nur ihre reine Kunst redete ihr das Wort.“ Setzt man Reinheit gleich mit Natürlichkeit und diese wiederum mit Nacktheit, so lässt sich der Stellenwert der Aphrodite von Knidos leicht nachvollziehen, denn sie gilt als die erste uns bekannte griechische Frauenstatue, die von allen Seiten vollständig nackt zu sehen war.
Schon in der Antike betrachtete man die Figur in der Kunst als vollkommenstes Standbild einer nackten Göttin und Frau und sie konnte diesen beispiellosen Ruf über Jahrtausende hinweg halten. Die Statue wurde in der Zeit von der griechischen Klassik bis zur Renaissance zur Leitfigur für die Passion Lust. Doch bis dahin brauchte es einen langen Weg der Entwicklung, welchen ich im ersten Teil meiner Arbeit in einer kurzen Ikonographie der Aphroditedarstellungen nachzeichnen werde, für die ich vor allem das Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae unterstützend zu Rate gezogen habe.
Nach diesem Schritt bei der Knidia des Praxiteles angekommen, wird eine grundlegende Beschreibung eben dieser an zwei ausgewählten Beispielen von Repliken folgen, wobei ich mich innerhalb der Forschungsliteratur unter anderem auf Blinkenberg, Hinz, Klein und Kraus stütze. Um aber die Bedeutung dieser Statue vollständig erfassen zu können, ist ebenfalls eine Betrachtung des Entwicklungsprozesses der Rolle der Frau und des Umgangs mit weiblicher Nacktheit notwendig. Diese werde ich, unter der Berücksichtigung der Werke von z.B. Neumer-Pfau und Himmelmann, in einem eigenen Kapitel anschließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ikonographie
- Die Entwicklung des Aphroditebildes in der Großplastik
- Aphrodite? – Nackte Frauengestalten in der Kleinkunst
- Exkurs – Motiv des Badens
- Die Aphrodite von Knidos
- Die Knidia in antiken Quellen und ihre Identifizierung
- Allgemeine Gemeinsamkeiten aller Repliken
- Der ruhig stehende Typus – Venus Colonna
- Der ängstliche Typus – Die Venus vom Belvedere
- Die Rolle der Frau und der Umgang mit weiblicher Nacktheit in der Antike
- Entdeckung der Weiblichkeit in der Kunst
- Das Motiv der Nacktheit
- Aphrodite und die Rolle der Frau
- Deutung der Bewegungsweise der Knidia
- Vergleich zwischen ruhig stehendem und ängstlichem Typus
- Vergleich zur Kapitolinischen Venus
- Intentionen des Praxiteles für diese spezielle Ausarbeitung der Aphrodite
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der berühmten Aphrodite von Knidos, einem Meisterwerk des Bildhauers Praxiteles. Ziel ist es, die Entstehung und Bedeutung dieser Statue im Kontext der griechischen Kunst und Kultur zu beleuchten. Dabei werden insbesondere die ikonographische Entwicklung der Aphroditedarstellung, die Rolle der Frau und der Umgang mit weiblicher Nacktheit in der Antike sowie die spezifischen künstlerischen Intentionen des Praxiteles untersucht.
- Die Ikonographie der Aphroditedarstellung
- Die Rolle der Frau in der griechischen Gesellschaft
- Die Bedeutung der weiblichen Nacktheit in der Kunst
- Die künstlerischen Intentionen des Praxiteles
- Die Deutung der Bewegungsweise der Knidia
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Besonderheit der Knidia als die erste vollständig nackte Frauenstatue in der griechischen Großplastik. Das zweite Kapitel widmet sich der Ikonographie der Aphroditedarstellung und untersucht die Entwicklung des Aphroditebildes in der Großplastik und die Darstellung nackter Frauen in der Kleinkunst. Im dritten Kapitel wird die Aphrodite von Knidos anhand von zwei ausgewählten Repliken, der Venus Colonna und der Venus vom Belvedere, genauer beschrieben und analysiert. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Rolle der Frau in der griechischen Gesellschaft und dem Umgang mit weiblicher Nacktheit in der Antike. Im fünften Kapitel wird die Bewegungsweise der Knidia gedeutet und die beiden Typusformen, der ruhig stehende und der ängstliche Typus, miteinander verglichen. In einem Exkurs wird die Kapitolinische Venus hinzugezogen, um die Entwicklung der Darstellung von weiblicher Scham in der Kunst zu verdeutlichen. Das sechste Kapitel untersucht die Intentionen des Praxiteles für diese spezielle Ausarbeitung der Aphrodite. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Aphrodite, Knidia, Praxiteles, Ikonographie, Großplastik, Kleinkunst, Nacktheit, Frauenrolle, Antike, Bewegung, Körperhaltung, Kunstgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was macht die Aphrodite von Knidos kunsthistorisch so bedeutend?
Sie gilt als die erste lebensgroße griechische Frauenstatue, die vollständig nackt dargestellt wurde, und brach damit mit den damaligen Konventionen der Großplastik.
Wer war der Schöpfer der Aphrodite von Knidos?
Die Statue wurde im 4. Jahrhundert v. Chr. von dem berühmten Bildhauer Praxiteles geschaffen.
Verkörpert die Statue eher Scham oder Souveränität?
Die Arbeit untersucht zwei Typen: den ruhig stehenden, souveränen Typus (Venus Colonna) und den ängstlich-schamhaften Typus (Venus vom Belvedere), um Praxiteles' Intention zu deuten.
Wie wurde weibliche Nacktheit in der griechischen Klassik bewertet?
Während männliche Nacktheit üblich war, war weibliche Nacktheit in der Kunst lange Zeit auf die Kleinkunst oder Sklavendarstellungen begrenzt. Die Knidia markiert die Entdeckung der Weiblichkeit in der Großplastik.
Was ist das Motiv des Badens bei dieser Statue?
Die Nacktheit wird durch das Motiv des rituellen Bades legitimiert; die Göttin wird in einem privaten Moment dargestellt, was die Natürlichkeit der Figur unterstreicht.
- Arbeit zitieren
- Katrin Skibbe (Autor:in), 2010, Schamgefühl oder Souveränität. Wie zeigt sich die Aphrodite von Knidos in ihrer Rolle als erste nackte Frau der Großplastik?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321223