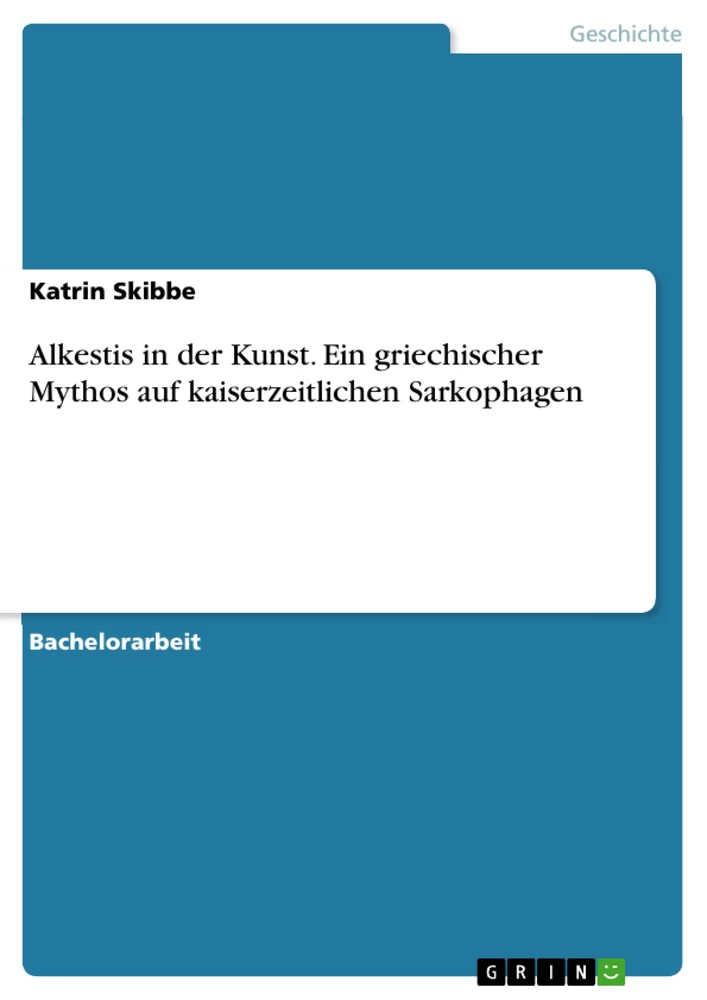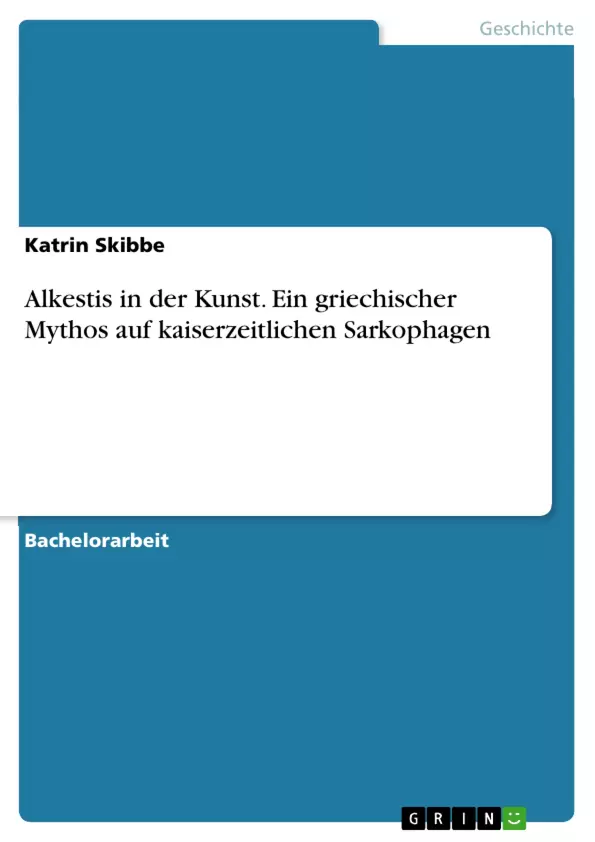Der Aufbau der Arbeit ist eine Einleitung zur Entwicklung und Bedeutung von Sarkophagreliefs, die gefolgt wird vom Mythos Alkestis und seiner literarischen Überlieferung. Die Betrachtung der eigentlichen Reliefs folgt der Ikonographie und die Deutung des Alkestismythos auf sepulkraler Ebene beendet die Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung zur Entwicklung und Bedeutung von Sarkophagreliefs
- Der Mythos Alkestis und seine literarische Überlieferung
- Ikonographie
- Alkestis in der griechischen Kunst
- Alkestis in der römischen Kunst
- Kleinkunst
- Reliefs
- Sarkophage
- Wandgemälde
- Erkenntnisse aus der Ikonographie
- Die Sarkophagreliefs
- Der Sarkophag der Ulpia Kyrilla in St. Aignan
- Der Euhodus-Sarkophag im Vatikan
- Alkestissarkophag der Villa Albani in Rom
- Alkestissarkophag, ehemals in Cannes
- Resultate aus den Vergleichen
- Deutung des Alkestismythos auf sepulkraler Ebene
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des griechischen Mythos der Alkestis auf römischen Sarkophagreliefs des 2. Jahrhunderts n. Chr. Ziel ist es, die Wahl dieser Kunstgattung zu erklären und die ikonographischen Besonderheiten sowie die Deutung des Mythos im Kontext der sepulkralen Kunst zu analysieren.
- Die Entwicklung und Bedeutung von Sarkophagreliefs in der römischen Kaiserzeit
- Die ikonographische Darstellung des Alkestis-Mythos in der griechischen und römischen Kunst
- Detaillierte Analyse ausgewählter Alkestis-Sarkophage
- Vergleichende Analyse der Komposition, Szeneneinteilung und Figureninterpretation der Sarkophage
- Deutung des Alkestis-Mythos im Kontext der römischen Bestattungskultur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung zur Entwicklung und Bedeutung von Sarkophagreliefs: Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung des Alkestis-Mythos auf römischen Sarkophagreliefs des 2. Jahrhunderts n. Chr., da diese Erzählung bis dahin nur spärlich in der Kunst vorkam. Die Häufung der Darstellungen in dieser Zeit ermöglicht eine in sich geschlossene Gruppe von Bildträgern für die Analyse. Die Einleitung skizziert den Forschungsansatz, der die literarische Überlieferung des Mythos, die Ikonographie und die detaillierte Untersuchung von vier ausgewählten Sarkophagen umfasst, um schließlich die Intention der mythologischen Wahl auf sepulkraler Ebene zu ergründen.
Der Mythos Alkestis und seine literarische Überlieferung: Dieses Kapitel bietet eine kurze Zusammenfassung des Alkestis-Mythos und seiner literarischen Überlieferung, vor allem basierend auf Euripides' Tragödie und einem Aufsatz von Karl Dissel. Es bildet die Grundlage für das Verständnis der ikonographischen Darstellungen.
Ikonographie: Dieses Kapitel verfolgt die Ikonographie der Alkestis-Darstellungen in der griechischen und römischen Kunst, um die Seltenheit der Darstellungen vor dem 2. Jahrhundert n. Chr. zu belegen und den Kontext für die spätere Häufung auf Sarkophagreliefs zu schaffen. Es analysiert die unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen in Kleinkunst, Reliefs, Sarkophagen und Wandmalereien.
Die Sarkophagreliefs: Dieses Kapitel stellt den Kern der Arbeit dar und befasst sich ausführlich mit vier ausgewählten Alkestis-Sarkophagen des 2. Jahrhunderts n. Chr. Für jeden Sarkophag werden Beschreibung, Szeneneinteilung, Komposition und Deutung der Figuren und Szenen unter Einbezug verschiedener Forscherperspektiven detailliert analysiert. Der Vergleich dieser Sarkophage dient der Erarbeitung von Ergebnissen und Schlussfolgerungen.
Deutung des Alkestismythos auf sepulkraler Ebene: Dieses Kapitel widmet sich der Frage nach der Intention der Wahl des Alkestis-Mythos für die Gestaltung von Sarkophagen. Es untersucht die Bedeutung des Mythos im Kontext der römischen Bestattungskultur und beleuchtet die damit verbundenen symbolischen Bedeutungen.
Schlüsselwörter
Alkestis-Mythos, Sarkophagreliefs, römische Kaiserzeit, Ikonographie, Sepulkralkunst, Komposition, Szeneneinteilung, Figureninterpretation, Bestattungskultur, Mythosdeutung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Darstellung des Alkestis-Mythos auf römischen Sarkophagreliefs des 2. Jahrhunderts n. Chr.
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Darstellung des griechischen Alkestis-Mythos auf römischen Sarkophagreliefs des 2. Jahrhunderts n. Chr. Sie analysiert die Wahl dieser Kunstgattung, die ikonographischen Besonderheiten und die Deutung des Mythos im Kontext der sepulkralen Kunst.
Welche Ziele werden verfolgt?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Gründe für die Verwendung des Alkestis-Mythos auf Sarkophagreliefs zu erklären und die ikonographischen Besonderheiten sowie die symbolische Bedeutung im Kontext der römischen Bestattungskultur zu analysieren. Im Fokus steht der Vergleich verschiedener Sarkophage und deren Interpretation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung zur Entwicklung und Bedeutung von Sarkophagreliefs; Der Mythos Alkestis und seine literarische Überlieferung; Ikonographie (Alkestis in griechischer und römischer Kunst); Die Sarkophagreliefs (Analyse ausgewählter Beispiele, darunter Sarkophage in St. Aignan, im Vatikan, Villa Albani und ehemals Cannes); Deutung des Alkestismythos auf sepulkraler Ebene; Zusammenfassung.
Welche Sarkophage werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert im Detail vier ausgewählte Alkestis-Sarkophage: den Sarkophag der Ulpia Kyrilla in St. Aignan, den Euhodus-Sarkophag im Vatikan, den Alkestissarkophag der Villa Albani in Rom und einen Alkestissarkophag, der sich ehemals in Cannes befand. Für jeden Sarkophag werden Beschreibung, Szeneneinteilung, Komposition und Figureninterpretation detailliert untersucht.
Wie wird die Ikonographie behandelt?
Das Kapitel zur Ikonographie verfolgt die Darstellung des Alkestis-Mythos in der griechischen und römischen Kunst, von Kleinkunst bis hin zu Wandmalereien. Es belegt die Seltenheit der Darstellungen vor dem 2. Jahrhundert n. Chr. und bildet den Kontext für die spätere Häufung auf Sarkophagreliefs.
Welche Bedeutung hat der Alkestis-Mythos im Kontext der römischen Bestattungskultur?
Das Kapitel zur Deutung des Mythos auf sepulkraler Ebene untersucht die Intention der Wahl des Alkestis-Mythos für Sarkophage und beleuchtet die damit verbundenen symbolischen Bedeutungen im Kontext der römischen Bestattungskultur.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alkestis-Mythos, Sarkophagreliefs, römische Kaiserzeit, Ikonographie, Sepulkralkunst, Komposition, Szeneneinteilung, Figureninterpretation, Bestattungskultur, Mythosdeutung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich unter anderem auf Euripides' Tragödie und einen Aufsatz von Karl Dissel (bezüglich der literarischen Überlieferung des Alkestis-Mythos) sowie verschiedene Forscherperspektiven zur Interpretation der Sarkophage.
- Citar trabajo
- Katrin Skibbe (Autor), 2010, Alkestis in der Kunst. Ein griechischer Mythos auf kaiserzeitlichen Sarkophagen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321231