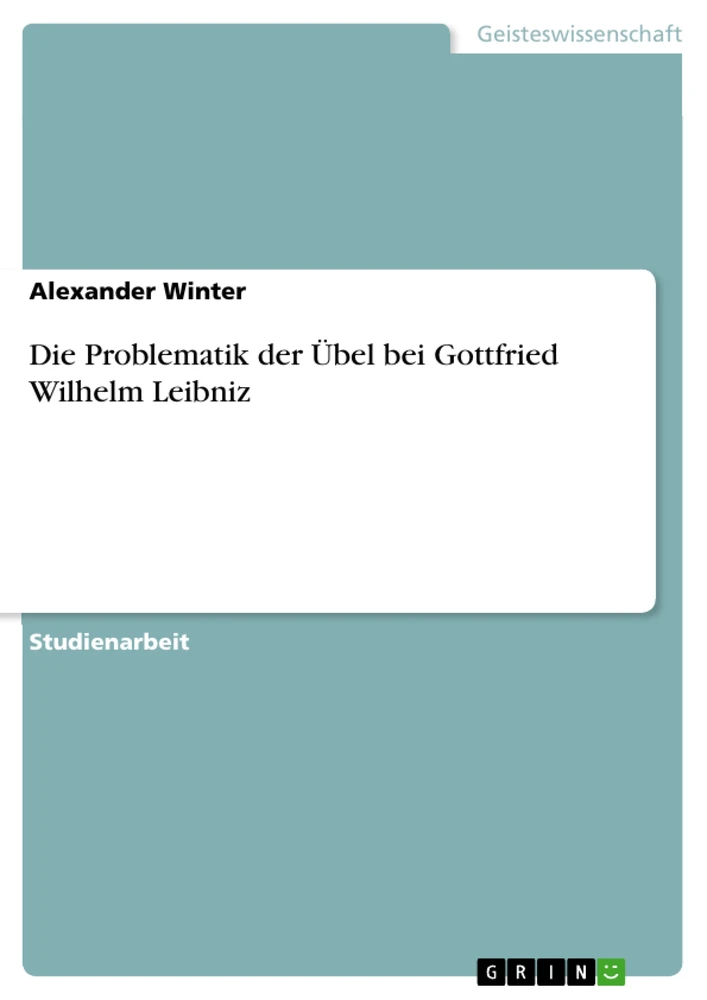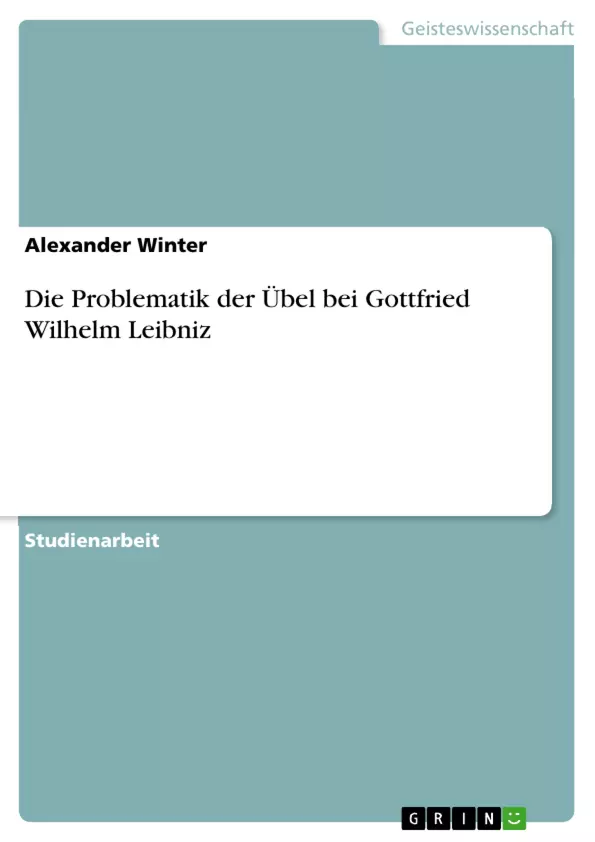In der berühmten Science-Fiction Serie „Star Trek“ gerät der Protagonist Captain Kirk in der Folge „Spiegelwelten“ in eine Welt, in der sein Parallel-Ich böse ist. Diese Parallelwelt funktioniert nach denselben Gesetzen und doch unterscheiden sich alle Parallel-Figuren charakterlich von der Mannschaft des Captains. Der unwahrscheinliche Fall tritt ein und Captain Krik trifft auf das exakte Spiegelbild seiner Person. Der Film ist natürlich nur Fiktion und zeigt das hypothetische Aussehen einer anderen Welt. Er streift die Thematik der möglichen Welten, der zufolge unsere Welt nur eine von vielen möglichen Welten ist. Folgt man Richard Dawkins (*1936), ist es zwar wahrscheinlich, dass Leben überhaupt entsteht, aber angesichts des unendlichen Raumes müsste eine unendliche Anzahl an Welten existieren.
Während „Star Trek“ bei einem Gedankenspiel bleibt, streift die Philosophie wesentlichere Fragen, nämlich nicht nur Struktur und Aussehen möglicher Welten, sondern auch, ob sie tatsächlich existieren können, welche Rolle die unsrige Welt inmitten all dieser denkbaren anderen Welten besitzt und – dies betrifft die Theologie – an welcher Stelle der Schöpfergott steht. Dawkins, der ganz naturwissenschaftlich arbeitet, sieht einen Schöpfergott als überflüssig an. Gottfried Wilhelm Leibniz hingegen hat die Mögliche-Welten-Idee erstmals formuliert und aus ihr einen Gottesbeweis geformt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Die Problematik der Übel bei Leibniz
- I. Gottfried Wilhelm Leibniz und sein zeitgeschichtlicher Hintergrund
- II. Leibniz Gottesbeweis: Die beste aller möglichen Welten
- 1. Zum Gottesbegriff
- 2. Mögliche Welten
- a) Beschaffenheit von möglichen Welten
- b) Unendliche Anzahl möglicher Welten
- c) Unsere Welt: Bewusster Beschluss Gottes
- 3. Die wirkliche Welt
- a) Das Übel als notwendige Komponente
- b) Weltordnung
- c) Gott oder Mensch: Wer trägt Schuld am moralischen Übel?
- C. Die Theodizee: Ein Gottesbeweis?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist es, Leibniz' Theodizee zu untersuchen und seine Argumentation für die beste aller möglichen Welten zu analysieren. Dabei wird insbesondere der Zusammenhang zwischen Gottes Eigenschaften (Allmacht, Allwissenheit, Allgüte), dem Problem des Übels und der Existenz möglicher Welten beleuchtet.
- Leibniz' Gottesbeweis und die beste aller möglichen Welten
- Das Problem des Übels in der Welt und seine theologische Relevanz
- Die Rolle der Möglichen-Welten-Theorie in Leibniz' Philosophie
- Leibniz' Verständnis von Gottes Freiheit und Allmacht
- Der Einfluss der Naturwissenschaften auf die theologische Debatte im 17. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der möglichen Welten ein, ausgehend von einem Beispiel aus der Science-Fiction-Serie „Star Trek“. Sie stellt den Gegensatz zwischen der naturwissenschaftlichen Sichtweise (Dawkins) und der philosophisch-theologischen Sichtweise (Leibniz) auf die Frage nach der Existenz und Beschaffenheit möglicher Welten dar und leitet damit zur zentralen Fragestellung nach Leibniz' Theodizee über.
B. Die Problematik der Übel bei Leibniz: Dieses Kapitel stellt das Problem des Übels in der Welt als Ausgangspunkt für Leibniz' Theodizee dar. Es wird deutlich gemacht, dass die Existenz von Übel die Annahme eines allmächtigen und allgütigen Gottes in Frage stellt und ein zentrales Problem für monotheistische Religionen darstellt. Leibniz' „Beste-Welten-Theorie“ wird als Lösungsansatz vorgestellt.
I. Gottfried Wilhelm Leibniz und sein zeitgeschichtlicher Hintergrund: Dieser Abschnitt zeichnet ein Bild von Leibniz als Universalgelehrten und beschreibt den historischen Kontext seiner Theodizee. Es werden die Herausforderungen durch die aufkommenden Naturwissenschaften und die damit verbundene kritische Auseinandersetzung mit traditionellen Glaubensinhalten erläutert. Der Konflikt zwischen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und theologischen Positionen wird im Bezug auf das Problem des Leids in der Welt dargestellt und die Reaktion Leibniz' darauf als Versuch, das christliche Gottesbild mit der neuen naturwissenschaftlichen Sichtweise zu vereinbaren, skizziert.
II. Leibniz Gottesbeweis: Die beste aller möglichen Welten: Hier wird Leibniz' Theodizee als Antwort auf Bayle’s „Dictionnaire“ präsentiert. Der Fokus liegt auf Leibniz' Argumentation, dass die von Gott erschaffene Welt die beste aller möglichen Welten ist, unter Berücksichtigung seiner Theorie vom lückenlosen Verlauf der Weltgeschichte. Es wird betont, dass Leibniz nicht jedes einzelne Leid erklären will, sondern einen übergeordneten Gottesbeweis anstrebt, der die Existenz eines gütigen und allmächtigen Gottes trotz des Vorhandenseins von Übel begründet.
1. Zum Gottesbegriff: Dieser Abschnitt beleuchtet Leibniz' Verständnis von Gott. Die Eigenschaften Allmacht, Allwissenheit und Allgüte werden als grundlegende Postulate definiert und ausführlich erläutert. Leibniz' Verständnis von Gottes Freiheit, die nicht mit Indifferenz, sondern mit Vernunft und Einsicht verbunden ist, wird detailliert dargestellt, ebenso wie die Verbindung von Gottes Güte und Allwissenheit, die dazu führt, dass Gottes Wille nur das Gute und Wahre zum Gegenstand haben kann.
Schlüsselwörter
Theodizee, Leibniz, Gottesbeweis, beste aller möglichen Welten, Problem des Übels, Mögliche-Welten-Theorie, Allmacht, Allwissenheit, Allgüte, Gottesfreiheit, Naturwissenschaften, Theologie, 17. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen zu Leibniz' Theodizee
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Übersicht über Gottfried Wilhelm Leibniz' Theodizee. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Zielsetzung und der behandelten Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Text analysiert Leibniz' Argumentation für die "beste aller möglichen Welten" und beleuchtet den Zusammenhang zwischen Gottes Eigenschaften (Allmacht, Allwissenheit, Allgüte), dem Problem des Übels und der Existenz möglicher Welten.
Was ist das zentrale Thema des Textes?
Das zentrale Thema ist Leibniz' Theodizee, also seine Antwort auf das Problem des Übels in der Welt. Der Text untersucht, wie Leibniz versucht, die Existenz von Übel mit der Annahme eines allmächtigen und allgütigen Gottes zu vereinbaren, indem er die Vorstellung der "besten aller möglichen Welten" entwickelt.
Welche Aspekte von Leibniz' Philosophie werden behandelt?
Der Text behandelt verschiedene Aspekte von Leibniz' Philosophie, darunter sein Gottesbeweis, seine Theorie der möglichen Welten, sein Verständnis von Gottes Eigenschaften (Allmacht, Allwissenheit, Allgüte und Freiheit), und die Rolle der Naturwissenschaften im Kontext seiner theologischen Argumentation. Der historische Kontext von Leibniz' Werk im 17. Jahrhundert wird ebenfalls beleuchtet.
Wie wird das Problem des Übels in Leibniz' Philosophie behandelt?
Das Problem des Übels wird als zentraler Ausgangspunkt für Leibniz' Theodizee dargestellt. Die Existenz von Übel stellt die Annahme eines allmächtigen und allgütigen Gottes in Frage. Leibniz versucht dieses Problem zu lösen, indem er argumentiert, dass die von Gott erschaffene Welt die beste aller möglichen Welten ist, selbst wenn sie Übel enthält. Die "Beste-Welten-Theorie" wird als Lösungsansatz vorgestellt und analysiert.
Welche Rolle spielt die Theorie der möglichen Welten in Leibniz' Argumentation?
Die Theorie der möglichen Welten spielt eine entscheidende Rolle in Leibniz' Argumentation. Er postuliert eine unendliche Anzahl möglicher Welten, aus denen Gott die beste ausgewählt hat. Diese beste Welt enthält zwar Übel, aber dieses Übel ist notwendig, um eine noch bessere Welt zu ermöglichen. Die Beschaffenheit dieser möglichen Welten und die Auswahl der wirklichen Welt durch Gott werden detailliert untersucht.
Wie wird Leibniz' Gottesbegriff dargestellt?
Leibniz' Gottesbegriff wird durch die Eigenschaften Allmacht, Allwissenheit und Allgüte definiert. Der Text analysiert, wie diese Eigenschaften miteinander verbunden sind und wie sie in seine Argumentation für die beste aller möglichen Welten eingehen. Besonders wird Leibniz' Verständnis von Gottes Freiheit erörtert, die nicht mit Willkür, sondern mit Vernunft und Einsicht verbunden ist.
Welchen historischen Kontext hat Leibniz' Theodizee?
Der Text beleuchtet den historischen Kontext von Leibniz' Theodizee im 17. Jahrhundert. Die Herausforderungen durch die aufkommenden Naturwissenschaften und die kritische Auseinandersetzung mit traditionellen Glaubensinhalten werden im Bezug auf das Problem des Leids in der Welt dargestellt. Leibniz' Arbeit wird als Versuch gesehen, das christliche Gottesbild mit der neuen naturwissenschaftlichen Sichtweise zu vereinbaren.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Textes relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Theodizee, Leibniz, Gottesbeweis, beste aller möglichen Welten, Problem des Übels, Mögliche-Welten-Theorie, Allmacht, Allwissenheit, Allgüte, Gottesfreiheit, Naturwissenschaften, Theologie, 17. Jahrhundert.
- Arbeit zitieren
- Alexander Winter (Autor:in), 2011, Die Problematik der Übel bei Gottfried Wilhelm Leibniz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321247