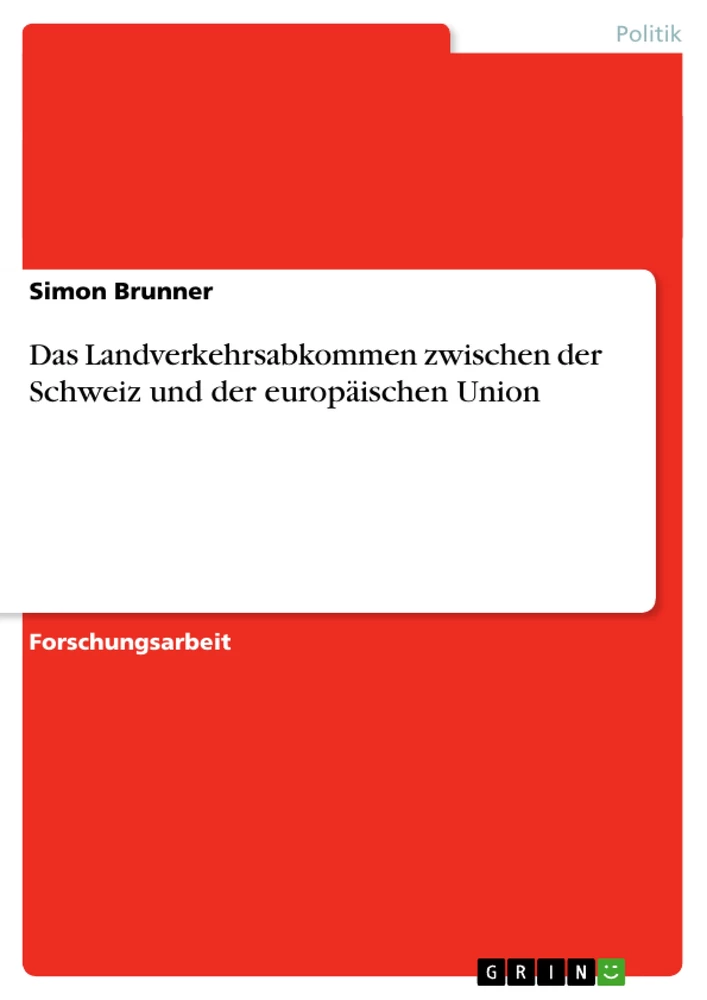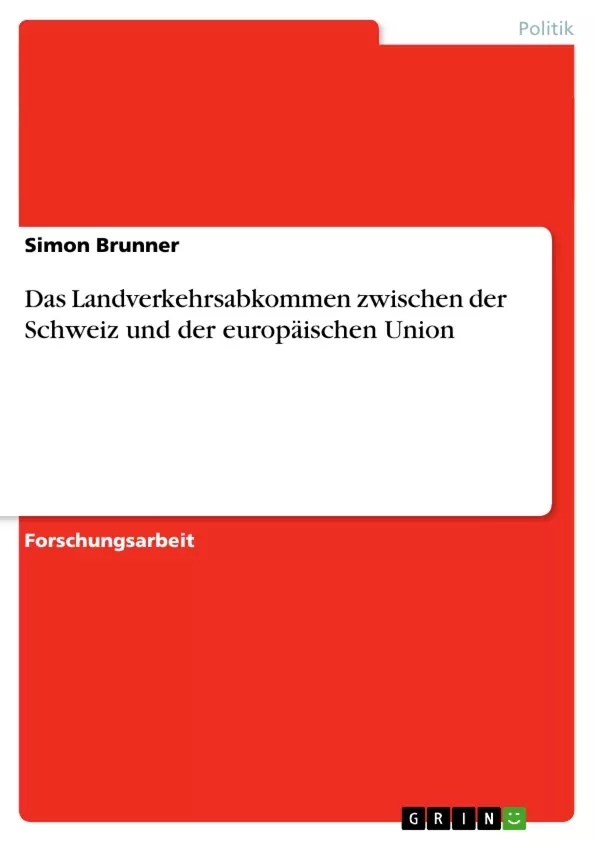Seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft (1993 in Europäische Union (EU) umbenannt) und noch in verstärktem Masse seit der Schaffung eines europäischen Binnenmarktes muss die Schweiz Stellung dazu beziehen, wie die Beziehung zu ihrem wichtigsten Handelspartner (60% der Exporte, 80% der Importe) aussehen soll. Auch für die EU ist diese Beziehung wichtig, zumal die Schweiz den zweiten Platz belegt in der Rangliste der EU Aussenhandelspartner. Die EU hätte die Schweiz gerne als Mitgliedstaat. Solange die Schweiz der EU nicht beitritt, stellt sich die Frage, wie weit die wirtschaftliche Integration gehen soll. Ein erster Schritt fand 1972 mit der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens zwischen der Schweiz und der EU (damals noch EG) statt. Die Schweizer Regierung wollte diese Integrationsbewegung weiter vorantreiben, ein gemeinsamer Wirtschaftsraum war das Ziel. Das Schweizer Volk lehnte jedoch 1992 den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ab aus Angst vor einem Souveränitätsverlust und vor Massenimmigration ausländischer Arbeitskräfte.
Die EWR-Gegner unterbreiteten einen Gegenvorschlag. Die wichtigsten wirtschaftlichen Fragen sollten durch bilaterale Verträge mit der EU geregelt werden. Diese Verträgen würden den gemeinsame Markt öffnen, ohne die Souveränität der Schweiz zu tangieren. Das bedeutet: Eine klare Lösung bei der Personenfreizügigkeit und eine möglichst weitgehende Wahrung der gesetzgeberischen Autonomie. Der Vorschlag wurde vom Bundesrat angenommen. Ursprünglich wurden Verträge in 16 Teilgebieten angestrebt. Das resultierende Paket umfasste noch sieben Sektoren (Luft- und Landverkehr, Personenverkehr, Forschung, öffentliches Beschaffungswesen, Landwirtschaft sowie die Beseitigung technischer Handelshemmnisse). Eine gemeinsame Verkehrspolitik im Schwerverkehr der EU und der Schweiz wurde erstmals 1992 mit dem Transitabkommen in angegangen. Da die beiden Vertragspartner jedoch sehr unterschiedlichen Politiken folgten, war das Abkommen nicht sehr weitreichend. Die Schweiz strebte „wahre Kosten“ und Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene an, die EUMitgliedstaaten wollten, dass der Güterverkehr so günstig wie möglich sei. Diese unterschiedlichen Positionen trafen in der Verhandlungen zum Landverkehrsabkommen erneut aufeinander und führten dazu, dass die Verhandlungen insgesamt sechs Jahre lang dauerten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Fragestellung
- Beschreibung des empirischen Falles
- Forschung und Quellenlage
- Fragestellung
- Theorie und Hypothesen
- Die Geschichte der Mehrebenenspieltheorie
- Robert Putnams Two-Level Games, die Prämissen
- Hypothesen
- Schweizer Win-Set
- EU Win-Set
- Hypothesenmodell
- Theorieanwendung
- Die Mehrebenenanalyse
- Schweiz
- Ebene I
- Ebene II
- Hypothese I.
- Hypothese II
- Die EU
- Ebene I
- Ebene II
- Hypothese III
- Der Transitpreis
- Schlussfolgerung
- Erkenntnisse
- Kritik an der Theorie
- Kritik am Forschungsdesign
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Transitpreis im Landverkehrsabkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Sie beleuchtet die Verhandlungen unter dem Fokus, wie ein kleines Land seine Interessen gegenüber einem grösseren Partner durchsetzen kann. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit die Schweiz ihre eigene Verkehrspolitik im Rahmen des Abkommens durchsetzen konnte und ob die Strategie der bilateralen Verträge mit der EU der EU-Mitgliedschaft vorzuziehen ist. Im Mittelpunkt stehen die innenpolitischen Faktoren und die Anwendung der Mehrebenenspieltheorie.
- Analyse der Verhandlungen zum Landverkehrsabkommen zwischen der Schweiz und der EU
- Bewertung der Möglichkeiten eines kleinen Landes, seine Interessen gegenüber einem grösseren Partner zu wahren
- Bedeutung der direkten Demokratie in der Schweizer Aussenpolitik
- Anwendung der Mehrebenenspieltheorie auf internationale Verhandlungen
- Vergleich der Strategien der bilateralen Verträge und der EU-Mitgliedschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung und Fragestellung: Dieses Kapitel beschreibt die Situation der Schweiz im Verhältnis zur EU nach der Gründung des Binnenmarktes und die Entwicklung der bilateralen Verträge. Es wird die Problematik der Personenfreizügigkeit und der Wahrung der Schweizer Souveränität erörtert, sowie die Entstehung des Landverkehrsabkommens im Kontext der Verhandlungen. Die Fragestellung zielt darauf ab, die Möglichkeiten der Schweiz in Verhandlungen mit der EU zu analysieren, unter dem Fokus des Transitpreises und der Durchsetzung der Schweizer Verkehrspolitik.
- Theorie und Hypothesen: Dieses Kapitel stellt die Mehrebenenspieltheorie vor und erläutert deren Anwendbarkeit auf internationale Verhandlungen. Es werden die zentralen Elemente der Theorie von Robert Putnam, die Prämissen und die Anwendung auf den Fall Schweiz-EU dargestellt. Die Kapitel enthält die Formulierung von Hypothesen, welche die Beziehung zwischen den Schweizer und EU Interessen und dem Transitpreis untersuchen.
- Schweiz: Dieser Abschnitt analysiert die Schweizer Position in den Verhandlungen zum Landverkehrsabkommen. Es werden die Schweizer Interessen auf Ebene I und II der Mehrebenenspieltheorie dargestellt, insbesondere die Bedeutung der direkten Demokratie und der innenpolitischen Faktoren. Die beiden Hypothesen werden auf die Schweizer Seite angewendet.
- Die EU: Dieser Abschnitt analysiert die europäische Position in den Verhandlungen. Die Interessen der EU auf Ebene I und II werden dargestellt, und die dritte Hypothese wird auf die EU-Seite angewendet.
- Der Transitpreis: Dieses Kapitel beleuchtet den Transitpreis als ein zentrales Element des Abkommens. Die Herausforderungen der Festsetzung eines fairen Preises und der unterschiedlichen Interessen von Schweiz und EU werden erläutert. Es wird die Relevanz des Transitpreises für die Schweizer Verkehrspolitik und die Beziehungen zur EU dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit wichtigen Schlüsselbegriffen wie: Landverkehrsabkommen, Mehrebenenspieltheorie, Transitpreis, bilaterale Verträge, EU-Mitgliedschaft, Schweizer Interessen, direkte Demokratie, Verkehrspolitik, Interessenvertretung, Verhandlungen.
Häufig gestellte Fragen
Was regelt das Landverkehrsabkommen zwischen der Schweiz und der EU?
Es regelt den grenzüberschreitenden Straßen- und Schienenverkehr, wobei die Schweiz insbesondere die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene und die Einführung einer leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) anstrebte.
Warum lehnte die Schweiz 1992 den EWR-Beitritt ab?
Die Ablehnung erfolgte aus Angst vor einem Souveränitätsverlust und einer unkontrollierten Massenimmigration ausländischer Arbeitskräfte.
Was ist die Mehrebenenspieltheorie nach Robert Putnam?
Die Theorie besagt, dass internationale Verhandlungen auf zwei Ebenen stattfinden: der internationalen Ebene (Ebene I) und der innenpolitischen Ebene (Ebene II). Ein Verhandlungsergebnis muss auf beiden Ebenen akzeptabel sein.
Was versteht man unter dem "Transitpreis"?
Der Transitpreis ist die Gebühr, die für die Durchquerung der Schweiz durch den Schwerverkehr erhoben wird. Er war ein zentraler Streitpunkt in den Verhandlungen mit der EU.
Kann ein kleines Land wie die Schweiz seine Interessen gegenüber der EU durchsetzen?
Die Arbeit zeigt, dass die Schweiz durch geschickte Verhandlungsstrategien und den Verweis auf die direkte Demokratie (Volksabstimmungen) ihre Positionen im Landverkehrsabkommen weitgehend wahren konnte.
- Quote paper
- Simon Brunner (Author), 2001, Das Landverkehrsabkommen zwischen der Schweiz und der europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32125