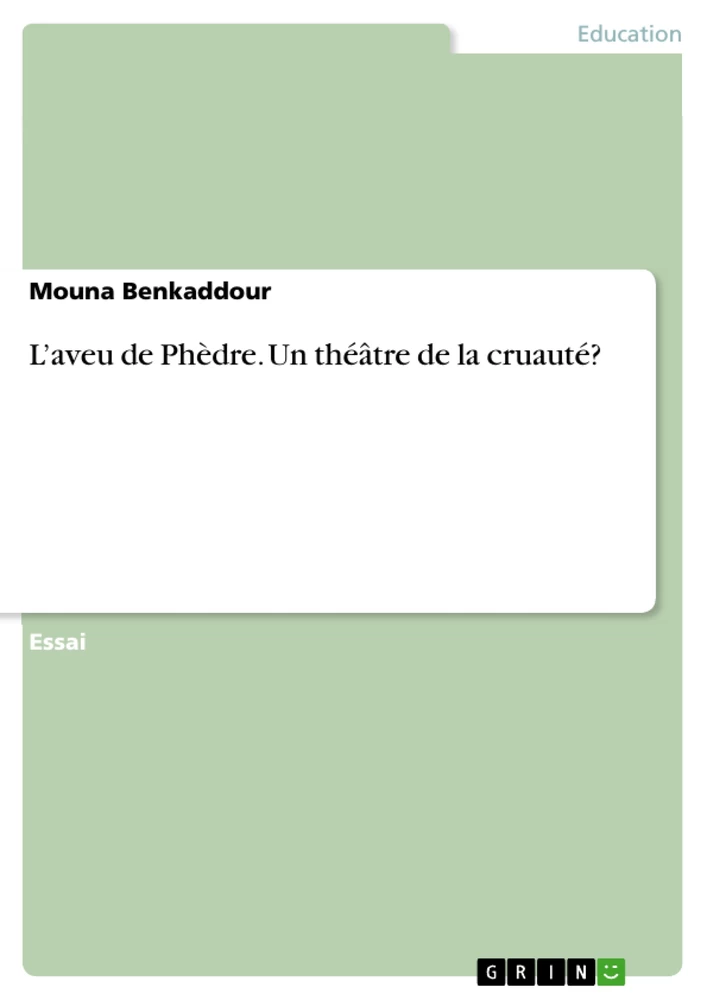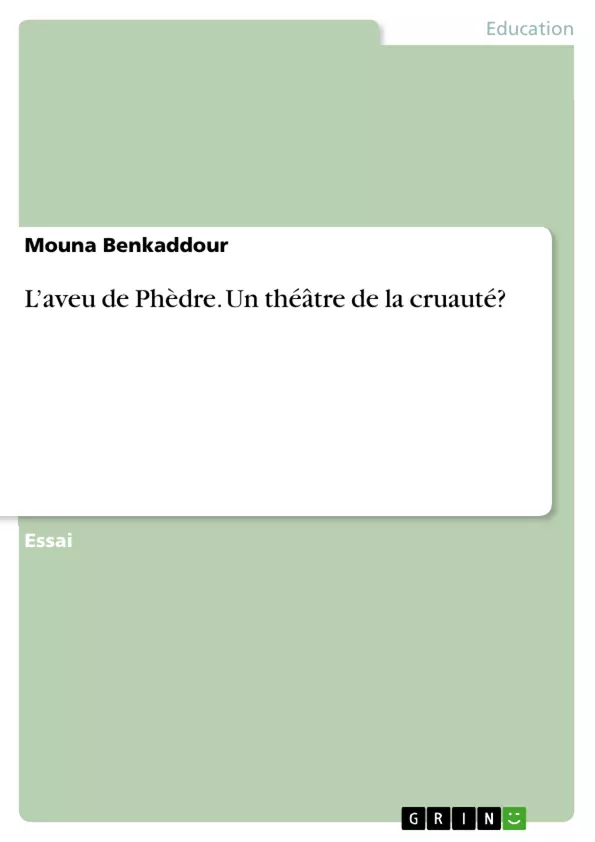La conception du «tendre Racine», l'auteur classique, de l'amour et des passions fait partie de plusieurs interprétations connues de l’œuvre de Racine. Roland Barthes propose une nouvelle perspective sur le théâtre. Par une étude structuraliste, il renverse l'image «du tendre Racine», non pas en dévalorisant son œuvre, mais en faisant ressortir un monde sombre du héros racinien qui est parfaitement dévoilé par le langage. La pièce Phèdre peut servir d'exemple pour examiner de plus près l'idée d'un «théâtre de la cruauté». Dans cette analyse, on mettra l'accent sur l'aveu de Phèdre à Hippolyte (Acte II, scène 5).
Die Konzeption eines "tendre Racine", dem klassischen Autor der Liebe und der Leidenschaften, ist Teil vieler Interpretationen des Werkes Racines. Roland Barthes vermittelt einen neuen Blick auf das Werk Racines. Anhand einer strukturalistischen Studie, kehrt er das Bild des "tendre Racine" um, indem er in Racines Theater ein "Theater der Grausamkeit" projeziert, dass gerade wegen der Sprache Racines perfekt verdeckt wird. Das Stück Phédre kann hier als Beispiel dienen, um diese Idee näher zu erläutern. Hier wird der Akzent auf das Liebesgständnis der Phädra an Hippolyte liegen (Acte II, Szene 5).
Inhaltsverzeichnis
- Introduction
- I. Die Relation fondamentale
- II. L'éros immédiat und der Fantasme
- III. Der Vater und die Schuld
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert Jean Racines Tragödie "Phèdre" unter dem Blickwinkel von Roland Barthes' struktureller Interpretation des klassischen Autors. Barthes stellt die traditionelle Vorstellung von Racine als "zarten" Autor infrage und enthüllt eine tiefere, dunkle Seite der Sprache und der Figuren im Stück. Der Essay konzentriert sich auf die Aveu-Szene von Phèdre an Hippolyte und untersucht die Bedeutung des Sprachgebrauchs und den Einfluss der "deux éros" auf die Entwicklung der Tragödie.
- Die Rolle der Sprache in der Darstellung von Macht und Liebe
- Die Bedeutung des "éros immédiat" und der Fantasie in der Beziehung zwischen Phèdre und Hippolyte
- Der Einfluss der Götter und des "Vaters" auf das Schicksal der Figuren
- Die Tragödie als "Procès de Dieu" und die Schuld der Figuren
- Der Zusammenhang zwischen Sprache und Handlung in der Tragödie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung präsentiert die These des Essays: die Analyse der Aveu-Szene von Phèdre an Hippolyte in "Phèdre" unter dem Blickwinkel von Roland Barthes' struktureller Interpretation von Racine. Das erste Kapitel behandelt die "relation fondamentale" zwischen Phèdre und Hippolyte und untersucht die Dominanz von Phèdre in der Gesprächsdynamik. Das zweite Kapitel analysiert die Theorie von Barthes' "éros immédiat" und dem Fantasme, indem es die Aveu-Szene als Beispiel für die Wirkung der "deux éros" auf die Beziehung zwischen Phèdre und Hippolyte betrachtet. Das dritte Kapitel untersucht den Einfluss des "Vaters" und der Schuld auf das Schicksal der Figuren und interpretiert die Rolle der Götter als "Deus ex machina" in der Tragödie.
Schlüsselwörter
Der Essay fokussiert auf die folgenden Schlüsselwörter: Jean Racine, "Phèdre", Roland Barthes, "deux éros", Aveu, Sprache, Macht, Liebe, Fantasme, Schuld, Götter, Tragödie, "Procès de Dieu".
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Roland Barthes unter einem „Theater der Grausamkeit“ bei Racine?
Barthes bricht mit dem Bild des „zarten Racine“ und zeigt durch eine strukturalistische Analyse eine dunkle Welt der Leidenschaften und Machtkämpfe auf, die durch die klassische Sprache perfekt verdeckt wird.
Welche Bedeutung hat das Liebesgeständnis (Aveu) von Phädra an Hippolyt?
Die Aveu-Szene (Akt II, Szene 5) ist zentral für die Tragödie. Sie offenbart die zerstörerische Kraft des „éros immédiat“ und markiert den Punkt, an dem die Sprache zur Tat wird.
Was ist die „relation fondamentale“ in Racines Stücken?
Es beschreibt die grundlegende Machtbeziehung zwischen den Figuren, oft geprägt von Abhängigkeit, Dominanz und der Unmöglichkeit, die eigenen Leidenschaften zu kontrollieren.
Wie beeinflussen die Götter und der „Vater“ das Schicksal in Phèdre?
Die Figuren sind in einem „Procès de Dieu“ gefangen. Die Götter und die Abwesenheit des Vaters (Theseus) fungieren als übergeordnete Instanzen, die Schuld und Untergang der Helden besiegeln.
Welche Rolle spielt die Sprache in dieser Tragödie?
Die Sprache dient nicht nur der Kommunikation, sondern ist ein Instrument der Macht und der Offenbarung innerer Abgründe, die das Schicksal der Helden unaufhaltsam vorantreibt.
Was meint Barthes mit „éros immédiat“ und „Fantasme“?
Es bezeichnet die unmittelbare, oft irrationale Begierde und die damit verbundenen Trugbilder (Fantasmen), die die Wahrnehmung der Realität bei den Helden wie Phädra verzerren.
- Citar trabajo
- Mouna Benkaddour (Autor), 2016, L’aveu de Phèdre. Un théâtre de la cruauté?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321258