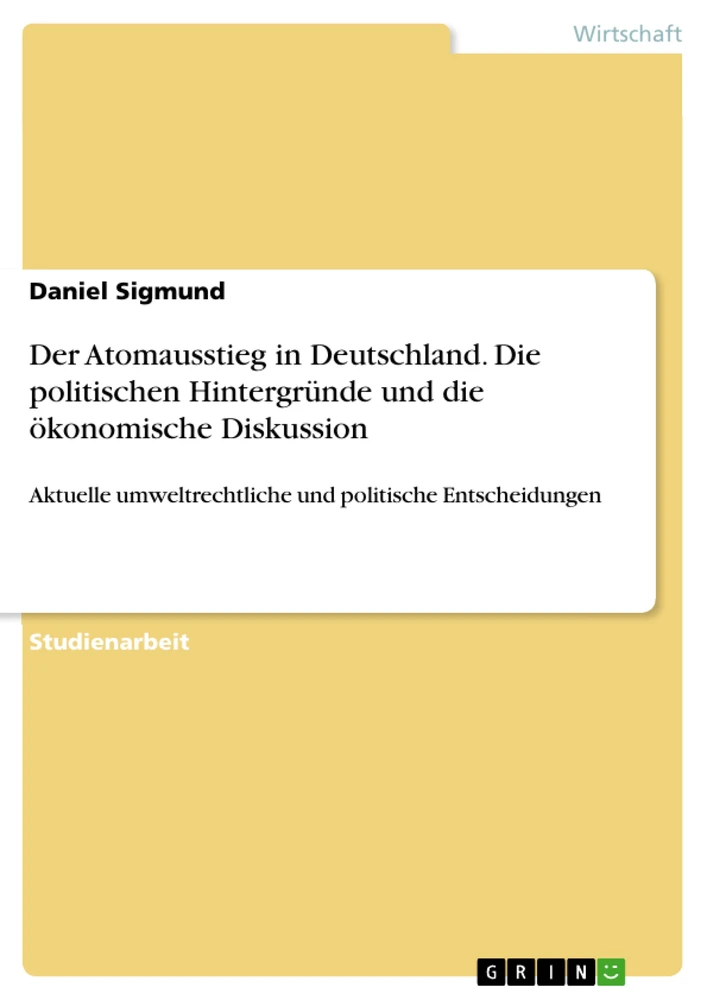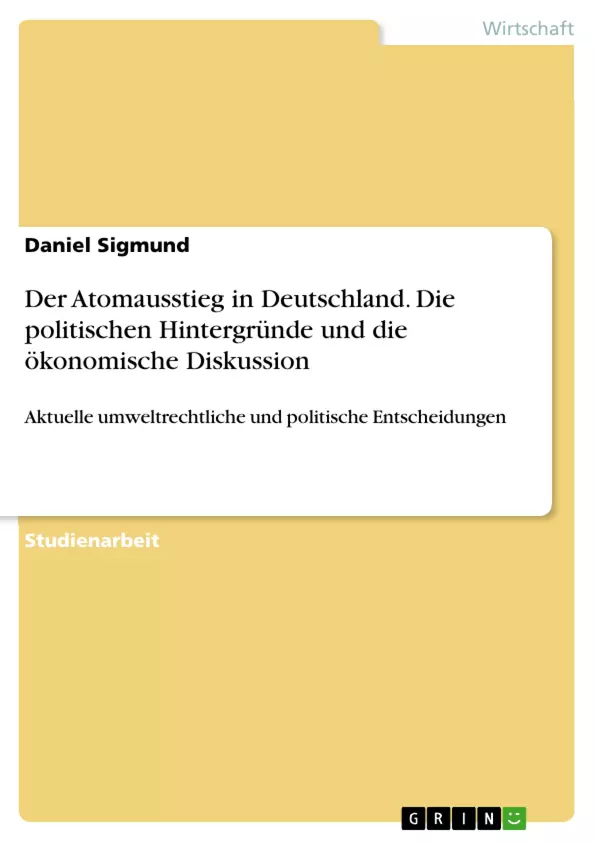Mit großer Mehrheit wurde am 30. Juni 2011 der deutsche Atomausstieg beschlossen. Bis dahin war es kein einfacher Weg. Zunächst wurden große Hoffnungen in die Atomkraft gesetzt und sowohl in West- als auch Ostdeutschland mit dem Bau von Atomkraftwerken (AKW) begonnen. Doch sowohl die politische als auch die gesellschaftliche Haltung änderten sich: Bereits im Jahr 2000 wurde der geregelte Atomausstieg von der Bundesregierung festgelegt, jedoch von der neuen Regierung im Jahr 2010 wieder revidiert und nach der Katastrophe in AKW Fukushima im drauffolgenden Jahr erneut beschlossen.
Anhand dieser Entwicklungen ist zu erkennen, dass die Frage der Nutzung von Atomkraft stark diskutiert wurde und auch in Zukunft weiterhin diskutiert wird. Sie bietet zwar einige Vorteile wie die geringen CO2-Emissionen, birgt aber gleichzeitig auch ein Risiko für Mensch und Umwelt. Auch international ist die Meinung über die Atomkraft geteilt. Während einige Länder ganz auf die Atomkraft verzichten, sind in anderen Ländern bereits neue AKW geplant.
Doch auch nach dem beschlossenen Atomausstieg in Deutschland ist die Problematik der Atomkraft nicht gelöst. Vor allem die derzeitige Suche nach einem geeigneten Endlager wird weiterhin für Diskussionen sorgen. Dies wird noch gesteigert, da sich die Energiekonzerne nicht an den Kosten beteiligen möchten und stattdessen versuchen ihre AKW an den Staat abzugeben, um weitere Verluste zu vermeiden.
Welche Gründe schlussendlich für den Atomausstieg in Deutschland verantwortlich sind, soll in dieser Arbeit genauer untersucht werden. Dazu werden der gesellschaftliche und der politische Wandel sowie seine möglichen Ursachen genauer betrachtet. Außerdem werden ökologische und ökonomische Folgen des Atomausstiegs dargestellt und bewertet. Danach wird die Rolle Deutschlands als Vorbild in den internationalen Kontext gesetzt und kurz dargestellt. Als Abschluss der Arbeit dienen ein Fazit und einer Stellungnahme des Autors zum deutschen Atomausstieg.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wandel der Akzeptanz in der Gesellschaft
- Politischer Wandel – Der Streit um die Atomfrage
- Kann Atomkraft sicher sein?
- Umweltfreundlichkeit – Klimaneutralität vs. radioaktiver Abfall
- Der Atomausstieg und seine ökonomischen Folgen
- Deutschland als Vorbild für die Welt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert den deutschen Atomausstieg, beleuchtet dessen politische Hintergründe und setzt sich mit der ökonomischen Diskussion auseinander. Sie untersucht den Wandel der Akzeptanz von Atomkraft in der Gesellschaft und zeigt die politischen Entwicklungen auf, die zum Atomausstieg geführt haben. Die Arbeit beleuchtet die Sicherheitsfrage der Atomkraft und diskutiert die ökologischen Folgen des Atomausstiegs im Hinblick auf die Klimaneutralität und die Problematik des radioaktiven Abfalls. Zudem werden die ökonomischen Folgen des Atomausstiegs auf die deutsche Wirtschaft und Energieversorgung betrachtet.
- Gesellschaftlicher und politischer Wandel der Atomkraftnutzung
- Sicherheitsbedenken und Risiken der Atomkraft
- Ökologische Folgen des Atomausstiegs (Klimaneutralität, radioaktiver Abfall)
- Ökonomische Folgen des Atomausstiegs (Stromversorgung, Kosten)
- Deutschland als Vorbild für andere Länder im internationalen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den deutschen Atomausstieg als Ergebnis eines langen Prozesses dar, der von unterschiedlichen Perspektiven und Entwicklungen geprägt wurde. Die Einführung beleuchtet die Vor- und Nachteile der Atomkraft und betont die internationale Debatte darüber.
- Wandel der Akzeptanz in der Gesellschaft: Dieses Kapitel zeichnet die gesellschaftliche Entwicklung der Haltung gegenüber Atomkraft nach, angefangen von der Euphorie der 1960er Jahre über die Anti-AKW-Bewegung in den 1970er Jahren bis hin zur heutigen Ablehnung.
- Politischer Wandel – Der Streit um die Atomfrage: Dieser Abschnitt betrachtet den politischen Wandel der Atomkraftpolitik in Deutschland, von der anfänglichen Unterstützung bis hin zur ersten Vereinbarung über einen Ausstieg aus der Kernenergie im Jahr 2000. Er beleuchtet die unterschiedlichen Positionen von Parteien und Interessengruppen im Laufe der Zeit.
- Kann Atomkraft sicher sein?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Sicherheit von Atomkraftwerken, insbesondere im Kontext der Katastrophe von Fukushima. Es untersucht die möglichen Gefahren und Risiken, die von AKWs ausgehen, und setzt sich mit der Frage auseinander, ob die Sicherheitsbedenken den deutschen Atomausstieg rechtfertigen.
- Umweltfreundlichkeit - Klimaneutralität vs. radioaktiver Abfall: Hier werden die ökologischen Aspekte der Atomkraft beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt auf der Klimafreundlichkeit der Atomenergie im Vergleich zu fossilen Brennstoffen und der Problematik des radioaktiven Abfalls.
- Der Atomausstieg und seine ökonomischen Folgen: Dieses Kapitel untersucht die wirtschaftlichen Folgen des Atomausstiegs für Deutschland. Es beleuchtet die Kosten der Atomkraft, die Strompreisentwicklung und die Prognosen zur zukünftigen Energieversorgung in Deutschland.
- Deutschland als Vorbild für die Welt: Das Kapitel betrachtet die Rolle Deutschlands im internationalen Kontext, insbesondere im Hinblick auf den weltweiten Trend zur Abkehr von der Atomkraft. Es diskutiert, ob Deutschland mit seinem Atomausstieg ein Vorbild für andere Länder sein kann und welche Auswirkungen dies auf die globale Energiepolitik haben könnte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des Atomausstiegs in Deutschland, insbesondere mit den Begriffen Atomkraft, Kernkraft, Kernenergie, Atomkraftwerke, AKW, Sicherheit, Umweltfreundlichkeit, Klimaneutralität, radioaktiver Abfall, ökonomische Folgen, Strompreis, Energieversorgung, Deutschland, internationale Politik und Vorbildfunktion.
- Arbeit zitieren
- Daniel Sigmund (Autor:in), 2015, Der Atomausstieg in Deutschland. Die politischen Hintergründe und die ökonomische Diskussion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321277