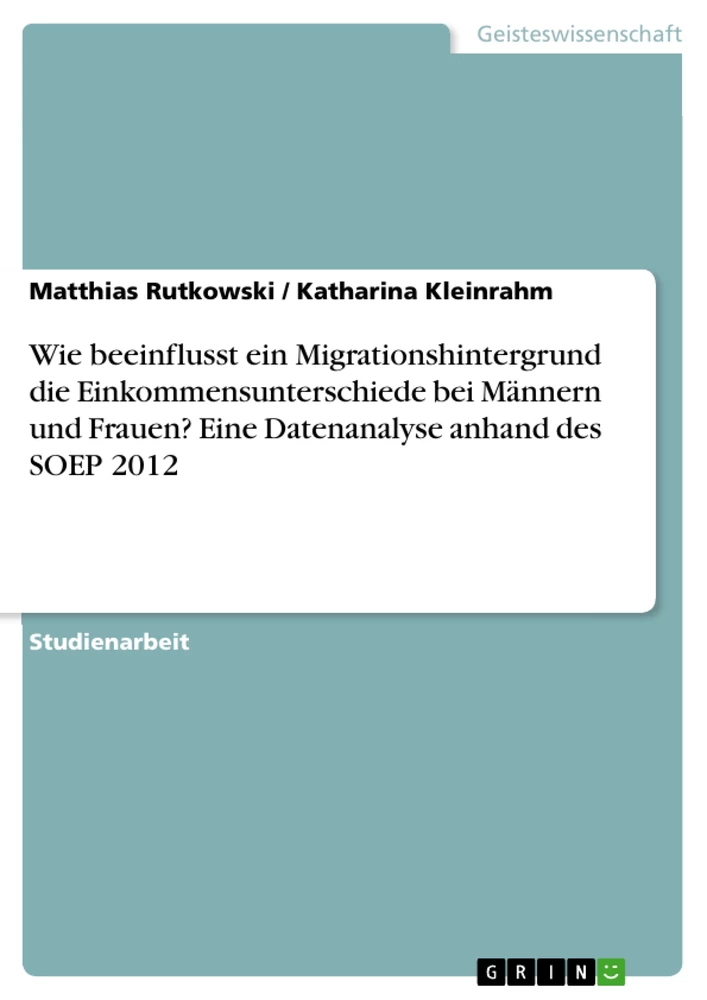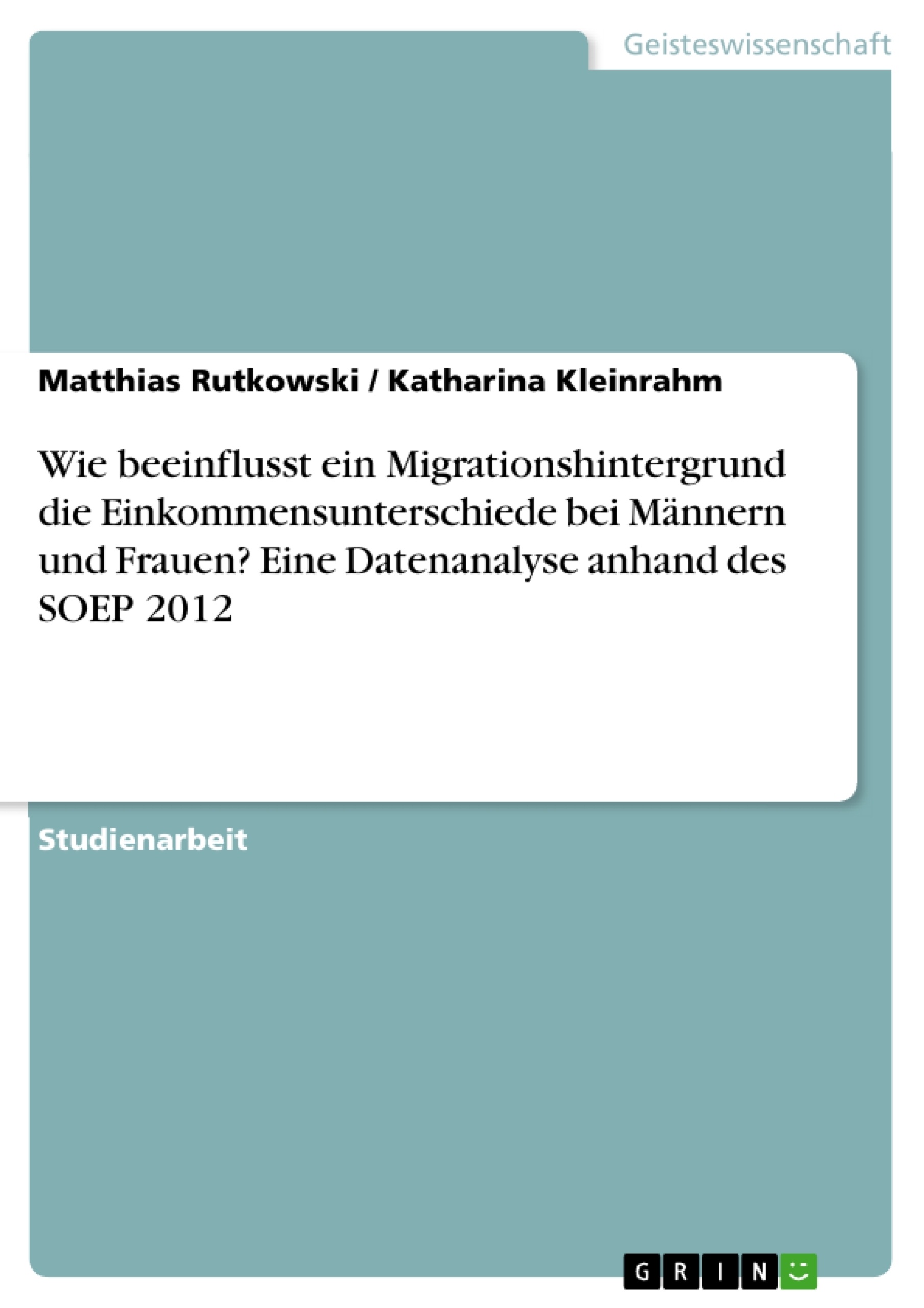Vor dem Hintergrund der aktuellen innen- und außenpolitischen Situation in Deutschland, verschiedener Konzepte zu sozialer Ungleichheit und Geschlechterdiversität begründet sich folgende Fragestellung: wie stark beeinflusst ein Migrationshintergrund die Einkommensunterschiede bei Männern und Frauen?
Zunächst werden in Kapitel zwei die zwei großen theoretischen Grundlagen dargelegt, um dem Leser eine Wissensbasis zu verleihen, auf der anschließend die empirische Fragestellung begründet und untersucht wird. Kapitel 2.1 geht auf verschiedene Aspekte von Einkommensunterschieden ein, daran knüpft Kapitel 2.2 an und stellt theoretische Erkenntnisse über Migration dar. In Kapitel drei folgt die Erläuterung der Fragestellung der Arbeit sowie die Forschungshypothesen. Kapitel zwei und drei bilden die Grundlage dieser empirischen Arbeit.
Mit einer Darstellung des zugrundeliegenden Datensatzes in Kapitel vier wird der empirische Teil eingeleitet und Kapitel fünf beinhaltet die Arbeit am Datensatz. Diese teilt sich in drei Bereiche auf, univariate Statistik, bivariate Statistik und multivariate Statistik. Hier werden die in Kapitel drei aufgestellten Hypothesen überprüft sowie die Hauptfragestellung dieser Arbeit empirisch bearbeitet. Die in Kapitel fünf gewonnenen Erkenntnisse werden anschließend in Kapitel sechs zusammenfassend ausgewertet, in einen Kontext zu den theoretischen Grundlagen gebracht und bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Einkommensunterschiede
- Migration
- Forschungsfrage und Hypothesen
- Vorstellung des Datensatzes SOEP
- Arbeit mit dem Datensatz
- Univariate Statistik
- Bivariate Statistik
- Multivariate Statistik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie stark ein Migrationshintergrund die Einkommensunterschiede bei Männern und Frauen beeinflusst. Sie untersucht diese Frage vor dem Hintergrund der aktuellen innen- und außenpolitischen Situation in Deutschland sowie verschiedener Konzepte zu sozialer Ungleichheit und Geschlechterdiversität.
- Einkommensunterschiede und deren Ursachen
- Theoretische Ansätze zur Erklärung von Migration und deren Auswirkungen
- Analyse der Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) im Hinblick auf Einkommensunterschiede und Migrationshintergrund
- Zusammenhang zwischen Bildung, Erwerbstätigkeit und Nettohaushaltseinkommen (HHN)
- Empirische Überprüfung von Forschungshypothesen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz der Thematik und die Forschungsfrage erläutert. Kapitel zwei behandelt die theoretischen Grundlagen, indem es verschiedene Ansätze zur Erklärung von Einkommensunterschieden und Migration vorstellt. In Kapitel drei werden die Forschungsfrage und die Forschungshypothesen präzisiert. Kapitel vier gibt eine Vorstellung des Datensatzes SOEP, der für die empirische Analyse verwendet wird. Kapitel fünf beschäftigt sich mit der Arbeit am Datensatz, wobei univariate, bivariate und multivariate statistische Verfahren eingesetzt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in Kapitel sechs zusammengefasst, bewertet und in den Kontext der theoretischen Grundlagen gestellt. Die Arbeit endet mit einem persönlichen Fazit.
Schlüsselwörter
Einkommensunterschiede, Migrationshintergrund, SOEP, Humankapitaltheorie, Lebenszyklustheorie, Bildung, Erwerbstätigkeit, Nettohaushaltseinkommen, multivariate Statistik, Geschlechterdiversität, soziale Ungleichheit, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Migration die Einkommensunterschiede in Deutschland?
Die Datenanalyse (basierend auf dem SOEP 2012) untersucht, ob und wie stark ein Migrationshintergrund als Faktor für soziale Ungleichheit und Lohnunterschiede bei Männern und Frauen wirkt.
Was ist das SOEP?
Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) ist eine repräsentative Langzeitstudie in Deutschland, die jährlich Daten zu Einkommen, Erwerbstätigkeit, Bildung und sozialen Merkmalen erhebt.
Welche Theorien erklären Einkommensunterschiede bei Migranten?
Zentrale Ansätze sind die Humankapitaltheorie (Bildung und Erfahrung) sowie die Lebenszyklustheorie, die Unterschiede durch individuelle Erwerbsbiografien erklären.
Gibt es einen „Double Disadvantage“ für Migrantinnen?
Die Forschung untersucht, ob Frauen mit Migrationshintergrund sowohl aufgrund ihres Geschlechts als auch ihrer Herkunft doppelt benachteiligt sind (Intersektionalität).
Welche Rolle spielt die Bildung für das Nettohaushaltseinkommen?
Bildung gilt als Hauptfaktor für den Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Arbeit prüft empirisch, ob höhere Bildungsabschlüsse bei Migranten die gleichen Einkommenseffekte erzielen wie bei Personen ohne Migrationshintergrund.
- Arbeit zitieren
- Matthias Rutkowski (Autor:in), Katharina Kleinrahm (Autor:in), 2016, Wie beeinflusst ein Migrationshintergrund die Einkommensunterschiede bei Männern und Frauen? Eine Datenanalyse anhand des SOEP 2012, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321404