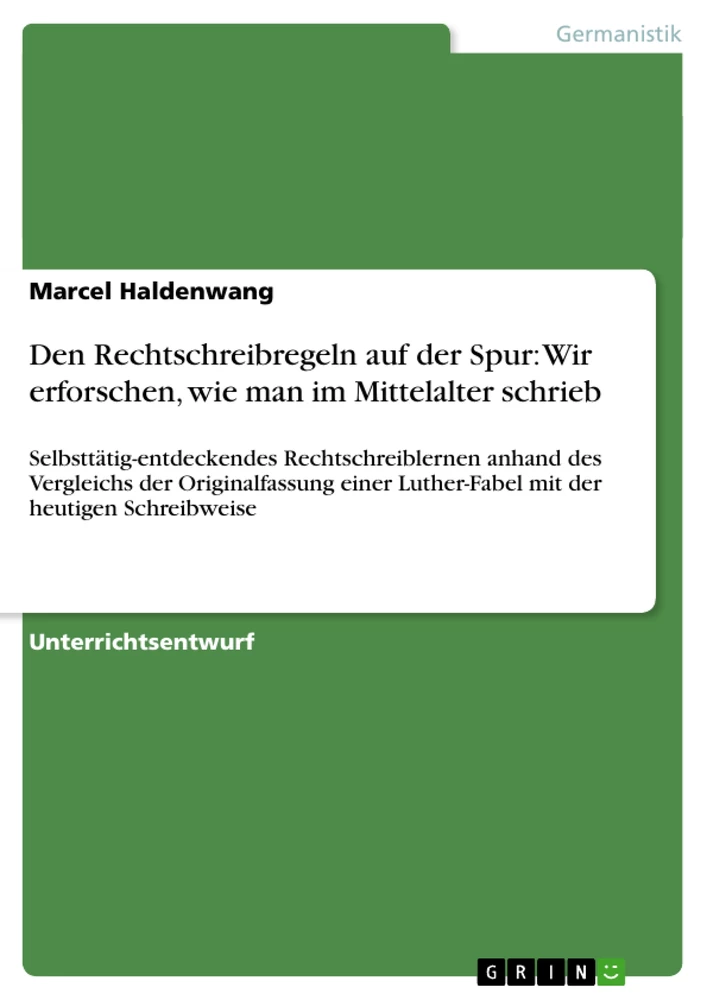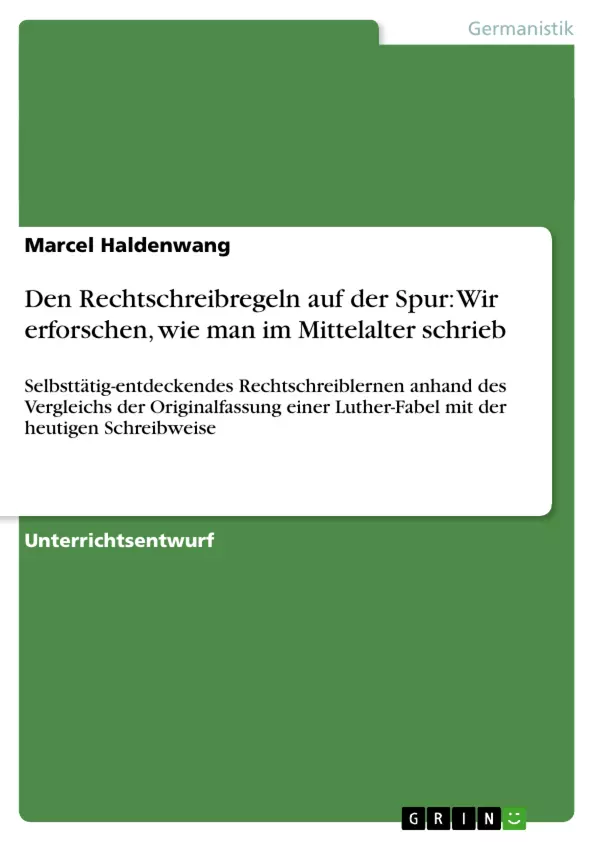In diesem Unterrichtsversuch werden die Schüler nicht mit Regelwissen zur Rechtschreibung überfordert, sondern sie entdecken selbständig Phänomene unserer Rechtschreibung anhand der Originalfassung einer Luther-Fabel. Der Entwurf versucht dabei die Grabenkämpfe der Germanisten bezüglich des Rechtschreiblernens zu skizzieren: Ist Rechtschreibung nur ein Ränkespiel des Bildungsbürgertums? Oder gibt es grammatische Prinzipien, denen die Rechtschreibung folgt? Mit AB und Anregungen zur Binnendiff.
Inhaltsverzeichnis
- Überlegungen zur Lerngruppe
- Überlegungen zum Unterrichtsinhalt
- Überlegungen zur methodischen Gestaltung
- Lernziele
- Verlaufsplan
- Unterrichtsmaterial
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsentwurf beschreibt eine Deutschstunde für die sechste Klasse zum Thema Rechtschreibung im Mittelalter. Ziel ist es, durch einen Vergleich einer Luther-Fabel in Original- und heutiger Schreibweise, ein selbsttätiges und entdeckendes Rechtschreiblernen anzuregen. Die Schüler sollen dabei selbstständig Regelmäßigkeiten der heutigen Rechtschreibung erkennen und die Rechtschreibung als Konvention verstehen.
- Selbsttätiges und entdeckendes Rechtschreiblernen
- Vergleich mittelalterlicher und heutiger Schreibweisen
- Rechtschreibung als Konvention
- Analyse einer Luther-Fabel
- Förderung leistungsschwächerer Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
Überlegungen zur Lerngruppe: Die Stunde ist für eine sechste Klasse konzipiert, die als leistungsstärker als die Parallelklasse gilt, wenngleich einige Schüler besondere Förderung im Bereich Rechtschreibung und Arbeitsorganisation benötigen. Der Entwurf analysiert die Stärken und Schwächen einzelner Schüler und bezieht die kognitiven Entwicklungsstufen der Altersgruppe (Piaget) mit ein, insbesondere die Relevanz von anschaulichem Lernen für den Grammatikunterricht. Gaiser's Argumentation gegen zu frühen Grammatikunterricht wird diskutiert und seine Relevanz für den geplanten Rechtschreibunterricht hinterfragt.
Überlegungen zum Unterrichtsinhalt: Der Fokus liegt auf der Vertiefung von Arbeitstechniken und Rechtschreibung. Der Entwurf beschreibt den Kontext des Unterrichts innerhalb des schuleigenen Lehrplans und erläutert die geplanten Schwerpunkte im Bereich Rechtschreibung. Es wird hervorgehoben, dass die Stunde im Rahmen einer Reihe zum Thema „Den Rechtschreibregeln auf der Spur“ steht und von einer literarischen Fabel ausgeht, um den Vergleich zwischen mittelalterlicher und heutiger Schreibweise zu ermöglichen.
Überlegungen zur methodischen Gestaltung: Der Entwurf erläutert das methodische Vorgehen, das auf entdeckenden Lernen basiert. Die kritische Auseinandersetzung mit dem Konstruktivismus und der Notwendigkeit von explizitem Lehren wird dargelegt. Es wird diskutiert, wie der geplante induktive Ansatz mit der Notwendigkeit effizienten Unterrichts vereinbart werden kann, unter Bezugnahme auf die Diskussionen innerhalb der Germanistik zur Legitimation des Rechtschreibunterrichts und den Aspekt der Rechtschreibung als soziale Konvention. Der Entwurf argumentiert für einen Ansatz, der die Rechtschreibung als Konvention darstellt und die Schüler zur selbstständigen Entdeckung von Regelmäßigkeiten anregt.
Schlüsselwörter
Rechtschreibung, Mittelalter, Luther-Fabel, entdeckendes Lernen, Rechtschreibkonvention, Leistungsförderung, Grammatikunterricht, Lehrprobe, Deutschunterricht, Arbeitstechniken.
Häufig gestellte Fragen zum Unterrichtsentwurf: Rechtschreibung im Mittelalter
Was ist der Gegenstand dieses Unterrichtsentwurfs?
Dieser Entwurf beschreibt eine Deutschstunde für die sechste Klasse zum Thema Rechtschreibung im Mittelalter. Im Mittelpunkt steht der Vergleich einer Luther-Fabel in Original- und heutiger Schreibweise, um ein selbsttätiges und entdeckendes Rechtschreiblernen anzuregen.
Welche Ziele werden mit dieser Unterrichtsstunde verfolgt?
Die Schüler sollen selbstständig Regelmäßigkeiten der heutigen Rechtschreibung erkennen und die Rechtschreibung als Konvention verstehen. Der Entwurf zielt auf selbsttätiges und entdeckendes Rechtschreiblernen ab und fördert leistungsschwächere Schüler.
Welche Aspekte der Lerngruppe werden berücksichtigt?
Der Entwurf ist für eine sechste Klasse konzipiert, die als leistungsstärker gilt, jedoch einige Schüler mit Förderbedarf in Rechtschreibung und Arbeitsorganisation umfasst. Die kognitiven Entwicklungsstufen der Schüler (Piaget) und die Relevanz von anschaulichem Lernen werden berücksichtigt. Die Argumentation Gaisers gegen zu frühen Grammatikunterricht wird diskutiert.
Wie ist der Unterrichtsinhalt strukturiert?
Der Fokus liegt auf der Vertiefung von Arbeitstechniken und Rechtschreibung. Der Unterricht ist in eine Reihe zum Thema „Den Rechtschreibregeln auf der Spur“ eingebunden und nutzt eine literarische Fabel zum Vergleich mittelalterlicher und heutiger Schreibweisen.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Der Entwurf basiert auf entdeckenden Lernen. Die Diskussion um Konstruktivismus und explizites Lehren wird geführt, ebenso die Vereinbarkeit des induktiven Ansatzes mit effizientem Unterricht. Die Rechtschreibung wird als soziale Konvention dargestellt, die die Schüler selbstständig entdecken sollen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Entwurf?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Rechtschreibung, Mittelalter, Luther-Fabel, entdeckendes Lernen, Rechtschreibkonvention, Leistungsförderung, Grammatikunterricht, Lehrprobe, Deutschunterricht, Arbeitstechniken.
Welche Kapitel beinhaltet der Entwurf?
Der Entwurf umfasst Kapitel zu Überlegungen zur Lerngruppe, Überlegungen zum Unterrichtsinhalt, Überlegungen zur methodischen Gestaltung, Lernziele, Verlaufsplan und Unterrichtsmaterial.
Für welche Klassenstufe ist der Entwurf konzipiert?
Der Entwurf ist für die sechste Klassenstufe konzipiert.
Welche Rolle spielt die Luther-Fabel im Unterricht?
Die Luther-Fabel dient als Grundlage für den Vergleich mittelalterlicher und heutiger Schreibweisen und ermöglicht so das entdeckende Lernen der Rechtschreibung.
- Citar trabajo
- Marcel Haldenwang (Autor), 2004, Den Rechtschreibregeln auf der Spur: Wir erforschen, wie man im Mittelalter schrieb, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32179