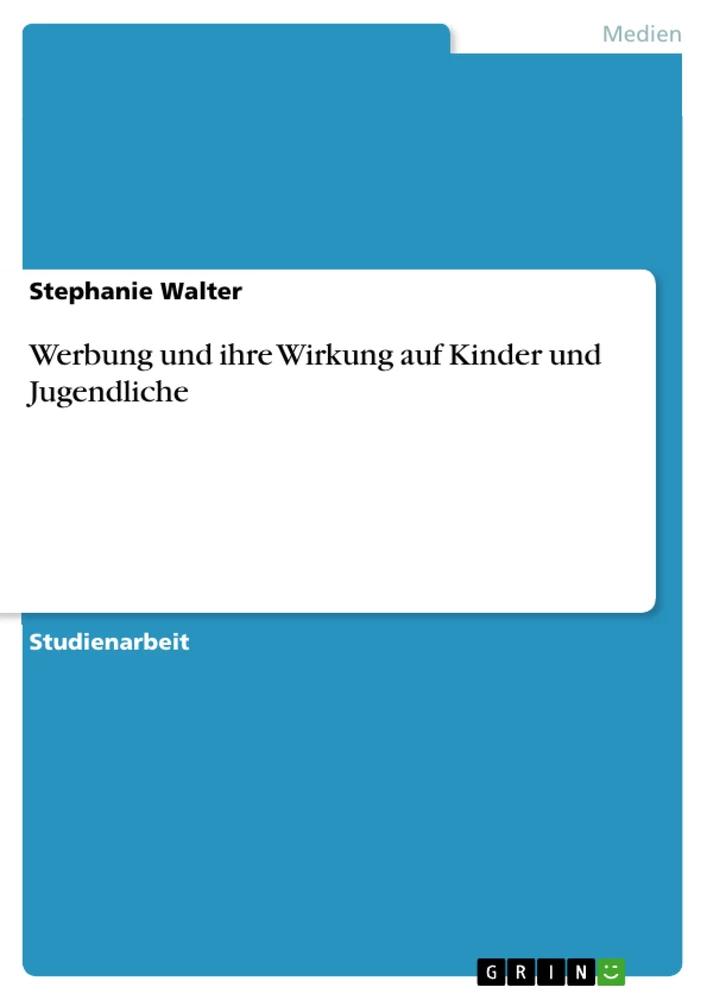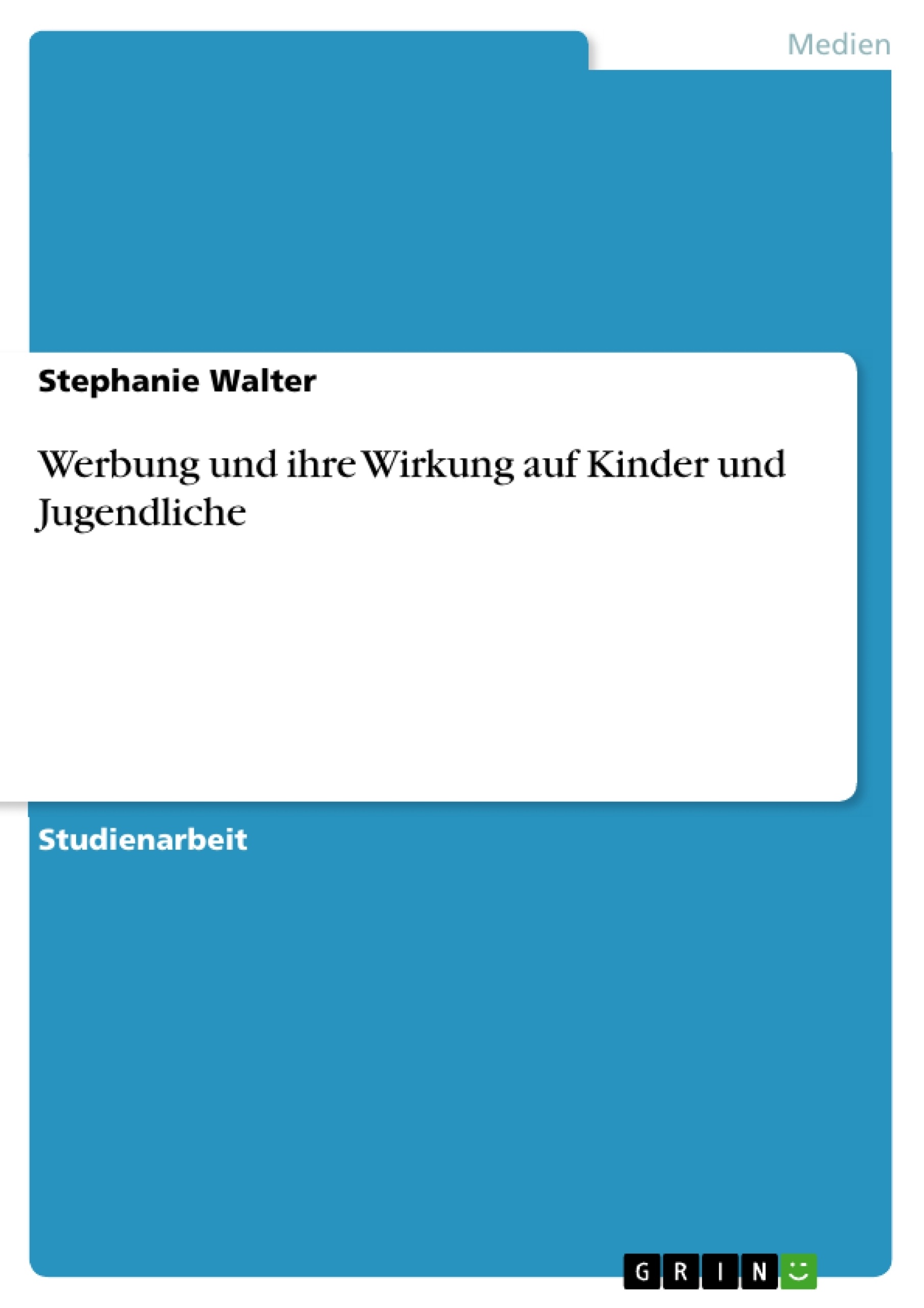Diese Arbeit stellt die Wirkung von Werbung auf Kinder und Jugendliche aus psychologischer Sicht in den Vordergrund.
Seit den sechziger Jahren richtet sich Werbung intensiver an Kinder, die sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt haben, da sie nicht nur als eigenständige Käufer in den Wirtschaftsprozess eingebunden sind, sondern auch durch das Treffen von Kaufentscheidungen innerhalb der Familie sowie als „zukünftig erwachsener Kunde“. Dabei richtet das Marketing seinen Blick auf die Nachfrage nach Konsumgütern in der Gegenwart, wie auch in der Zukunft, lässt dabei aber nicht außer Acht, dass Kinder eine direkte, indirekte und auch eine zukünftige Kaufkraft besitzen.
Diese Zunahme der Fokussierung auf Kinder und Jugendliche begründet sich in der Alltäglichkeit der Medien. Das Aufwachsen ist somit von diesen beeinflusst, da „Kinder und Jugendliche […] in einer durchgängigen Konsum- und Medienwelt [leben]“. So kommen Kinder in ihrem Alltag ständig mit Werbung in Kontakt, besonders seit Fernsehsender privatisiert wurden, aber auch im Radio oder Zeitschriften befindet sich eine Vielzahl an Werbeanzeigen.
Aufgrund dieser alltäglichen Bedeutung von Werbung für Kinder soll dies Thema dieser Arbeit sein, wobei besonderer Fokus auf die Werbewirkung gelegt werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Neurologische Hintergründe und aktuelle Relevanz des Themas
- Allgemeine psychologische Grundlagen
- Wahrnehmung
- Entwicklung
- Werbewirkung
- Hypothesen der Werbewirkung
- Prozess der Werbewirkung
- Kinder als kaufkräftige Zielgruppe
- Darstellung kinderbezogener Werbung
- Werbekompetenz
- Altersspezifische Unterschiede
- Fünf- bis sechsjährige Kinder
- Sieben- bis neunjährige Kinder
- Elf- bis zwölfjährige Kinder
- Maßnahmen für den kindlichen Umgang mit Werbung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Wirkung von Werbung auf Kinder und Jugendliche aus psychologischer Sicht. Im Fokus steht die Frage, wie Kinder Werbebotschaften wahrnehmen, verarbeiten und wie sich diese auf ihr Kaufverhalten auswirken.
- Wahrnehmungspsychologische Aspekte der Werbewirkung
- Entwicklungspsychologische Besonderheiten von Kindern im Kontext von Werbung
- Die Rolle der Werbekompetenz bei Kindern
- Altersspezifische Unterschiede in der Werbewirkung
- Maßnahmen zum Schutz von Kindern vor manipulativer Werbung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die neurologischen Hintergründe der Werbewirkung und die aktuelle Relevanz des Themas. Es wird auf Studien hingewiesen, die belegen, dass Emotionen eine wichtige Rolle bei der Werbewirkung spielen. Das zweite Kapitel widmet sich den allgemeinen psychologischen Grundlagen der Wahrnehmung und der Entwicklung von Kindern im Kontext von Werbung. Es werden verschiedene Theorien der Wahrnehmung vorgestellt, wie die Hypothesentheorie, die Gestalttheorie und der kognitionspsychologische Ansatz. Das dritte Kapitel behandelt die Werbewirkung im Allgemeinen, wobei die Hypothesen und Prozesse der Werbewirkung im Fokus stehen. Im vierten Kapitel werden Kinder als kaufkräftige Zielgruppe betrachtet. Es werden verschiedene Aspekte der kinderbezogenen Werbung, die Werbekompetenz von Kindern und altersspezifische Unterschiede in der Werbewirkung beleuchtet. Das fünfte Kapitel widmet sich Maßnahmen zum Schutz von Kindern vor manipulativer Werbung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themenfeldern Werbewirkung, Kinder, Jugendliche, Wahrnehmung, Entwicklung, Werbekompetenz, Medienpädagogik und Konsumverhalten.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt Werbung psychologisch auf Kinder?
Werbung nutzt emotionale Reize und psychologische Mechanismen der Wahrnehmung, um Kinder bereits in frühen Entwicklungsphasen als Konsumenten zu beeinflussen.
Ab welchem Alter entwickeln Kinder eine Werbekompetenz?
Es gibt deutliche altersspezifische Unterschiede: Während 5- bis 6-Jährige oft noch nicht zwischen Programm und Werbung unterscheiden können, entwickeln 11- bis 12-Jährige ein kritisches Verständnis für Werbebotschaften.
Warum sind Kinder eine so wichtige Zielgruppe für das Marketing?
Kinder besitzen eine direkte Kaufkraft (Taschengeld), eine indirekte Kaufkraft (Einfluss auf Familienentscheidungen) und sind zudem die Kunden der Zukunft.
Welche Rolle spielt die Wahrnehmungspsychologie?
Konzepte wie die Gestalttheorie oder der kognitionspsychologische Ansatz erklären, wie Werbebotschaften im kindlichen Gehirn verarbeitet werden.
Welche Maßnahmen schützen Kinder vor manipulativer Werbung?
Medienpädagogische Ansätze zur Förderung der Werbekompetenz sowie gesetzliche Einschränkungen für kinderbezogene Werbung sind zentrale Schutzmaßnahmen.
- Quote paper
- Stephanie Walter (Author), 2015, Werbung und ihre Wirkung auf Kinder und Jugendliche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321804