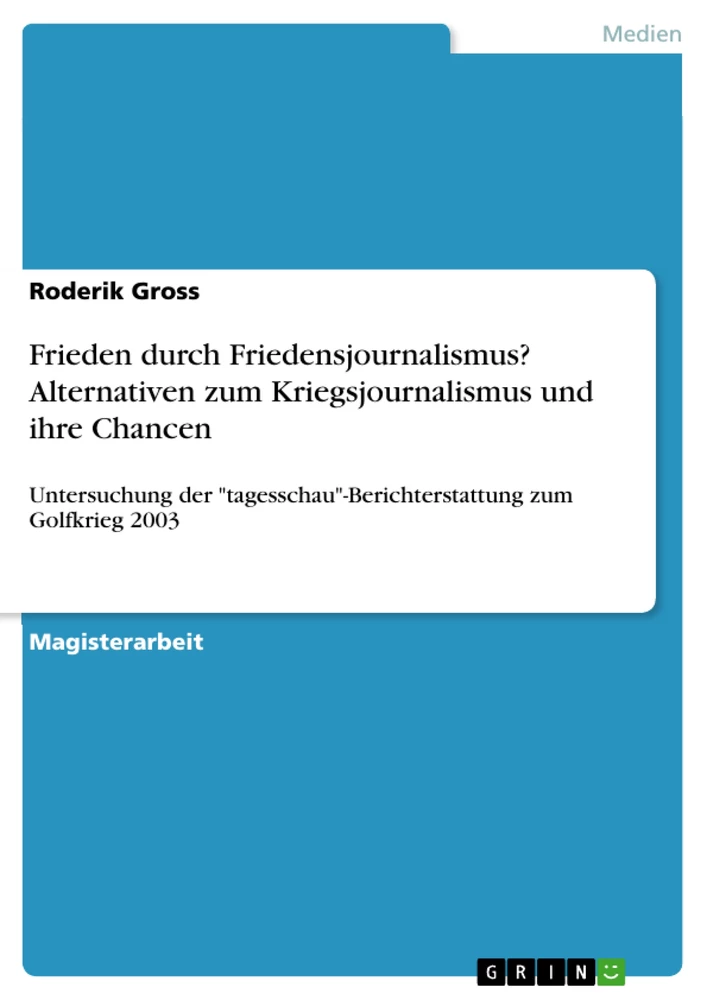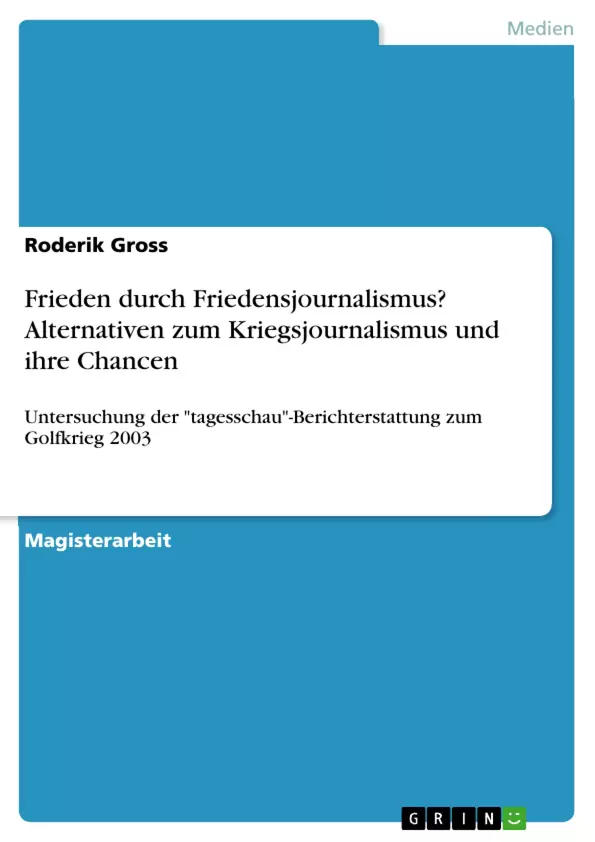Gepanzerte US-Fahrzeuge fahren auf den zentral gelegenen Fedouz-Platz in Bagdad ein. Soldaten sichern alle Zugangsstraßen zum Platz ab. Es ist der 9. April 2003. Diese Szenerie wird vom ZDF-Korrespondenten Ulrich Tilgner und von Journalisten aus aller Welt „live“ verfolgt. Der Platz ist in Sichtweite des Palestine-Hotels, in dem die meisten ausländischen Reporter, die während des Golfkrieges aus der irakischen Hauptstadt berichteten, untergebracht sind. Zumindest Tilgner hatte zuvor einen Tipp bekommen, dass die US-Armee in die Stadtmitte vorrückte, ohne zu wissen, welchen Ursprungs er war (vgl. Tilgner 2003: 124). Mit leichtem Zögern nähern sich ebenfalls Iraker dem Platz. Nachdem die ersten Versuche misslingen, die dortige Saddam-Hussein-Statue vom Sockel zu reißen, rückt ein Panzer näher heran. Erst mit einer Metallkette und Mühen schafft es das Fahrzeug, die Statue endgültig zu stürzen.
Die symbolträchtigen Bilder des Ereignisses werden weltweit berühmt und markieren den Anfang vom Ende des Saddam-Hussein-Regimes. Ein Bild, das die amerikanische Regierung propagandistisch als Zeichen des (unaufhaltsamen) Sieges zu nutzen wusste. Ein Bild, das den Medien vorübergehend Einschaltquoten sicherte. Die Szenen vom 9. April 2003 verdeutlichen das enge Verhältnis zwischen Militär und Medien: Die Medien wussten, dass US-Truppen anrückten, die Militärs wussten, dass die Kameras der Welt aus sie gerichtet sein würden. Hätten die Amerikaner diesen nach allen Seiten offenen Platz besetzt, wenn keine Medien präsent gewesen wären, um diese Szene zu registrieren? Wahrscheinlich nicht. Und anders herum: Wären die Kameras auch ohne die Anwesenheit von US-Soldaten auf den leeren Platz gerichtet worden? Wahrscheinlich nicht. Ob sie es wollen oder nicht, die Medien bzw. die Journalisten spielen durch ihre bloße Präsenz eine aktive Rolle in Kriegen. Durch ihre immanenten Fähigkeiten eines „agenda setters“ 1 , haben sie (vorübergehend) Einfluss auf den Ablauf des Kriegsgeschehens.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 Vorbemerkungen zur Fragestellung
- 1.2 Fragestellung
- 1.3 Vorgehensweise
- 2. KRIEGSJOURNALISMUS
- 2.1 Vorbemerkungen
- 2.1.1 Betrachteter Zeitraum
- 2.1.2 Art der Betrachtung
- 2.1.3 Anmerkungen zu den verwendeten Begriffen
- 2.1.4 Gliederungskonzept
- 2.2 Der Kriegsjournalismus von 1854 bis 1914
- 2.2.1 Der Krimkrieg: Beginn des Kriegsjournalismus
- 2.2.2 Der Amerikanische Sezessionskrieg und die Boulevardpresse
- 2.2.3 Der Spanisch-Amerikanische Krieg und die Macht der Presse
- 2.3 Der Kriegsjournalismus von 1914 bis 1945
- 2.3.1 Der Erste Weltkrieg und die Medienlenkung
- 2.3.2 Der Spanische Bürgerkrieg: Journalisten als „Überzeugungstäter“
- 2.3.3 Der Zweite Weltkrieg und die „Verstaatlichung“ der Medien
- 2.4 Der Kriegsjournalismus von 1945 bis 1991
- 2.4.1 Der Vietnamkrieg und das Fernsehen
- 2.4.2 Der Falklandkrieg Das Musterbeispiel zur Abschirmung der Presse
- 2.4.3 Die Grenada-Intervention und die „Lehren aus Vietnam“
- 2.4.4 Die Panama-Intervention: Der Prüfstein der neuen Pressepolitik
- 2.5 Der Kriegsjournalismus von 1990 bis heute
- 2.5.1 Der Golfkrieg 1990/91 und das Poolsystem
- 2.5.2 Die Somalia- Intervention: Das große Geschäft
- 2.5.3 Der Krieg in Kroatien: Die Stunde der großen PR-Agenturen
- 2.5.4 Der Krieg in Bosnien-Herzegowina: Parteinahme für die Opfer
- 2.5.5 Der Krieg im Kosovo: Journalisten als „Soldaten“ der NATO
- 2.5.6 Der Golfkrieg 2003 und die „Einbettung“ der Medien
- 2.6 Schlussbetrachtungen
- 2.6.1 Negative Charakteristika des Kriegsjournalismus
- 2.6.2 12 Punkte des negativen Kriegsjournalismus
- 3. FRIEDENSJOURNALISMUS
- 3.1 Vorbemerkungen
- 3.1.1 Anmerkungen zum Friedensbegriff
- 3.1.2 Gliederungskonzept
- 3.2 Johan Galtung
- 3.2.1 Konflikttheorie
- 3.2.2 „High road\" und „low road\" der Berichterstattung
- 3.2.3 Wichtige friedensjournalistische Fragen zu einem Konflikt
- 3.2.4 Abgrenzung des Friedensjournalismus vom Kriegsjournalismus
- 3.2.5 Zehn Vorschläge für die Kriegberichterstattung
- 3.2.6 Berechtigung für einen Friedensjournalismus
- 3.2.7 Fester Rahmen durch Nachrichtenselektion
- 3.2.8 Ausbruch aus der Nachrichtenselektion
- 3.2.9 Schlussbemerkung
- 3.3 Walter Philips Davison
- 3.3.1 Stabile Situation durch Kommunikation
- 3.3.2 Das Potential der Kommunikation
- 3.3.3 Sechs Aufgaben für die Massenmedien
- 3.3.4 Struktur immanente Beschränkungen der Medien
- 3.3.5 Lösungsvorschläge gegen strukturelle Beschränkungen
- 3.3.6 Verbesserung der Infrastruktur der Medien
- 3.3.7 Schlussbemerkung
- 3.4 Wilhelm Kempf
- 3.4.1 Friedensjournalismus versus Verbundenheitsjournalismus
- 3.4.2 Betrachtungen zum Konfliktverlauf
- 3.4.3 Richtlinien für einen präventiven Friedensjournalismus
- 3.4.4 Kritischer Friedensjournalismus
- 3.4.5 Schlussbemerkung
- 3.5 Schlussbetrachtungen
- 3.5.1 Grundlegende Charakteristika des Friedensjournalismus
- 3.5.2 12 Punkte des Friedensjournalismus
- 4. VERGLEICHENDE UND KRITISCHE BETRACHTUNGEN
- 4.1 Direkter Vergleich zwischen Friedens- und Gewaltjournalismus
- 4.1.1 12 Punkte des Friedensjournalismus versus 12 Punkte des negativen Kriegsjournalismus
- 4.1.2 Wirkungsphasen des Friedens- und Gewaltjournalismus im Vergleich
- 4.2 Vergleichende und kritische Betrachtung der friedensjournalistischen Konzepte von Galtung, Davison und Kempf
- 4.3 Praktische Anwendungen friedensjournalistischer Grundsätze
- 5. UNTERSUCHUNG ZUR FRAGESTELLUNG
- 5.1 Vorbemerkungen
- 5.1.1 Untersuchungsgegenstand
- 5.1.2 Betrachteter Krieg
- 5.1.3 Betrachteter Zeitraum
- 5.1.4 Untersuchungsfokus
- 5.2 Untersuchung der tagesschau hinsichtlich der Thematisierung aller Opfer
- 5.2.1 Vorgehensweise
- 5.2.2 Datenerhebung
- 5.2.3 Auswertung
- 5.2.4 Ergebnis
- 5.3 Untersuchung der tagesschau hinsichtlich des Zu-Wort-Kommens aller Elite- und Nicht-Elite-Personen
- 5.3.1 Vorgehensweise
- 5.3.2 Datenerhebung
- 5.3.3 Auswertung
- 5.3.4 Ergebnis
- 5.4 Fazit der Untersuchung
- 6. AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Friedensjournalismus einen Beitrag zur Bewältigung von Konflikten leisten kann. Sie untersucht die Berichterstattung der „tagesschau“ zum Golfkrieg 2003 anhand friedensjournalistischer Grundsätze und setzt diese in Relation zu den Prinzipien des Kriegsjournalismus. Dabei wird die Rolle der Medien in Kriegs- und Krisensituationen beleuchtet und der Einfluss des Journalismus auf die öffentliche Meinung und das Konfliktgeschehen analysiert.
- Die Rolle der Medien in Kriegen und Konflikten
- Die Auswirkungen von Kriegsjournalismus auf die öffentliche Meinung
- Die Prinzipien und Möglichkeiten des Friedensjournalismus
- Die Analyse der „tagesschau“-Berichterstattung zum Golfkrieg 2003 anhand friedensjournalistischer Kriterien
- Die Frage, ob Friedensjournalismus einen Beitrag zu einer friedlicheren Konfliktlösung leisten kann
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Fragestellung und die Vorgehensweise der Arbeit erläutert. Im zweiten Kapitel wird der Kriegsjournalismus von seinen Anfängen bis zum Golfkrieg 2003 beleuchtet, wobei die Entwicklung und die Herausforderungen dieser Form des Journalismus dargestellt werden. Das dritte Kapitel widmet sich dem Friedensjournalismus und stellt unterschiedliche Konzepte und Theorien vor, die sich mit den Möglichkeiten und Grenzen des Friedensjournalismus auseinandersetzen. Das vierte Kapitel vergleicht die Prinzipien des Kriegs- und Friedensjournalismus und analysiert kritisch die friedensjournalistischen Konzepte von Galtung, Davison und Kempf. Im fünften Kapitel wird die „tagesschau“-Berichterstattung zum Golfkrieg 2003 anhand friedensjournalistischer Kriterien untersucht. Abschließend wird im sechsten Kapitel ein Ausblick gegeben, der die Erkenntnisse der Arbeit zusammenfasst und mögliche Handlungsoptionen für den Journalismus im Kontext von Konflikten diskutiert.
Schlüsselwörter
Kriegsjournalismus, Friedensjournalismus, Golfkrieg 2003, „tagesschau“, Medien, Konflikt, Berichterstattung, öffentliche Meinung, Propaganda, Einbettung, Friedenskultur, Konflikttheorie, „agenda setting“
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Kriegs- und Friedensjournalismus?
Kriegsjournalismus ist oft gewaltorientiert und parteiisch, während Friedensjournalismus (nach Johan Galtung) konfliktlösend, wahrheitsorientiert und opferzentriert arbeitet.
Was bedeutet „Agenda Setting“ im Krieg?
Medien bestimmen durch ihre Themenauswahl, welche Aspekte eines Krieges von der Öffentlichkeit als wichtig wahrgenommen werden, und beeinflussen so indirekt den Kriegsverlauf.
Was ist das „Poolsystem“ oder „Embedding“?
Es sind Methoden des Militärs zur Medienlenkung, bei denen Journalisten fest in Truppenteile integriert werden, was ihre objektive Berichterstattung einschränken kann.
Wer sind die wichtigsten Theoretiker des Friedensjournalismus?
Die Arbeit analysiert Konzepte von Johan Galtung, Walter Philips Davison und Wilhelm Kempf.
Wie berichtete die „tagesschau“ über den Golfkrieg 2003?
Die Arbeit untersucht die „tagesschau“ kritisch hinsichtlich der Thematisierung von Opfern und der Ausgewogenheit zwischen Elite- und Nicht-Elite-Stimmen.
- Quote paper
- Roderik Gross (Author), 2004, Frieden durch Friedensjournalismus? Alternativen zum Kriegsjournalismus und ihre Chancen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32193