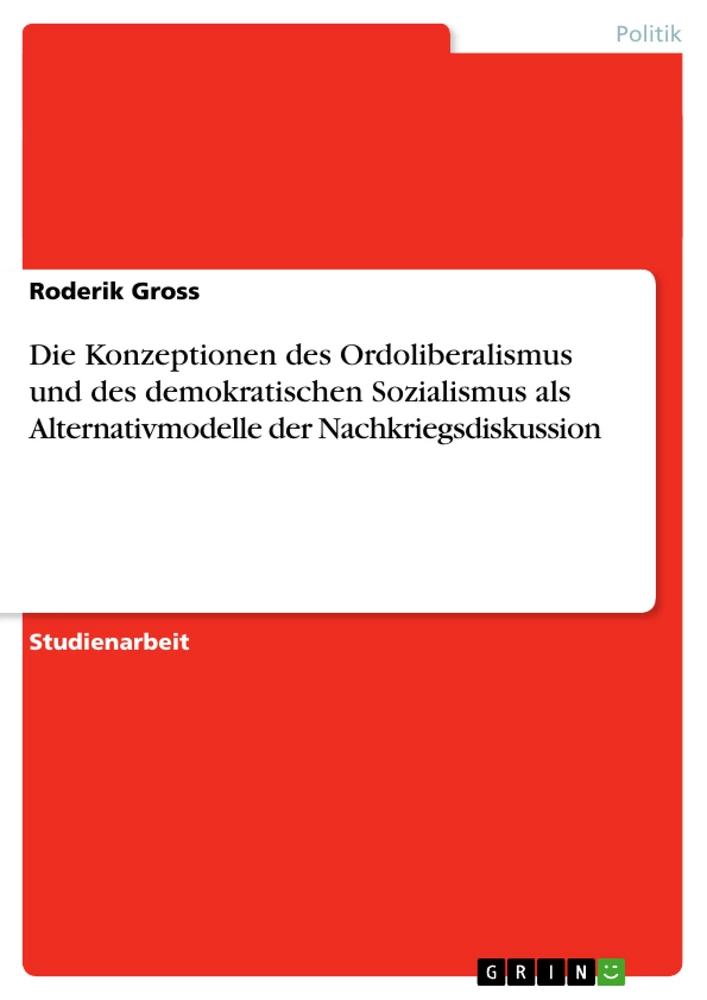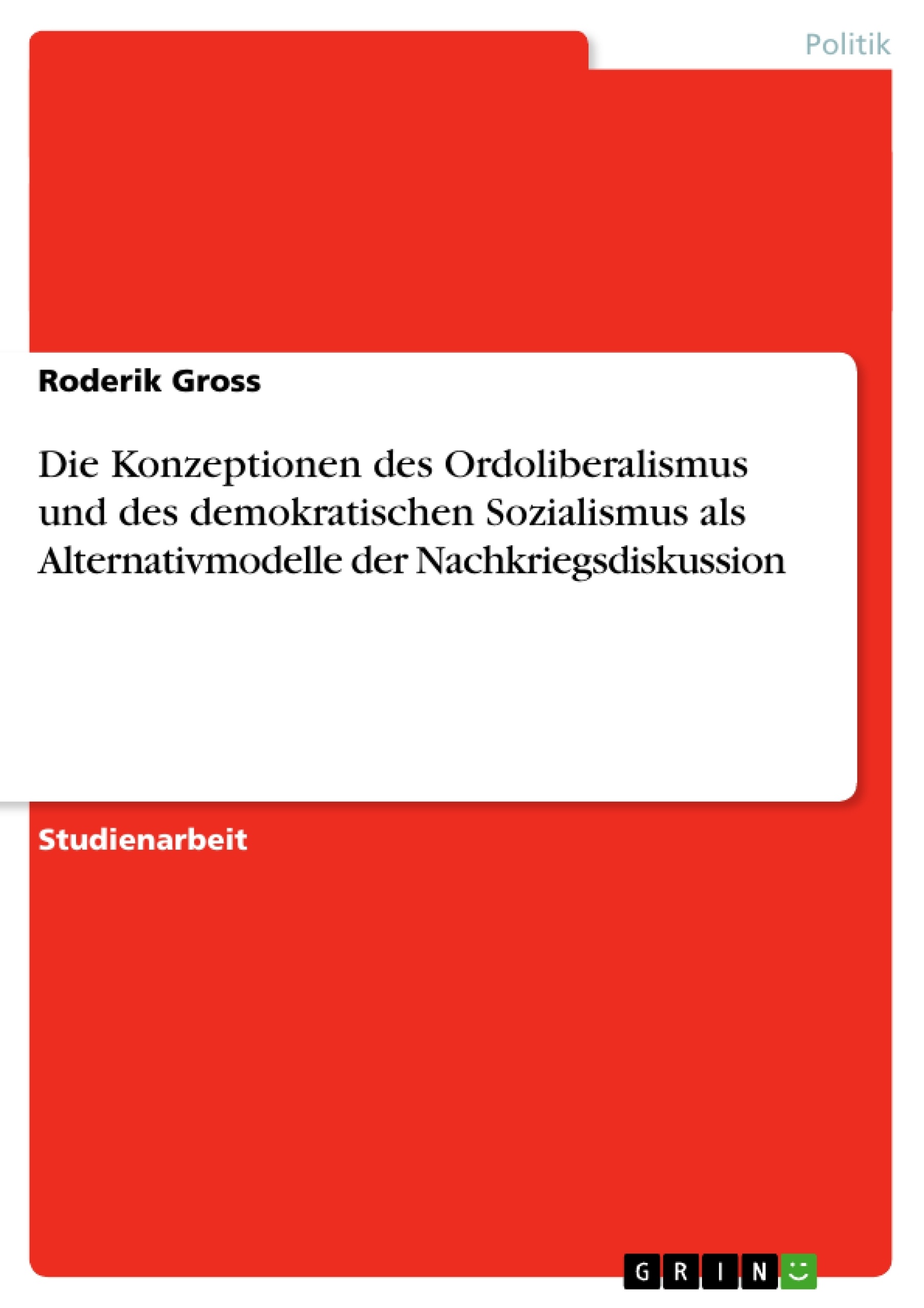Am 8. Mai 1945 erfolgte die bedingungslose Kapitulation der Deutschen Wehrmacht. Dieses Datum leitete die sogenannte „Vorstaatliche Phase“ ein, die bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland, durch das Inkrafttreten des Grundgesetzes am 24. Mai 1949 anhielt. In dieser Zeitspanne gab es im von den Siegermächten besetzten Deutschland keine eigene Regierung. Der Kontrollrat der Besatzungsmächte, der aus amerikanischen, russischen, britischen und später auch französischen Oberbefehlshabern bestand, hatte die Führung über das deutsche Gebiet übernommen.
Auf der Potsdamer Konferenz am 23. Juli 1945 einigten sich die Sieger u.a. über die Reparationszahlungen und über die politische Neuorientierung der Deutschen. Die vier Schlagwörter Denazifizierung, Demilitarisierung, Dezentralisierung und Demokratisierung fassen die politischen Grundsätze der Besatzungsmächte zusammen; die vier „d“s, wie sich auch genannt wurden. Doch bald kristallisierten sich verschiedene Vorstellungen heraus, die die gemeinsame Deutschlandpolitik betrafen. Es gab nicht nur Unstimmigkeit über die Art und Höhe der aus der deutschen Industrie(produktion) zu entnehmenden Reparationen, sondern auch grundlegend divergierende Auffassungen über die politische Neuordnung. Ein Grund dafür lag in den unpräzisen Formulierungen des Potsdamer Abkommens, in dem Begriffe wie „friedlich“, „gerecht“ und „demokratisch“ verwendet wurden, die von der Sowjetunion, aus ihrer ideologischen Sicht anders interpretiert wurden1. So zeichnete sich schon früh eine sowohl wirtschaftliche als auch politische Trennung zwischen der Bizone, der Amerikaner und Briten (später Trizone, mit den Franzosen zusammen) und der Sowjetischen Besatzungszone ab. Während die Westzone nach kapitalistischen Grundsätzen und mit demokratischer Zusammenarbeit aufgebaut wurde, konzentrierten sich die Sowjets in ihrer Zone darauf möglichst viele industrielle Anlagen zu demontieren und (politisch) wichtige Stellen mit abhängigen, kommunistischen Genossen zu besetzen. Das jeweilige Einflußgebiet wurde also durch die politisch-ökonomischen Konzepte des Besatzers verwaltet und umgeformt.
Zu dieser Zeit gab es aber nicht nur äußere Einflüsse, sondern auch innere. Auch deutsche Politiker diskutierten die Zukunft Deutschlands. Ähnlich wie die Besatzer stritten die Besetzten über die richtige und angemessene Form des Wiederaufbaus. Allgemeiner Konsens bestand über die künftige Regierungsform.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung des Ordoliberalismus
- Klassischer Liberalismus
- Ordoliberalismus
- Soziale Marktwirtschaft
- Entwicklung des demokratischen Sozialismus
- Klassischer Sozialismus
- Spaltung der sozialistischen Bewegung
- Demokratischer Sozialismus
- Entwicklung der Nachkriegsdiskussion
- Teilung Deutschlands
- Ordoliberalismus versus demokratischer Sozialismus
- Ergebnis der Nachkriegsdiskussion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Entwicklung des Ordoliberalismus und des demokratischen Sozialismus als Alternativmodelle der Nachkriegsdiskussion in Deutschland. Sie beleuchtet den geschichtlichen Hintergrund beider Konzepte und analysiert ihre Relevanz im Kontext der politischen und wirtschaftlichen Neuordnung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg.
- Die Entstehung und Entwicklung des Ordoliberalismus und seine Verbindung zum klassischen Liberalismus.
- Die Entstehung und Entwicklung des demokratischen Sozialismus und seine Abgrenzung vom klassischen Sozialismus.
- Die Rolle beider Konzepte in der deutschen Nachkriegsdiskussion und die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen dieser Zeit.
- Die unterschiedlichen Auffassungen über die ideale Wirtschaftsordnung und die politische Gestaltung Deutschlands.
- Die Relevanz des Ordoliberalismus im Kontext des Wiederaufbaus und der Stabilisierung der westdeutschen Wirtschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den historischen Kontext der deutschen Nachkriegszeit dar, beginnend mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht und der „Vorstaatlichen Phase“ bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Vorstellungen der Besatzungsmächte über die politische und wirtschaftliche Neuordnung Deutschlands und die daraus resultierende Trennung zwischen der Bizone und der Sowjetischen Besatzungszone.
- Entwicklung des Ordoliberalismus: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung des Ordoliberalismus, der seinen Ursprung im klassischen Liberalismus des 18. Jahrhunderts findet. Es werden die Grundgedanken des klassischen Liberalismus, insbesondere die „laissez-faire“-Politik, und die Entwicklung des Ordoliberalismus im 20. Jahrhundert erläutert.
- Entwicklung des demokratischen Sozialismus: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung des demokratischen Sozialismus, wobei er die Abgrenzung zum klassischen Sozialismus und die Herausforderungen der Spaltung der sozialistischen Bewegung beleuchtet.
- Entwicklung der Nachkriegsdiskussion: Dieses Kapitel analysiert die politische und wirtschaftliche Diskussion in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere die unterschiedlichen Konzepte des Ordoliberalismus und des demokratischen Sozialismus. Es beleuchtet die Teilung Deutschlands und die unterschiedlichen Vorstellungen der Besatzungsmächte.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der vorliegenden Hausarbeit sind Ordoliberalismus, demokratischer Sozialismus, soziale Marktwirtschaft, klassische Liberalismus, klassischer Sozialismus, Nachkriegsdiskussion, deutsche Wirtschaft, politische Neuordnung, Wiederaufbau und Stabilisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was war die 'vorstaatliche Phase' in Deutschland?
Es war der Zeitraum zwischen der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 und der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Mai 1949, in dem die Besatzungsmächte die Führung innehatten.
Was sind die Grundpfeiler des Ordoliberalismus?
Der Ordoliberalismus fordert einen staatlichen Ordnungsrahmen, der den Wettbewerb sichert und Monopolbildung verhindert, was die Basis für die Soziale Marktwirtschaft bildete.
Wie unterscheidet sich der demokratische Sozialismus vom klassischen Sozialismus?
Der demokratische Sozialismus strebt soziale Gerechtigkeit und Gleichheit innerhalb eines demokratischen Systems an und grenzt sich von totalitären Ausprägungen des klassischen Sozialismus ab.
Was bedeuteten die 'vier Ds' der Besatzungsmächte?
Sie stehen für die politischen Grundsätze: Denazifizierung, Demilitarisierung, Dezentralisierung und Demokratisierung.
Warum kam es zur wirtschaftlichen Trennung der Besatzungszonen?
Wegen divergierender Auffassungen über Reparationen und die politische Neuordnung zwischen der Sowjetunion (Demontagen) und den Westmächten (kapitalistischer Aufbau).
- Quote paper
- Roderik Gross (Author), 2000, Die Konzeptionen des Ordoliberalismus und des demokratischen Sozialismus als Alternativmodelle der Nachkriegsdiskussion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32196