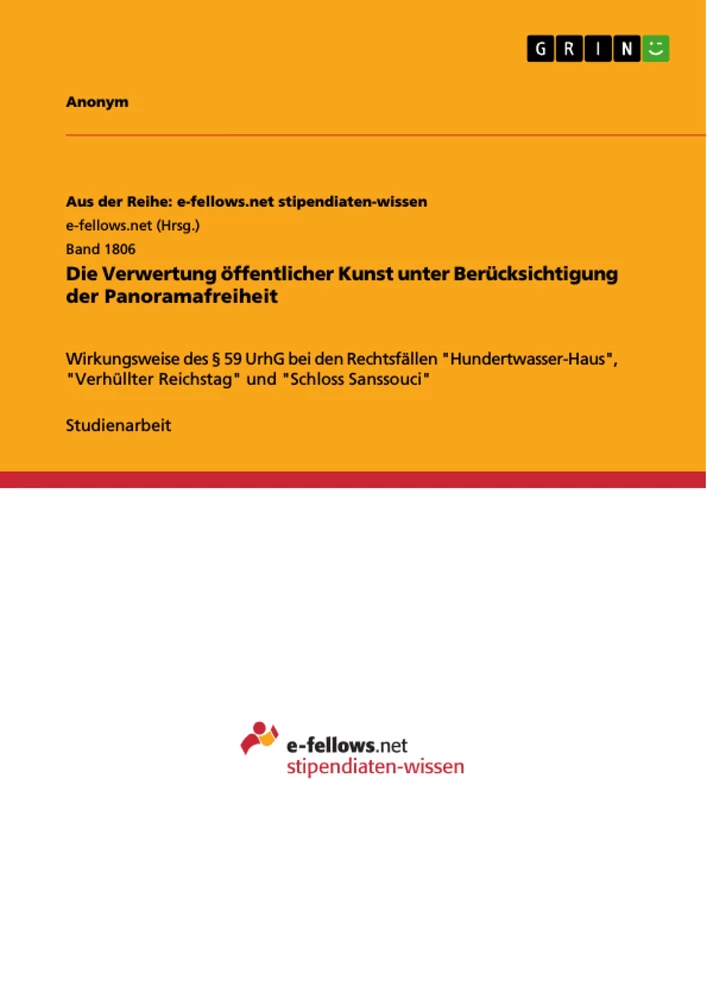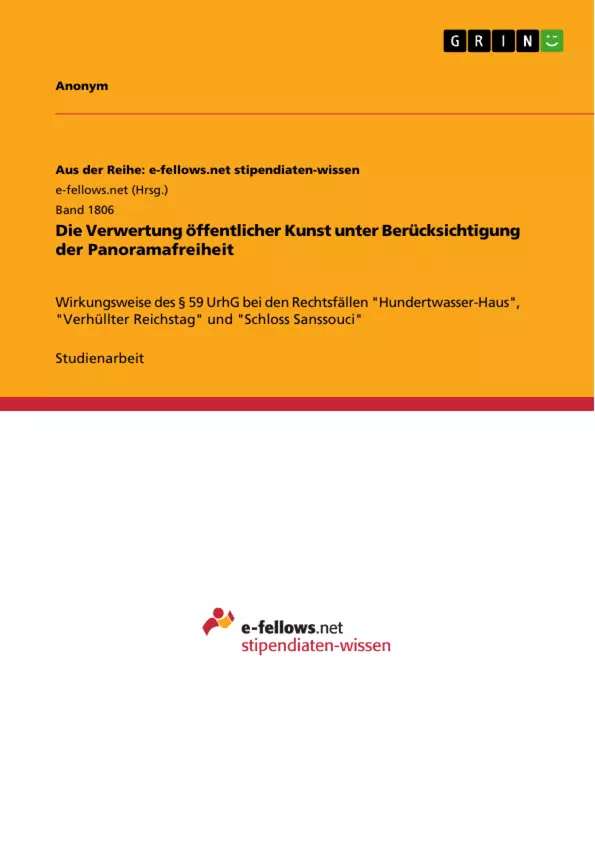Die nachfolgende Arbeit beschäftigt sich mit der Verwertung öffentlicher Kunst unter Berücksichtigung des § 59 UrhG, der Panoramafreiheit. Anhand von drei Fällen soll beispielhaft die Wirkweise des § 59 UrhG auf die Verwertung öffentlich zugänglicher und urheberrechtlich geschützter Kunstwerke dargestellt werden. Obwohl im Urheberrecht weitere Regelungen zu finden sind, die das ausschließliche Verwertungsrecht des Urhebers zugunsten des öffentlichen Interesses beschränken, sollen diese nicht Bestandteil der Arbeit sein. Der Fokus liegt, aufgrund der vorgegebenen Rechtsfälle, auf der Beschränkung durch die Panoramafreiheit § 59 UrhG.
Hierzu soll in Kapitel 2 zunächst das Urheberrecht im Allgemeinen dargestellt werden. Im Anschluss soll, zum Verständnis der im Weiteren behandelten Rechtsfälle, der § 59 UrhG und dessen Bestandteile und Wirkweise beleuchtet werden. Kapitel 2 im Ganzen bildet daher die Grundlage für die Erläuterung der Rechtsfälle. Kapitel 3 bis 5.3 behandeln die Rechtsfälle des „Hundertwasser-Hauses“, „Verhüllten Reichstags“ und des „Schloss Sanssoucis“.
Der Aufbau der jeweiligen Kapitel gliedert sich folgendermaßen: Zunächst wird der allgemeine Sachverhalt dargestellt. Danach folgen die Argumentationen der Kläger und Beklagten sowie die Darstellung der von den jeweiligen Parteien beanspruchten rechtlichen Grundlagen. Im letzten Teil eines jeden dieser Kapitel soll dann sowohl der Verfahrensgang dargestellt werden, als auch das Urteil genauer erläutert werden. Zum Abschluss der Arbeit wird ein Fazit gezogen und ein kleiner Einblick in aktuelle Diskussionen bezüglich der Panoramafreiheit gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Urheberrecht
- 2.1 Schrankenbestimmung - Panoramafreiheit § 59 UrhG
- 3. Hundertwasser-Haus Entscheidung
- 3.1 Sachverhalt
- 3.2 Argumentation und Rechtsgrundlagen
- 3.3 Verfahrensgang und Urteil
- 4. Verhüllter Reichstag Entscheidung
- 4.1 Sachverhalt
- 4.2 Argumentation und Rechtsgrundlage
- 4.3 Verfahrensgang und Urteil
- 5. Schloss Sanssouci Entscheidung
- 5.1 Sachverhalt
- 5.2 Argumentation und Rechtsgrundlage
- 5.3 Verfahrensgang und Urteil
- 6. Fazit und aktuelle Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwertung öffentlicher Kunstwerke im Kontext der Panoramafreiheit (§ 59 UrhG). Anhand dreier Fallstudien – Hundertwasser-Haus, Verhüllter Reichstag und Schloss Sanssouci – wird die praktische Anwendung des § 59 UrhG analysiert. Der Fokus liegt auf der Abwägung zwischen den Urheberrechten des Künstlers und dem öffentlichen Interesse an der Nutzung von Kunst im öffentlichen Raum.
- Die Panoramafreiheit (§ 59 UrhG) und ihre Grenzen
- Die Abwägung zwischen Urheberrecht und öffentlichem Interesse
- Die juristische Argumentation in den Fallstudien
- Die Auslegung der Panoramafreiheit durch die Gerichte
- Aktuelle Diskussionen zur Panoramafreiheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Verwertung öffentlicher Kunstwerke ein und beschreibt den Fokus der Arbeit auf die Anwendung der Panoramafreiheit (§ 59 UrhG) anhand dreier Fallstudien. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und erläutert die methodische Vorgehensweise, die darin besteht, jeweils den Sachverhalt, die Argumentationen der Parteien, die Rechtsgrundlagen und den Verfahrensgang sowie das Urteil zu analysieren. Die Einleitung betont den begrenzten Umfang der Arbeit, der sich auf die Panoramafreiheit konzentriert und andere urheberrechtliche Regelungen außen vor lässt.
2. Das Urheberrecht: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das deutsche Urheberrecht, beginnend mit den berechtigten Personen und dem Zweck des Schutzes. Es erläutert den Begriff des Werks, die Bedeutung der persönlichen Schöpfung und das ausschließliche Verwertungsrecht des Urhebers. Es werden die Grenzen dieses Rechts durch den Erschöpfungsgrundsatz und die Schrankenregelungen, darunter auch die Panoramafreiheit, aufgezeigt und die Unterschiede zum gewerblichen Rechtsschutz verdeutlicht. Das Kapitel betont den dualen Charakter des Urheberrechts, der sowohl vermögens- als auch persönlichkeitsrechtliche Aspekte umfasst. Beispiele wie der "Affen-Selfie"-Fall verdeutlichen die Grenzen des Urheberrechtsschutzes.
2.1 Schrankenbestimmung - Panoramafreiheit § 59 UrhG: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Panoramafreiheit (§ 59 UrhG) als Schranke des ausschließlichen Verwertungsrechts. Es erläutert den Wortlaut des Paragraphen und die Voraussetzungen für die zulässige Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Werken an öffentlichen Plätzen. Der Schwerpunkt liegt auf der engen Auslegung der Panoramafreiheit durch die Gerichte und dem Abwägungsprozess zwischen dem Interesse der Allgemeinheit und den Rechten des Urhebers. Die Bedeutung der "bleibenden" Anbringung und der Beschränkung auf die äußere Ansicht von Bauwerken wird ausführlich dargestellt, mit der Betonung, dass dies meist im Sinne einer wirtschaftlichen Nutzung der Werke ausgelegt wird.
Schlüsselwörter
Panoramafreiheit, § 59 UrhG, Urheberrecht, öffentliches Interesse, Verwertung öffentlicher Kunst, Hundertwasser-Haus, Verhüllter Reichstag, Schloss Sanssouci, Fallstudie, Rechtsprechung, Ausschließliches Verwertungsrecht, Schrankenregelungen.
FAQ: Analyse der Panoramafreiheit (§ 59 UrhG) anhand von Fallstudien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Anwendung der Panoramafreiheit (§ 59 UrhG) im deutschen Urheberrecht anhand von drei Fallstudien: dem Hundertwasser-Haus, dem verhüllten Reichstag und Schloss Sanssouci. Der Fokus liegt auf der Abwägung zwischen den Urheberrechten des Künstlers und dem öffentlichen Interesse an der Nutzung von Kunst im öffentlichen Raum.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Panoramafreiheit (§ 59 UrhG) und ihre Grenzen, die Abwägung zwischen Urheberrecht und öffentlichem Interesse, die juristische Argumentation in den Fallstudien, die Auslegung der Panoramafreiheit durch die Gerichte und aktuelle Diskussionen zu diesem Thema. Sie bietet einen Überblick über das deutsche Urheberrecht und die Schrankenregelungen, insbesondere die Panoramafreiheit.
Welche Fallstudien werden untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert drei Fallstudien: die Rechtsprechung zum Hundertwasser-Haus, zum verhüllten Reichstag und zu Schloss Sanssouci. Für jede Fallstudie werden der Sachverhalt, die Argumentation und Rechtsgrundlagen der beteiligten Parteien, der Verfahrensgang und das Urteil analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, gefolgt von einem Kapitel zum deutschen Urheberrecht inklusive einer detaillierten Betrachtung der Panoramafreiheit (§ 59 UrhG). Die drei Fallstudien werden in separaten Kapiteln behandelt. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einer Diskussion aktueller Entwicklungen.
Was ist der Schwerpunkt der Analyse der Fallstudien?
Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der juristischen Argumentation in den einzelnen Fällen, der Anwendung des § 59 UrhG und der Abwägung zwischen den Urheberrechten des Künstlers und dem öffentlichen Interesse an der Abbildung der Kunstwerke. Die Auslegung der Panoramafreiheit durch die Gerichte steht im Mittelpunkt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Panoramafreiheit, § 59 UrhG, Urheberrecht, öffentliches Interesse, Verwertung öffentlicher Kunst, Hundertwasser-Haus, Verhüllter Reichstag, Schloss Sanssouci, Fallstudie, Rechtsprechung, Ausschließliches Verwertungsrecht, Schrankenregelungen.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine juristische Methodenlehre, indem sie den Sachverhalt, die Argumentation der Parteien, die Rechtsgrundlagen und den Verfahrensgang sowie das Urteil der jeweiligen Fallstudie analysiert.
Werden weitere urheberrechtliche Regelungen behandelt?
Der Umfang der Arbeit konzentriert sich auf die Panoramafreiheit (§ 59 UrhG). Andere urheberrechtliche Regelungen werden nur am Rande betrachtet.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Die Verwertung öffentlicher Kunst unter Berücksichtigung der Panoramafreiheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321998