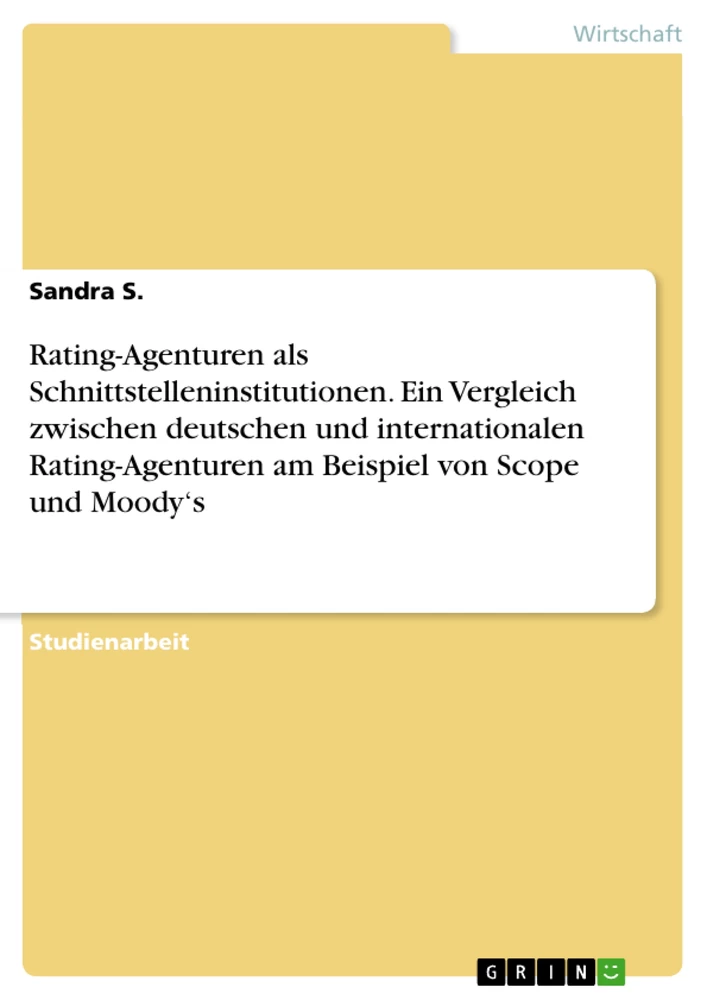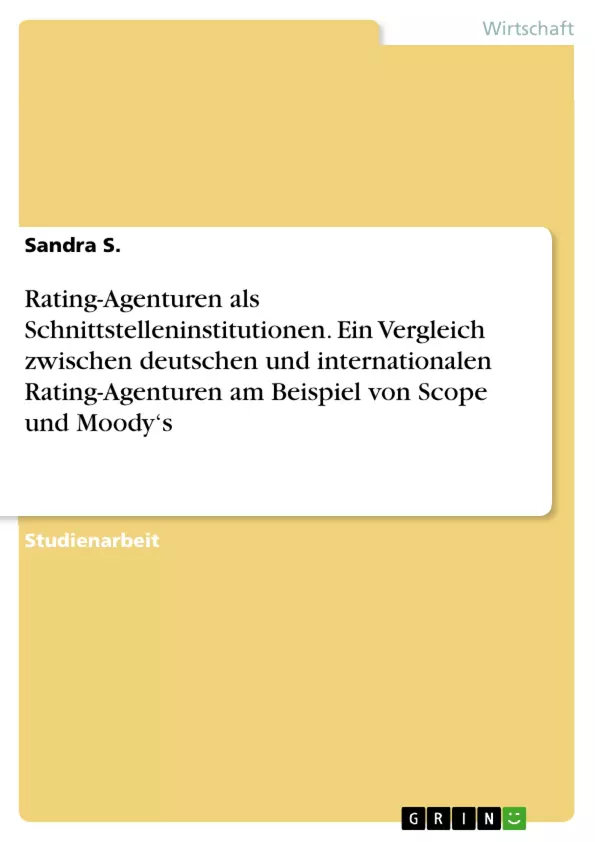Seit der Finanzkrise 2009 und der darauffolgenden Euro-Krise stehen vor allem die großen amerikanischen Rating-Agenturen in der Kritik. Als Vermittler zwischen Anlegern und Unternehmen scheinen sie versagt zu haben. Doch seit einigen Jahren gibt es immer mehr kleinere Agenturen in Europa und Asien, die sich der Konkurrenz mit den „Big Three“ – Standard&Poors, Moody’s und Fitch – stellen wollen.
Und obwohl die „Großen Drei“ einen viel größeren Anteil des weltweiten Marktes beherrschen, scheinen sich auch die kleineren Rating-Agenturen zu bewähren. Ein Beispiel für erfolgreiche Ratings ist die deutsche Agentur Scope mit Sitz in Berlin. Doch was unterscheidet kleine europäische Agenturen von den großen amerikanischen Marktführern? Erfüllen sie unterschiedliche Funktionen? Und welche großen Gemeinsamkeiten gibt es?
Diese und weitere Fragen sollen im Folgenden anhand der Theorie von Paul Windolf gelöst werden. Windolf beschreibt Ratingagenturen als Schnittstelleninstitutionen (Boundary Institutions). Als Schnittstelle zwischen Anlegern und Unternehmen sollen
Rating-Agenturen auf drei Ebenen für umfassende Informationen sorgen: Auf ethischer, normativer und ökonomischer Ebene.
Als Vergleichsbeispiele dienen dabei die amerikanische Ratingagentur Moody‘s sowie die deutsche Ratingagentur Scope. Dafür soll zunächst ein allgemeiner Überblick über Rating-Agenturen gegeben werden, bevor die Theorie der sogenannten Schnittstelleninstitutionen nach Windolf erörtert wird. Schließlich wird ein Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen zu Rating-Agenturen in der Europäischen Union und den USA gegeben. Im Anschluss werden die beiden Beispielagenturen hinsichtlich ihrer historischen Entwicklung, ihrer Arbeitsweise und ihrer Bedeutung sowie Kritik vorgestellt und abschließend auf den drei Funktionsebenen Windolfs auf ihre Schnittstellenfunktion hin verglichen.
In einem Fazit soll schließlich geklärt werden, inwieweit sich die beiden Beispielagenturen unterscheiden und inwiefern diese Unterschiede auf die Größe sowie geographische Lage der beiden Agenturen zurückzuführen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rating-Agenturen: Definition, Entwicklung, Arbeitsweise
- Rating-Agenturen als Boundary Institutions
- Rechtlicher Rahmen
- In Europa
- In den USA
- Scope
- Entwicklung und Hintergrund
- Arbeitsweise
- Moody's
- Entwicklung und Hintergrund
- Arbeitsweise
- Vergleich der Rating-Agenturen in ihrer Funktion als Schnittstelleninstitution
- Gemeinsamkeiten
- Auf ökonomischer Ebene
- Auf ethischer Ebene
- Auf normativer Ebene
- Unterschiede
- Auf ökonomischer Ebene
- Auf ethischer Ebene
- Auf normativer Ebene
- Gemeinsamkeiten
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Funktion von Rating-Agenturen als Schnittstelleninstitutionen (Boundary Institutions) am Beispiel der deutschen Agentur Scope und der amerikanischen Agentur Moody's. Die Arbeit analysiert die Entwicklung, Arbeitsweise und Bedeutung der beiden Agenturen im Kontext der Finanzkrise und der globalen Finanzmärkte.
- Definition und Entwicklung von Rating-Agenturen
- Rating-Agenturen als Schnittstellen zwischen Anlegern und Unternehmen
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Rating-Agenturen in Europa und den USA
- Vergleich der Arbeitsweise und Bedeutung von Scope und Moody's
- Analyse der Schnittstellenfunktion von Rating-Agenturen auf ökonomischer, ethischer und normativer Ebene
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik im Kontext der Finanzkrise und der Globalisierung der Finanzmärkte dar. Sie führt die zentralen Fragestellungen der Arbeit ein und erläutert den theoretischen Ansatz der Schnittstelleninstitutionen nach Windolf.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel definiert Rating-Agenturen, beschreibt ihre historische Entwicklung und Arbeitsweise. Es werden die verschiedenen Arten von Ratings, die Bedeutung von Bonitätsbewertungen und die Entwicklung des Ratingmarktes erläutert.
- Kapitel 3: Hier wird die Theorie der Schnittstelleninstitutionen nach Windolf vorgestellt. Es wird erläutert, wie Rating-Agenturen als Schnittstelle zwischen Anlegern und Unternehmen fungieren und Informationen auf ökonomischer, ethischer und normativer Ebene bereitstellen.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel analysiert den rechtlichen Rahmen für Rating-Agenturen in Europa und den USA. Es werden die verschiedenen Regulierungsmaßnahmen und Aufsichtsbehörden in den beiden Regionen vorgestellt.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel präsentiert die deutsche Ratingagentur Scope. Es werden ihre Entwicklung, ihre Arbeitsweise und ihre Bedeutung im deutschen und europäischen Kontext erläutert.
- Kapitel 6: Dieses Kapitel stellt die amerikanische Ratingagentur Moody's vor. Es werden ihre Entwicklung, ihre Arbeitsweise und ihre Bedeutung im globalen Kontext erläutert.
- Kapitel 7: Dieses Kapitel vergleicht die beiden Rating-Agenturen Scope und Moody's in ihrer Funktion als Schnittstelleninstitutionen. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Agenturen auf ökonomischer, ethischer und normativer Ebene analysiert.
Schlüsselwörter
Rating-Agenturen, Schnittstelleninstitutionen, Boundary Institutions, Bonitätsbewertung, Kreditrisiko, Finanzmärkte, Finanzkrise, Scope, Moody's, Vergleich, Regulierung, Aufsicht, ökonomische Ebene, ethische Ebene, normative Ebene.
Häufig gestellte Fragen
Was sind „Boundary Institutions“ im Kontext von Rating-Agenturen?
Nach der Theorie von Paul Windolf fungieren Rating-Agenturen als Schnittstelleninstitutionen zwischen Anlegern und Unternehmen, um Informationsasymmetrien auf verschiedenen Ebenen abzubauen.
Welche drei Funktionsebenen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Agenturen auf der ökonomischen, der ethischen und der normativen Ebene.
Wer sind die „Big Three“ am Ratingmarkt?
Die drei weltweit marktbeherrschenden US-Agenturen sind Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch.
Was zeichnet die deutsche Rating-Agentur Scope aus?
Scope ist ein Beispiel für eine erfolgreiche europäische Agentur mit Sitz in Berlin, die sich als Alternative zu den großen US-Anbietern etabliert hat.
Wie unterscheiden sich die rechtlichen Rahmenbedingungen in den USA und der EU?
Die Arbeit analysiert die Regulierungsmaßnahmen und Aufsichtsbehörden in beiden Regionen, die insbesondere nach der Finanzkrise 2009 verschärft wurden.
Warum stehen Rating-Agenturen seit der Euro-Krise in der Kritik?
Ihnen wird vorgeworfen, als Vermittler versagt und Risiken falsch bewertet zu haben, was die globalen Finanzturbulenzen teils verschärft hat.
- Quote paper
- Sandra S. (Author), 2016, Rating-Agenturen als Schnittstelleninstitutionen. Ein Vergleich zwischen deutschen und internationalen Rating-Agenturen am Beispiel von Scope und Moody‘s, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322034