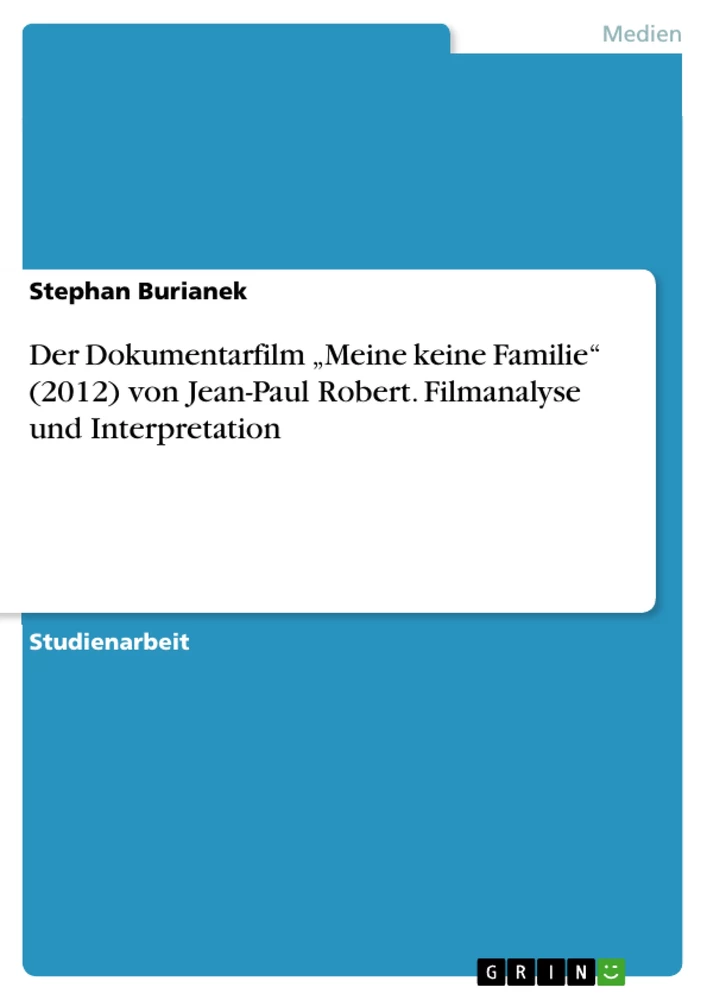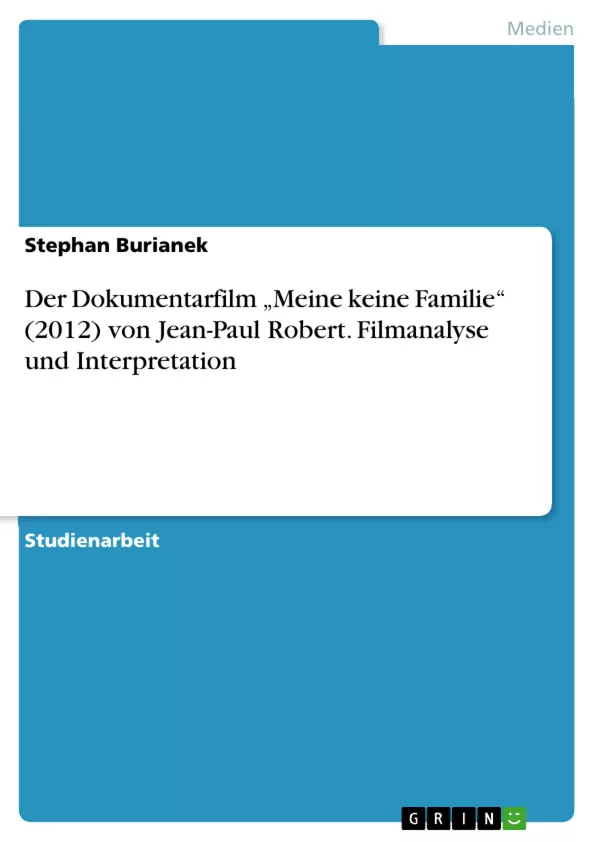Der Dokumentarfilm „Meine keine Familie“ (2012) von Jean-Paul Robert ist eine Geschichtsbetrachtung der Kommune Friedrichshof (Burgenland) – der sogenannten Otto Mühl-Kommune. Der Regisseur wurde im Jahr 1979 in diese Kommune hineingeboren und wuchs dort bis zu seinem 12. Lebensjahr auf.
Erstmals bei der Viennale 2012 gezeigt und ab April 2013 in den österreichischen Kinos, wurden ihm jeweils in der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ der Grierson-Award des London Film Festivals 2013, der Wiener Filmpreis 2014 und der Österreichische Filmpreis 2014 zugesprochen. Diese Arbeit soll die Vorgangsweise und die Mitteln besprechen, mit denen der Regisseur die Vergegenwärtigung seiner Vergangenheit vollzieht.
Inhaltsverzeichnis
- Der Film und das Ziel dieser Arbeit
- Geschichtlicher Hintergrund
- Filmanalyse
- Bild, Ton und Schnitt
- Dramaturgie bzw. Aufbau
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Dokumentarfilm "Meine keine Familie" (2012) von Jean-Paul Robert befasst sich mit der Geschichte der Kommune Friedrichshof, auch bekannt als die Otto Mühl-Kommune. Der Film schildert die persönlichen Erfahrungen des Regisseurs, der in der Kommune aufwuchs, und untersucht die Methoden, die der Regisseur einsetzt, um seine Vergangenheit zu vergegenwärtigen.
- Die Gründung und Entwicklung der Kommune Friedrichshof
- Die Ideale und Ziele der Kommune
- Die Praxis des Kommunenlebens und die Konflikte, die daraus entstanden
- Der Missbrauch von Macht und die Auswirkungen auf die Mitglieder der Kommune
- Die nachhaltigen psychischen Folgen für die ehemaligen Kommunenkinder
Zusammenfassung der Kapitel
Der Film beginnt mit einer Einführung in die Kommune Friedrichshof und ihre Entstehungsgeschichte. Der Regisseur beschreibt die Ideale und Ziele der Kommune, die auf Selbstverwirklichung und einem alternativen Lebensmodell basierten.
Im weiteren Verlauf des Films werden die praktischen Schwierigkeiten des Kommunenlebens beleuchtet, die sich aus der Nichtvereinbarkeit der Kommunentheorie mit den menschlichen Bedürfnissen ergeben. Die psychische Labilität einiger Kommunenmitglieder wird thematisiert, und es wird deutlich, wie der Machtmissbrauch durch die oberste Instanz die Mitglieder der Kommune gefährdete.
Der Film zeigt die Folgen des Missbrauchs von Macht und die nachhaltigen psychischen Schäden, die die ehemaligen Kommunenkinder erlitten haben. Die öffentliche Entschuldigung einiger Kommunenmitglieder am Ende des Films unterstreicht die Tragweite der Missstände und die Notwendigkeit, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Films sind: Kommune Friedrichshof, Otto Mühl, Aktionsanalytische Organisation (AAO), Selbstverwirklichung, Missbrauch, psychische Schäden, Dokumentarfilm, Vergegenwärtigung von Vergangenheit.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Film „Meine keine Familie“?
Der Dokumentarfilm von Jean-Paul Robert thematisiert die Geschichte der Kommune Friedrichshof (Otto-Mühl-Kommune) aus der Sicht eines dort aufgewachsenen Kindes.
Wer war Otto Mühl?
Otto Mühl war der Gründer der Aktionsanalytischen Organisation (AAO), einer Kommune, die auf radikalen Lebensmodellen basierte, aber später wegen Machtmissbrauchs in die Kritik geriet.
Welche Auszeichnungen erhielt der Film?
Der Film gewann unter anderem den Österreichischen Filmpreis 2014, den Wiener Filmpreis und den Grierson-Award des London Film Festivals.
Welche psychischen Folgen werden im Film thematisiert?
Der Film beleuchtet die nachhaltigen psychischen Schäden der ehemaligen Kommunenkinder, die durch das starre System und den Machtmissbrauch entstanden sind.
Wie verarbeitet der Regisseur seine Vergangenheit?
Jean-Paul Robert nutzt Bild-, Ton- und Schnitttechniken, um seine Kindheitserinnerungen zu vergegenwärtigen und die Ideale der Kommune kritisch zu hinterfragen.
- Quote paper
- Mag. Stephan Burianek (Author), 2015, Der Dokumentarfilm „Meine keine Familie“ (2012) von Jean-Paul Robert. Filmanalyse und Interpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322044