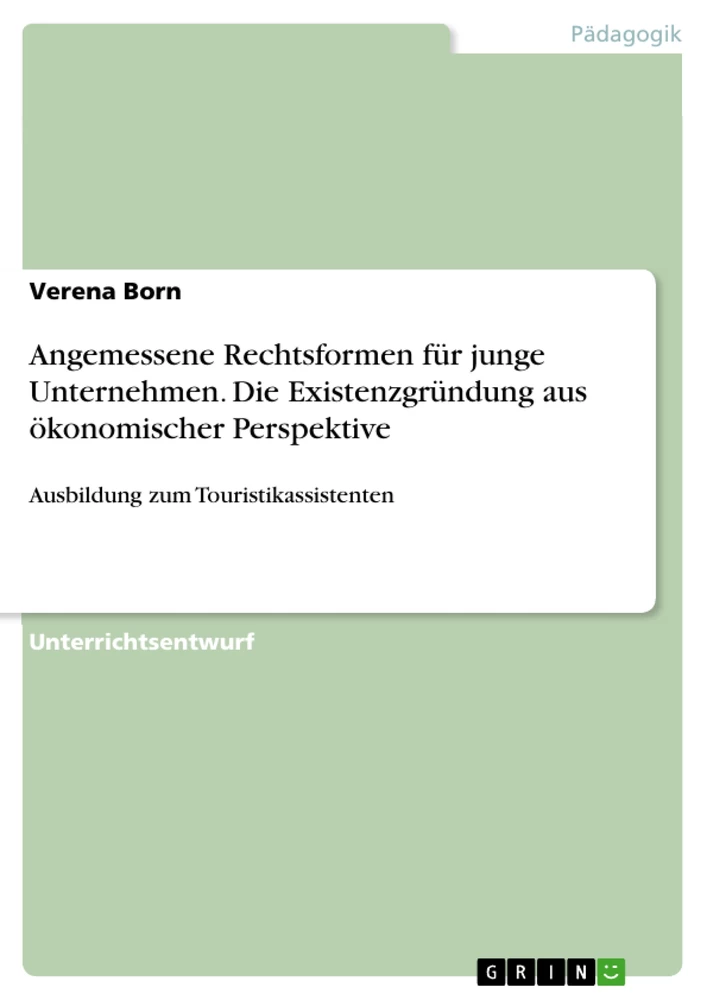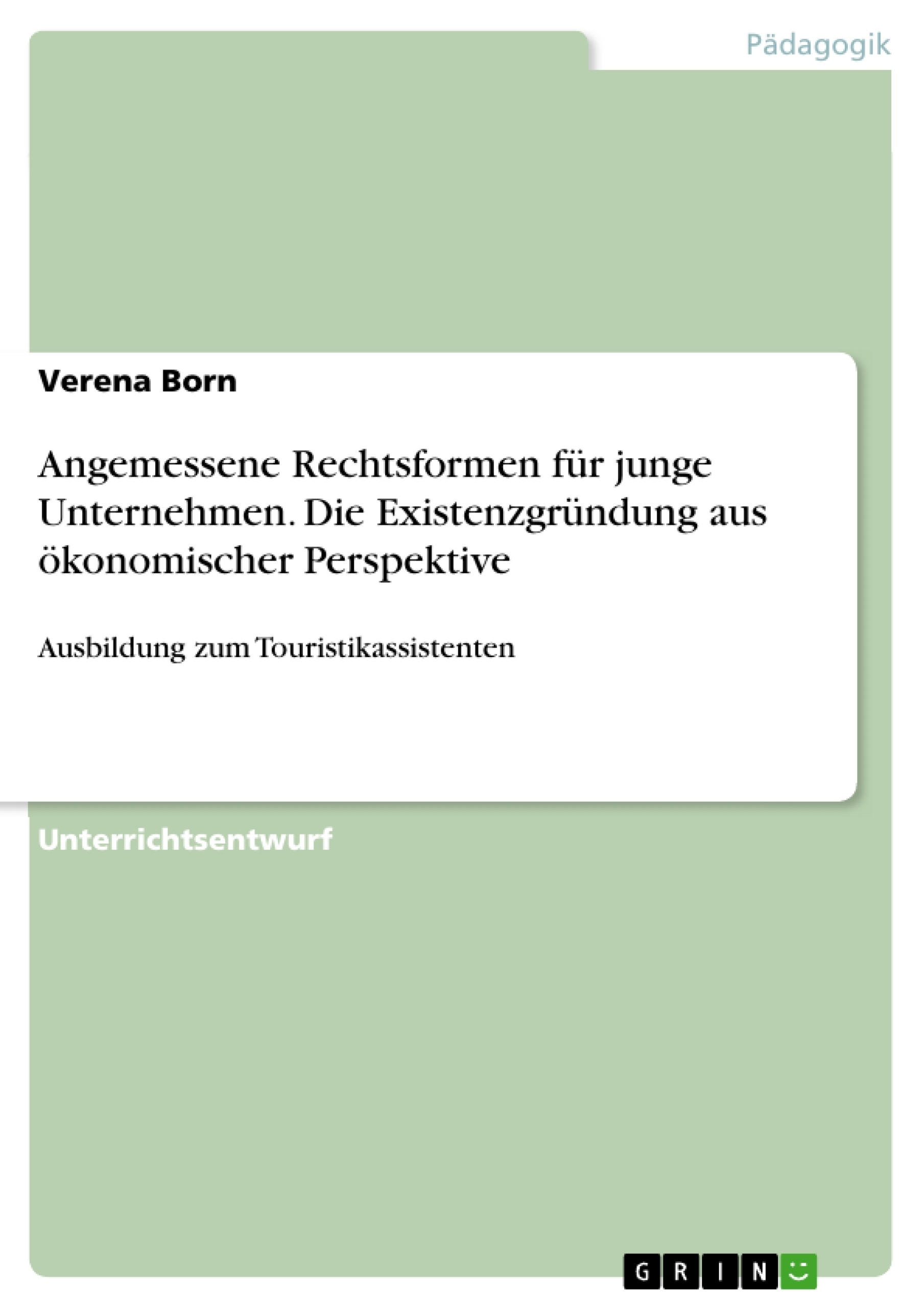In dem folgendem Lehr-/Lernentwurf wird der Versuch unternommen, eine 90-minütige fiktive Unterrichtseinheit zum Themenkomplex „Befähigung zur ökonomisch begründeten Wahl angemessener Rechtsformen von jungen Unternehmen, die von unternehmerischer Persönlichkeit nicht nur im Erscheinungsbild geprägt, sondern auch entsprechend geführt werden“ unter kritischer Würdigung theoretischer Modelle teilnehmer- und situationsorientiert zu gestalten.
Die Unterrichtseinheit ist Teil der Ausbildung zum staatlich-anerkannten Touristikassistenten. Sie befasst sich mit der praktischen Anwendung ökonomisch begründeter Rechtsformen und wird durch die Erkenntnis des Einflusses von unternehmerischer Persönlichkeit auf den Gründungserfolg thematisch erweitert.
Neben der ökonomischen Grundbildung als Allgemeinbildung über Rechtsformen, das maßgeblich im Rahmenlehrplan des Ausbildungsberufes festgelegt ist und an deren Ordnungsmittel sich die private Bildungseinrichtung in ihrer unterrichtenden Tätigkeit orientiert, ist ein weiteres Ziel die Förderung von Sozial- und Selbstkompetenzen im Sinne einer beruflichen Handlungsfähigkeit. Es gibt jedoch weitere Gründe, die es rechtfertigen das hier dargestellte Thema im Sinne der schulischen Ausbildung zu rechtfertigen.
Das im Unterricht zu vermittelnde Fachwissen über die angemessene Wahl der Rechtsform ist dann insbesondere im Falle der Selbständigkeit von hoher Bedeutung. Sie muss im Hinblick auf eine Existenzgründung vom Gründer ökonomisch gut überlegt sein, da die Entscheidung zu einer Rechtsform eine fundamentale Entscheidung ist und Folgen auf die zukünftige Unternehmensentwicklung haben kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Analyse der unterrichtlichen Bedingungen
- 2.1 Informationen zur Lerngruppe und zur Lernausgangslage
- 2.1.1 Die Lerngruppe und ihre Vorbildung
- 2.1.2 Das Sozial- und Arbeitsverhalten der Schüler
- 2.1.3 Analyse der organisatorischen Rahmenbedingungen
- 2.1.4 Pädagogische Konsequenzen
- 3. Unterrichtliche Entscheidungen
- 3.1 Fachliche und didaktische Überlegungen
- 3.1.1 Legitimation und Einordnung des Stundenthemas in die Unterrichtsreihe
- 3.1.2 Sachanalyse des Themas
- 3.1.2.1 Rechtsformen
- 3.1.2.1.1 Einzelunternehmen
- 3.1.2.1.2 Personengesellschaften
- 3.1.2.1.3 Kapitalgesellschaften
- 3.1.2.2 Kriterien unternehmerischen Erfolgs bei Jungunternehmen
- 3.1.2.2.1 Die unternehmerische Persönlichkeit
- 3.1.2.2.2 Der Einfluss der Persönlichkeit auf den unternehmerischen Erfolg
- 3.1.2.2.3 Analyse unternehmerischer Persönlichkeit auf wichtige Bereiche im Gründungsgeschehen
- 3.1.3 Didaktische Analyse nach W. Klafki
- 3.1.3.1 Gegenwartsbedeutung
- 3.1.3.2 Zukunftsbedeutung
- 3.1.3.3 Struktur des Inhalts
- 3.1.3.4 Exemplarische Bedeutung
- 3.1.3.5 Zugänglichkeit
- 3.1.4 Didaktische Reduktion
- 3.2 Lernziele
- 3.2.1 Richtlernziel
- 3.2.2 Groblernziel
- 3.2.3 Feinlernziel
- 3.2.3.1 FLZ eingeordnet nach der Taxonomie der kognitiven Verhaltensdimension nach Bloom
- 3.2.3.2 FLZ eingeordnet nach der Taxonomie der affektiven Verhaltensdimension nach Krathwohl
- 3.2.3.3 FLZ eingeordnet nach der Taxonomie der psychomotorischen Verhaltensdimension nach Dave
- 3.2.3.4 FLZ eingeordnet nach der Taxonomie der sozial-kommunikativen Verhaltensdimension nach Euler
- 3.3 Berufliche Handlungskompetenz
- 3.3.1 Sachkompetenz
- 3.3.2 Selbstkompetenz
- 3.3.3 Sozialkompetenz
- 3.4 Methodische Überlegungen
- 3.4.1 Struktur des Lehr-/Lernprozesses
- 3.4.1.1 Hinführung
- 3.4.1.2 Erarbeitung
- 3.4.1.3 Festigung und Sicherung
- 3.4.2 Synoptische Darstellung des geplanten Unterrichtsverlaufs
- 3.5 Didaktische Reserve
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Lehr-/Lernentwurf zielt darauf ab, Schülerinnen und Schülern die ökonomisch begründete Wahl angemessener Rechtsformen für junge Unternehmen näherzubringen. Der Fokus liegt auf der Verknüpfung theoretischer Modelle mit der Praxis und der Berücksichtigung unternehmerischer Persönlichkeiten. Der Entwurf soll teilnehmer- und situationsorientiert gestaltet werden.
- Angemessene Rechtsformen für junge Unternehmen
- Einfluss der unternehmerischen Persönlichkeit auf den Unternehmenserfolg
- Ökonomische Kriterien bei der Rechtsformwahl
- Didaktische Konzepte im Wirtschaftsunterricht
- Berufliche Handlungskompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Lehr-/Lernentwurf als eine 90-minütige Unterrichtseinheit zum Thema der Wahl angemessener Rechtsformen für junge Unternehmen, wobei die unternehmerische Persönlichkeit eine zentrale Rolle spielt. Der Entwurf strebt eine kritische Auseinandersetzung mit theoretischen Modellen an und soll teilnehmer- und situationsorientiert gestaltet werden.
2. Analyse der unterrichtlichen Bedingungen: Dieses Kapitel analysiert die Lerngruppe (20 Schüler*innen in einer Touristik-Ausbildung, diverse Vorbildungen und soziale Hintergründe), deren Sozial- und Arbeitsverhalten (hohe Eigeninitiative, teilweise Ermüdungserscheinungen) und die organisatorischen Rahmenbedingungen. Es wird auf unterschiedliche Lernmotivationen und die teilweise vorhandenen Erfahrungen mit Rechtsformen durch Nebentätigkeiten eingegangen.
3. Unterrichtliche Entscheidungen: Dieses Kapitel beschreibt die fachlichen und didaktischen Überlegungen zum Unterricht. Es beinhaltet eine detaillierte Sachanalyse der verschiedenen Rechtsformen (Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften) und der Kriterien für unternehmerischen Erfolg. Die didaktische Analyse nach Klafki wird angewendet, um die Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung des Themas zu belegen und die Zugänglichkeit für die Schüler sicherzustellen. Lernziele (Richt-, Grob- und Feinlernziele) werden definiert und nach verschiedenen Taxonomien eingeordnet. Methodische Überlegungen zum Ablauf des Unterrichts werden dargelegt, inklusive Hinführung, Erarbeitung und Sicherung des Lernstoffs. Die berufliche Handlungskompetenz (Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz) wird im Kontext des Themas beleuchtet.
Schlüsselwörter
Rechtsformen, Jungunternehmen, Unternehmerische Persönlichkeit, Ökonomische Kriterien, Didaktik, Wirtschaftsunterricht, Lernziele, Handlungskompetenz, Unternehmensführung.
Häufig gestellte Fragen zum Lehr-/Lernentwurf: Rechtsformen für junge Unternehmen
Was ist der Gegenstand dieses Lehr-/Lernentwurfs?
Der Lehr-/Lernentwurf beschreibt eine 90-minütige Unterrichtseinheit zum Thema der Wahl angemessener Rechtsformen für junge Unternehmen. Ein zentraler Aspekt ist dabei der Einfluss der unternehmerischen Persönlichkeit auf den Unternehmenserfolg. Der Entwurf verfolgt einen teilnehmer- und situationsorientierten Ansatz und verbindet theoretische Modelle mit praktischen Anwendungen.
Welche Rechtsformen werden behandelt?
Der Entwurf behandelt die gängigsten Rechtsformen: Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Die Auswahl und die jeweiligen Vor- und Nachteile werden im Kontext junger Unternehmen diskutiert.
Welche Rolle spielt die unternehmerische Persönlichkeit?
Die unternehmerische Persönlichkeit wird als entscheidender Faktor für den Erfolg eines jungen Unternehmens betrachtet. Der Entwurf analysiert den Einfluss persönlicher Eigenschaften auf die Wahl der Rechtsform und den gesamten Gründungsprozess.
Welche didaktischen Konzepte werden angewendet?
Der Entwurf basiert auf einer didaktischen Analyse nach Klafki, die die Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung des Themas, die Struktur des Inhalts, die exemplarische Bedeutung und die Zugänglichkeit für die Schüler*innen berücksichtigt. Es werden verschiedene Lernziele (Richt-, Grob- und Feinlernziele) definiert und nach verschiedenen Taxonomien (Bloom, Krathwohl, Dave, Euler) eingeordnet.
Wie ist der Unterricht strukturiert?
Der Unterricht ist in drei Phasen gegliedert: Hinführung, Erarbeitung und Festigung/Sicherung. Der Entwurf enthält eine detaillierte synoptische Darstellung des geplanten Unterrichtsverlaufs.
Welche Lernziele werden verfolgt?
Die Lernziele umfassen sowohl kognitive (Wissen, Verstehen, Anwenden etc.) als auch affektive (Einstellungen, Werte) und psychomotorische (praktische Fähigkeiten) Aspekte. Sie sind an die berufliche Handlungskompetenz (Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz) der Schüler*innen ausgerichtet.
Welche methodischen Überlegungen werden angestellt?
Der Entwurf beschreibt die methodischen Ansätze zur Gestaltung des Lehr-/Lernprozesses, um ein teilnehmerorientiertes und aktives Lernen zu ermöglichen. Es wird auf die Berücksichtigung verschiedener Lernstile und die Integration von Praxisbeispielen eingegangen.
Wer ist die Zielgruppe?
Die Zielgruppe sind 20 Schüler*innen einer Touristik-Ausbildung mit unterschiedlichen Vorbildungen und sozialen Hintergründen. Der Entwurf berücksichtigt die spezifischen Bedürfnisse und die Vorkenntnisse dieser Lerngruppe.
Welche ökonomischen Kriterien werden betrachtet?
Der Entwurf beleuchtet die ökonomischen Kriterien, die bei der Wahl der Rechtsform für junge Unternehmen eine Rolle spielen, wie z.B. die Haftungsfrage, die Steuerbelastung und die Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Entwurf?
Schlüsselwörter sind: Rechtsformen, Jungunternehmen, Unternehmerische Persönlichkeit, Ökonomische Kriterien, Didaktik, Wirtschaftsunterricht, Lernziele, Handlungskompetenz, Unternehmensführung.
- Quote paper
- Verena Born (Author), 2015, Angemessene Rechtsformen für junge Unternehmen. Die Existenzgründung aus ökonomischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322060