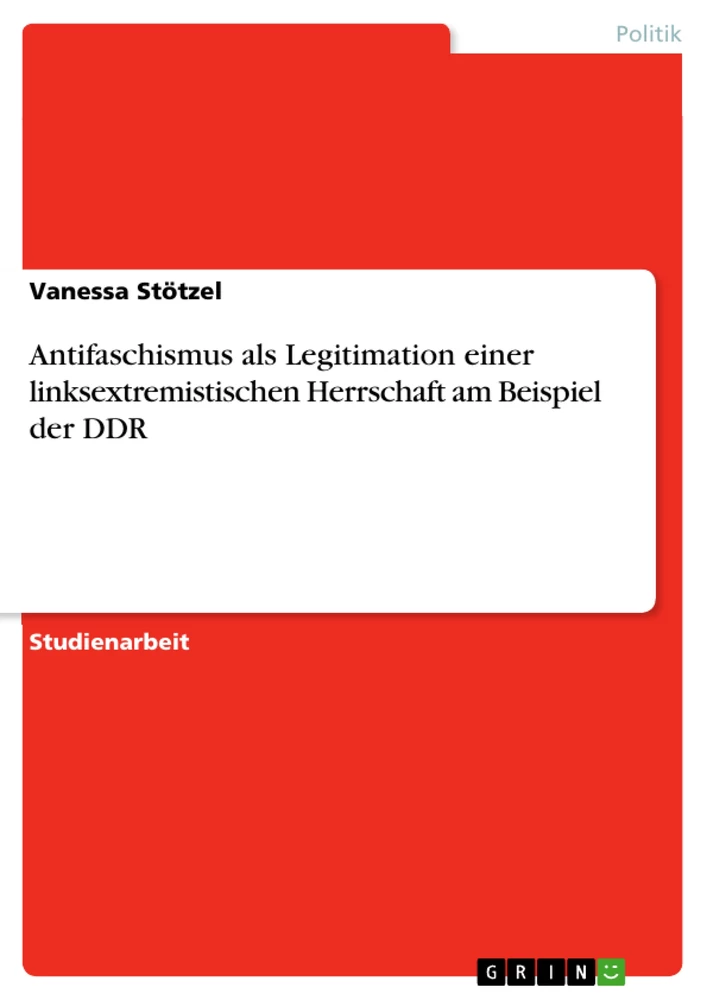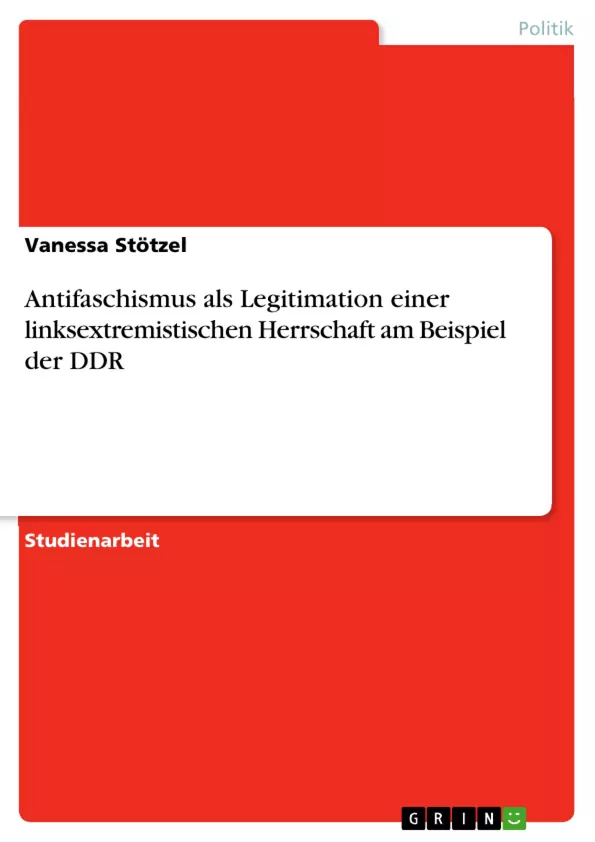Die Analyse der Rolle, die dem Antifaschismus sowohl in der Legitimation und Integration als auch in der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit in der DDR zukam, soll zentrales Thema dieser Arbeit sein.
Bekennt man sich offen zu den Grundsätzen einer freiheitlich-demokratischen Ordnung, so impliziert dies zweifellos eine Ablehnung des Faschismus als Form von totalitärer, diktatorischer Herrschaft. Spricht man dabei im Umkehrschluss jedoch allen überzeugten Antifaschisten eine demokratische Grundüberzeugung zu, so ist diese Gleichsetzung definitiv unzutreffend. Keineswegs ist jeder Antifaschist gleichzeitig auch Befürworter der Demokratie.
Die Ablehnung von Faschismus ist nicht selten der einzige gemeinsame Nenner verschiedener Gruppen von Antifaschisten. Zu oft wurde und wird der Begriff Antifaschismus von Bewegungen benutzt, die neben ihrer Gegnerschaft zum Faschismus ebenso offen ihre Ablehnung einer demokratischen Ordnung kundtun. Unter dem Vorwand des Antifaschismus legitimieren sie ihre Vorstellung einer Gesellschaftsordnung. Gleichzeitig werben sie um Unterstützung von demokratischen Partnern, die auf dem Konsens des Antifaschismus zu Bündnissen bereit sind.
Antifaschismus kann aus rein demokratischen Überzeugungen betrieben werden, jedoch ist die Bekämpfung des Faschismus nicht immer auch mit dem Willen verbunden, eine demokratische Ordnung vor allen Formen einer Diktatur zu schützen. Der Antifaschismus richtet sich per se gegen den rechtsextremistischen Faschismus, nicht aber zwingend gegen eine andere Form der Diktatur.
In der Geschichte der DDR spiegelt sich genau dieser Ansatz eines extremistischen Antifaschismus wieder. Zwar grenzte sich die parteipolitische Führung mit ihrem antifaschistischen Staat klar zum kapitalistischen Faschismus der Vergangenheit ab, doch stand die Errichtung eines demokratischen Staates nie zur Debatte. Stattdessen diente der Begriff Antifaschismus stets zur Legitimation der Parteiführung und der Existenz der DDR-Diktatur.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Terminologien im Begriffsfeld des Antifaschismus
- 1.1 Extremismus
- 1.1.1 Linksextremismus
- 1.2 Faschismus
- 1.2.1 allgemeine / wissenschaftliche Faschismustheorie
- 1.2.2 marxistisch-leninistische Faschismustheorie
- 1.3 Antifaschismus
- 1.3.1 demokratische Antifaschismustheorie
- 1.3.2 extremistische Antifaschismustheorie
- 1.1 Extremismus
- 2. Analyse des Antifaschismus in der DDR
- 2.1 Allgemeines zur DDR
- 2.2 Die Rolle des Antifaschismus in der DDR
- 2.2.1 als Integrationsideologie
- 2.2.2 als Legitimationsgrundlage der SED Herrschaft
- 2.2.3 in der Aufarbeitung der NS-Zeit
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rolle des Antifaschismus in der DDR. Sie untersucht, wie der Antifaschismus als Legitimationsgrundlage der SED-Herrschaft und als Instrument der Integration in der DDR eingesetzt wurde. Zudem wird beleuchtet, wie die NS-Vergangenheit in der DDR unter dem Vorzeichen des Antifaschismus aufgearbeitet wurde.
- Analyse des Antifaschismus als Integrationsideologie in der DDR
- Untersuchung der Legitimationsfunktion des Antifaschismus für die SED-Herrschaft
- Beurteilung der NS-Aufarbeitung in der DDR im Kontext des Antifaschismus
- Theoretische Einordnung des Antifaschismus im Kontext von Extremismus und Faschismus
- Abgrenzung zwischen demokratischen und extremistischen Formen des Antifaschismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar und erläutert die Notwendigkeit, zwischen demokratischen und extremistischen Formen des Antifaschismus zu unterscheiden. Kapitel 1 befasst sich mit den Begrifflichkeiten im Kontext des Antifaschismus, wobei die Definitionen von Extremismus, Faschismus und Antifaschismus aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden. Kapitel 2 bietet einen Überblick über die DDR und analysiert die Rolle des Antifaschismus in der DDR. Dabei werden sowohl die Integrationsideologie als auch die Legitimationsfunktion des Antifaschismus sowie die NS-Aufarbeitung in der DDR untersucht.
Schlüsselwörter
Antifaschismus, DDR, SED, Integration, Legitimation, NS-Aufarbeitung, Extremismus, Faschismus, Linksextremismus, marxistisch-leninistische Faschismustheorie, demokratische Antifaschismustheorie, extremistische Antifaschismustheorie.
Häufig gestellte Fragen
Wie nutzte die DDR den Antifaschismus zur Legitimation?
Die SED-Führung definierte die DDR als den einzig rechtmäßigen antifaschistischen Staat, um die Existenz ihrer Diktatur und den Machtanspruch der Partei zu rechtfertigen.
Ist jeder Antifaschist automatisch ein Demokrat?
Nein, die Arbeit zeigt, dass Antifaschismus auch von extremistischen Bewegungen (wie dem Linksextremismus) genutzt wird, die eine freiheitlich-demokratische Ordnung ablehnen.
Was war die marxistisch-leninistische Faschismustheorie?
Sie interpretierte Faschismus als extremste Form des Kapitalismus, wodurch die DDR den Westen (BRD) als potenziell faschistisch brandmarken konnte.
Wie wurde die NS-Vergangenheit in der DDR aufgearbeitet?
Die Aufarbeitung stand unter dem Vorzeichen des Antifaschismus; Schuld wurde oft dem kapitalistischen System zugeschrieben, während die DDR sich als moralischer Sieger sah.
Was ist der Unterschied zwischen demokratischem und extremistischem Antifaschismus?
Demokratischer Antifaschismus schützt die Freiheit vor allen Diktaturen, während extremistischer Antifaschismus nur den rechten Faschismus bekämpft, aber selbst diktatorische Strukturen anstrebt.
- Citation du texte
- Vanessa Stötzel (Auteur), 2012, Antifaschismus als Legitimation einer linksextremistischen Herrschaft am Beispiel der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322224