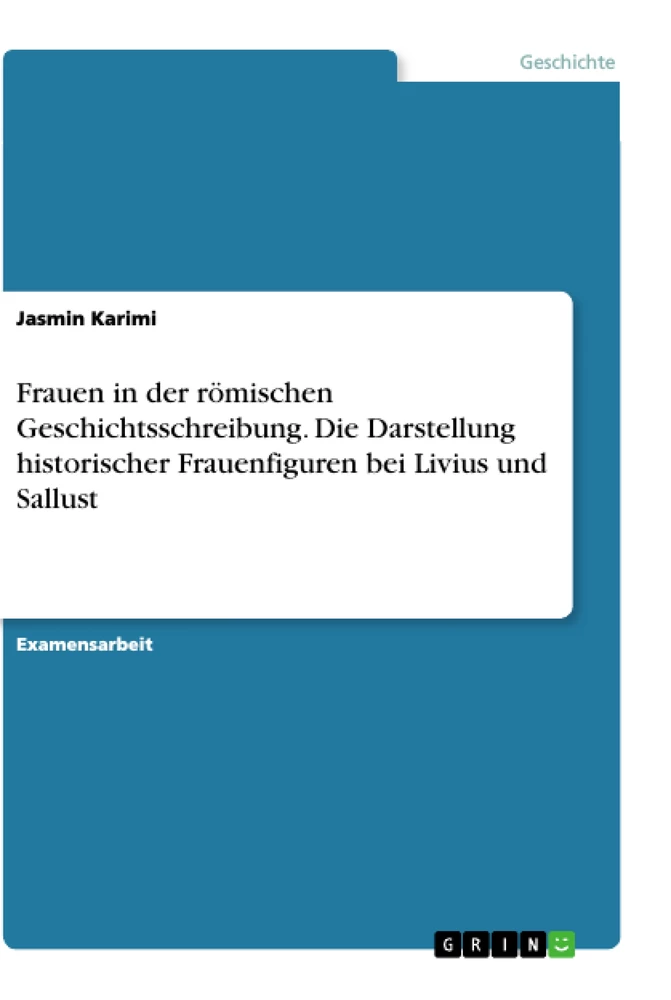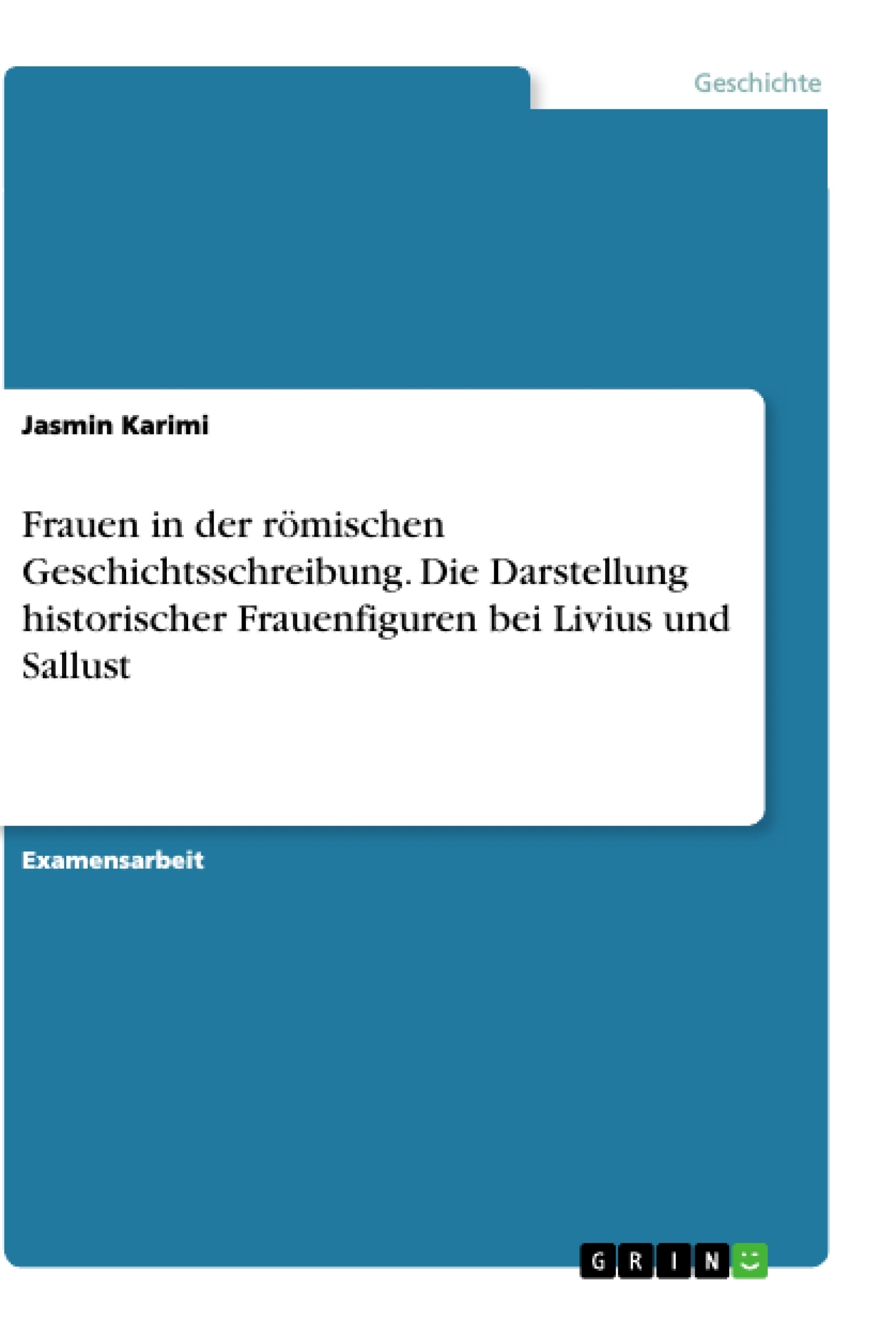«Die Geschichtslosigkeit der Frauen wird durch die Geschichtsschreibung hergestellt». So fasst die Historikerin MARIELOUISE JANNSEN-JURREIT ihre Kritik an der offiziellen Geschichtsschreibung zusammen und meint damit die Anzahl der erfassten weiblichen historischen Personen. In ihre Analyse schließt sie nicht nur moderne Geschichtswerke ein, sondern beginnt mit sehr alten Schriften.
Inwiefern hat sie also Recht mit der Annahme, dass bereits in der Antike die Frauen in der Geschichtsschreibung zu wenig berücksichtigt worden sind? Die umfangreichste, antike Historiographie lieferte – nach Sallust und seinen historischen Monographien – Titus Livius mit seiner Schrift Ab urbe condita. Der Teil, der erhalten ist, umfasst fast 760 Jahre in 142 Büchern und behandelt, schon dem Namen nach, die römische Geschichte von der legendären Gründung Roms bis kurz nach der Zeitwende. Hinter Livius Geschichtswerk verbirgt sich ein faszinierender Reichtum an Beschreibungen der römischen Welt, die es erschwert, einzelne, spezifische Themen separat zu behandeln.
Die verhältnismäßig große Menge an weiblichen Figuren bietet jedoch eine gute Grundlage zur Erforschung der Rolle der Frau in der römischen Geschichtsschreibung. Als Beispiele sind im ersten Buch Tanaquil oder Tullia zu nennen, die jeweils ihren Ehemännern auf den Königsthron verhelfen, oder Hispala Faecenia, die im 39. Buch durch ihren Verrat den Bacchanalienskandal auslöst, sowie Vestia Oppia und Pacula Cluvia, die sich während des Zweiten Punischen Krieges um den römischen Staat verdient gemacht hatten und dafür belohnt wurden. Es finden sich viele weitere, auch namentlich genannte Frauen, denen Livius eine Bedeutung in seinem Werk einräumt.
Für diese Arbeit soll allerdings aufgrund der Länge der Episoden und ihres allgemeinen Bekanntheitsgrades das Hauptaugenmerk auf Lucretia und Verginia im ersten und dritten Buch liegen. Neben Livius wird Sallust als Quelle dienen, der in der Fachliteratur immer wieder als der fähigste römische Historiograph bezeichnet wird. Die beiden Frauen Fulvia und Sempronia stechen als einzige namentlich erwähnte Frauen aus der sonst männerdominierten Schrift Bellum Catilinarium so explizit heraus, dass sich auch hier eine tiefergehende Betrachtung lohnt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung: Intention der Arbeit
- 2. Geschichtsverständnis der römischen Geschichtsschreiber Livius und Sallust
- 2.1 Geschichtsauffassung des Titus Livius
- 2.2. Aussagen des Proömiums des erstes Buches Ab urbe condita
- 2.3 Der Geschichtsschreiber Gaius Sallustius Crispus
- 2.3.1 Informationen zu Autor und Werk und Auswahl der Frauenfiguren
- 2.3.2 Geschichtsauffassung unter Berücksichtigung des Proömiums des Bellum Catilinarium.
- 3. Zwei Frauenfiguren in Livius' Ab urbe condita – Lucretia und Verginia
- 3.1 Lucretia - Opfer und exemplum
- 3.1.1 Einordnung in den Gesamtzusammenhang des ersten livianischen Buches
- 3.1.2 Inhalt der Episode
- 3.1.3 Mögliche Interpretationsvarianten
- 3.2 Verginia - Mord an einem plebejischen Mädchen
- 3.2.1 Einordnung in das dritte Buch Ab urbe condita
- 3.2.2 Gliederung der Verginia-Episode.
- 3.2.3 Inhalt und Interpretation des Berichts
- 3.2.4 Ein Vergleich zwischen Lucretia und Verginia
- 4. Die Frauenfiguren bei Sallust
- 4.1 Bellum Catilinarium – Die historische Monographie in der Übersicht
- 4.2 Fulvia - Verrat zum Schutz des Staates: Inhalt und Interpretation.
- 4.3 Sempronia - eine antike femme fatale
- 4.3.1 Einordnung der Episode in das Bellum Catilinarium
- 4.3.2 Inhalt und Interpretation des Sempronia-Kapitels.
- 5. Weibliche Lebensrealitäten im ersten Jahrhundert vor Christus
- 6. Gender-Studies und antike Geschichtsschreibung.
- 7. Zusammenfassung der Beobachtungen und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Frauen in der römischen Geschichtsschreibung, insbesondere im Werk von Titus Livius und Gaius Sallust. Das Ziel ist es, die Darstellung von Frauen in ihren historischen Werken zu analysieren und ihre Bedeutung im Kontext der jeweiligen Geschichtsauffassungen zu verstehen. Die Arbeit beschäftigt sich mit folgenden Themenschwerpunkten: * **Frauen in der römischen Geschichtsschreibung:** Die Untersuchung fokussiert auf die Darstellung von Frauen in den Werken von Livius und Sallust. * **Geschichtsverständnis der römischen Geschichtsschreiber:** Die Arbeit analysiert die Geschichtsauffassungen von Livius und Sallust, um ihre Darstellung von Frauen im Kontext ihrer jeweiligen Intentionen zu verstehen. * **Gender-Studies und antike Geschichtsschreibung:** Die Arbeit untersucht die Relevanz der Gender-Studies für die Analyse der Darstellung von Frauen in der antiken Geschichtsschreibung. * **Weibliche Lebensrealitäten im ersten Jahrhundert vor Christus:** Die Arbeit beleuchtet die Lebensbedingungen von Frauen im ersten Jahrhundert vor Christus und versucht, die Darstellung von Frauen in den Werken von Livius und Sallust in diesem Kontext zu interpretieren.Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt die Intention der Arbeit dar und beleuchtet die Relevanz der Frage nach der Rolle von Frauen in der römischen Geschichtsschreibung. Im zweiten Kapitel werden die Geschichtsauffassungen von Livius und Sallust analysiert, um den Kontext ihrer Darstellung von Frauen zu verstehen. Das dritte Kapitel analysiert die Darstellung der Frauenfiguren Lucretia und Verginia in Livius' Ab urbe condita. Das vierte Kapitel untersucht die Darstellung der Frauenfiguren Fulvia und Sempronia in Sallusts Bellum Catilinarium.Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen und Themen wie: Römische Geschichtsschreibung, Titus Livius, Gaius Sallust, Ab urbe condita, Bellum Catilinarium, Frauenfiguren, Gender-Studies, Weibliche Lebensrealitäten im ersten Jahrhundert vor Christus.- Arbeit zitieren
- Jasmin Karimi (Autor:in), 2015, Frauen in der römischen Geschichtsschreibung. Die Darstellung historischer Frauenfiguren bei Livius und Sallust, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322287