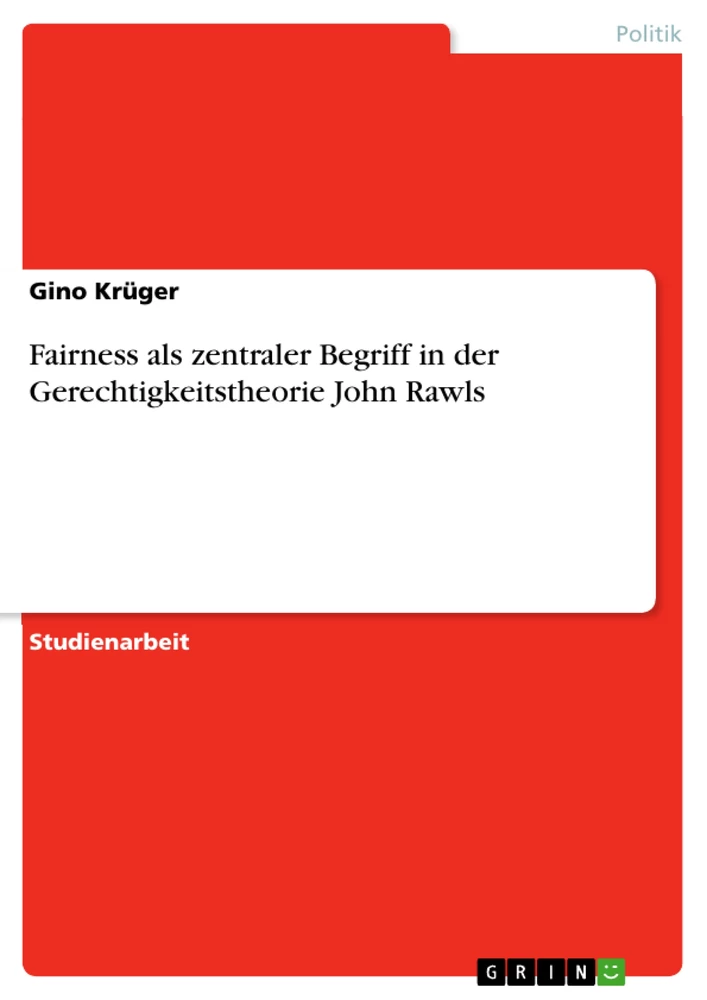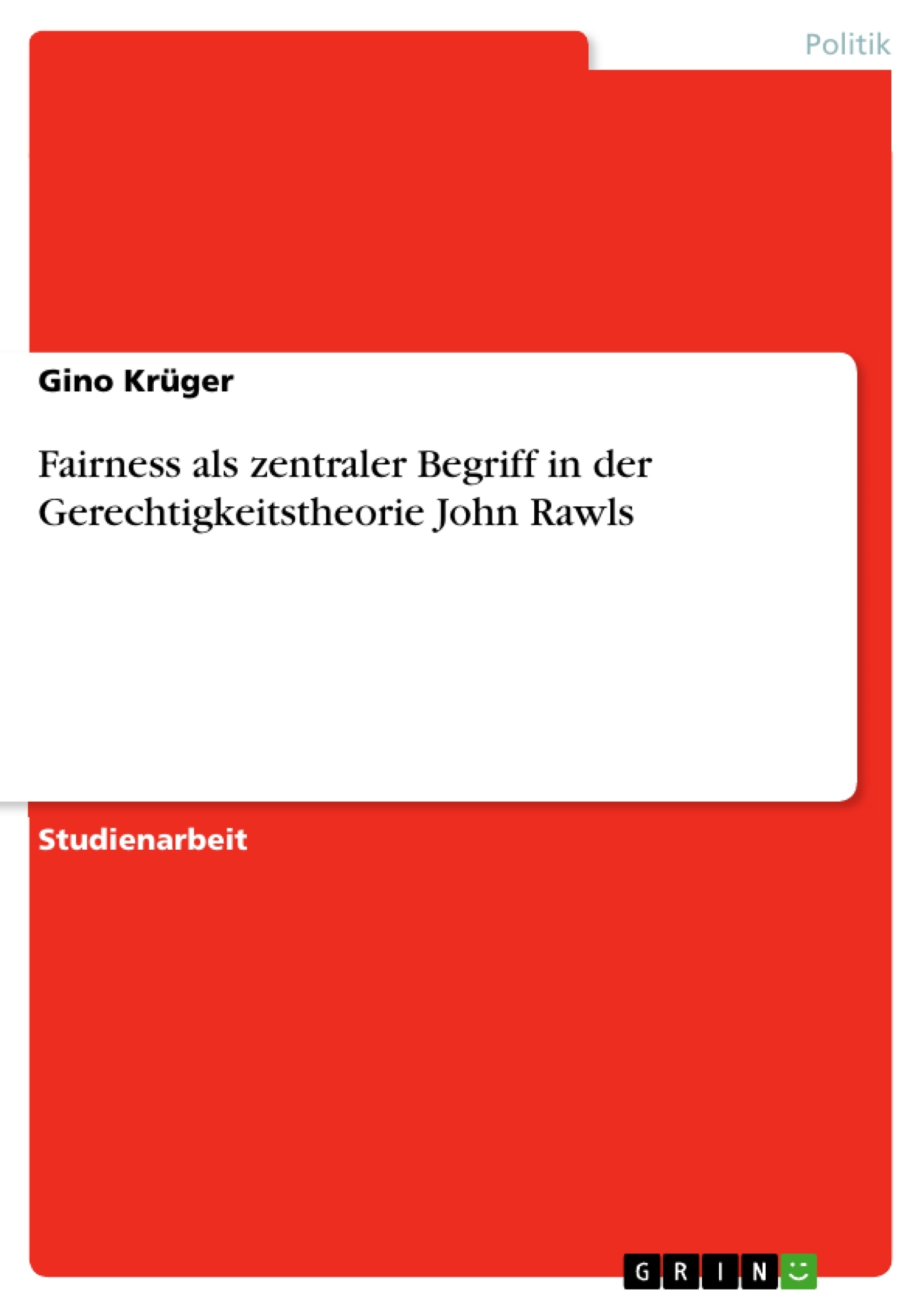Was ist Gerechtigkeit und warum schätzen wir sie so sehr? Jeder der sich bereits diese Frage gestellt hat wird wissen, dass die Antworten mannigfaltig sind. Aus der Perspektive der Philosophie wird Gerechtigkeit als ein normatives Konzept angesehen, das einen integralen Bestandteil des gemeinschaftlichen Zusammenlebens unter vernunftbegabten Individuen ausmacht. Soweit besteht zumindest schemenhaft ein Konsens in der Disziplin, doch schon bei der Frage – warum wir jenes Gut schätzen? – divergieren die Meinungen extrem.
Die einen erachten Gerechtigkeit als ein intrinsisches Gut an, als ein Gut das um seiner Selbstwillen anzustreben ist. Andere sehen in der Gerechtigkeit einen immanenten Bestandteil des Guten an sich und wiederum andere betrachten sie nur als instrumentell für andere Güter. Doch warum auch immer wir Gerechtigkeit schätzen, es scheint der Fall zu sein, dass wir sie schätzen und zumindest intuitiv eine Vorstellung davon haben was gerecht ist und was nicht. Eine Erklärung für dieses Phänomen ist möglicherweise die lange Tradition, in welcher Gerechtigkeitstheorien stehen, so fand man bspw. schon in den Überresten des prähistorischen Ägyptens theoretische Auseinandersetzungen mit der Idee der Gerechtigkeit.
Was aber noch weitaus erstaunlicher ist als die kontinuierliche Präsens dieses Gutes in der Historie der Menschheit, ist die Feststellung, dass sich die grundlegende Idee, nämlich das Gerechtigkeit darin bestünde „jedem das seine zukommen zu lassen (suum cuique)“, bis in die Gegenwart erhalten geblieben ist. Was sich im Laufe der Geschichte verändert hat sind die Vorstellungen davon warum man jedem das seine zukommen lassen sollte und was dieses seine ist. An diese Entwicklung wird die vorliegenden Ausarbeitung anknüpfen, indem sie eine einflussreiche Theorie der Gerechtigkeit, des 20. Jahrhunderts, rekonstruiert und erörtert. Die Gerechtigkeitstheorie, welche es zu untersuchen gilt, ist John Rawls' (1921-2002) „Gerechtigkeit als Fairness“. Es ist anzumerken, dass Rawls ein Vertreter des angelsächsischen Liberalismus ist, weshalb seine Theorie auf grundlegenden Prämissen der liberalen Weltsicht aufbaut.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Grundlagen der Rawls'schen Gerechtigkeitstheorie
- 1.1. Bedeutung der Gerechtigkeit
- 1.2. Rawls' Methodologie
- 2. Gerechtigkeit als Fairness
- 3. Die Rawls'schen Grundsätze der Gerechtigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit als Fairness und analysiert seine Grundgedanken sowie seine methodischen Ansätze. Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Gerechtigkeit in Rawls' politischer Konzeption und beleuchtet die zentralen Elemente seiner Gerechtigkeitstheorie, wie die Methodologie des Kontraktualismus und des Überlegungsgleichgewichts.
- Bedeutung von Gerechtigkeit in einer pluralistischen Gesellschaft
- Rawls' Methodologie des Kontraktualismus und des Überlegungsgleichgewichts
- Die Grundstruktur einer Gesellschaft und die Verteilung von Gütern
- Die Bedeutung der Gleichheit in Rawls' politischer Konzeption
- Die Rolle der Vernunft und des "Faktum des vernünftigen Pluralismus"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den Hintergrund und die Relevanz der Rawls'schen Gerechtigkeitstheorie. Das erste Kapitel analysiert die Grundlagen der Rawls'schen Gerechtigkeitstheorie, indem es die Bedeutung der Gerechtigkeit in seiner politischen Konzeption und die Rolle der Vernunft im Kontext des "Faktum des vernünftigen Pluralismus" beleuchtet. Das zweite Kapitel befasst sich mit Rawls' Argumentation für Gerechtigkeit als Fairness, wobei die zentralen Elemente seiner Theorie, wie der Urzustand und der Schleier des Nichtwissens, erläutert werden. Das dritte Kapitel analysiert die Rawls'schen Grundsätze der Gerechtigkeit, insbesondere die Prinzipien der Freiheit, der fairen Chancengleichheit und der Differenz.
Schlüsselwörter
Gerechtigkeit, Fairness, John Rawls, Politischer Liberalismus, Egalitärer Liberalismus, Kontraktualismus, Überlegungsgleichgewicht, Urzustand, Schleier des Nichtwissens, Grundstruktur der Gesellschaft, Verteilung von Gütern, Prinzipien der Gerechtigkeit, Freiheit, faire Chancengleichheit, Differenz.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht John Rawls unter "Gerechtigkeit als Fairness"?
Rawls sieht Gerechtigkeit als das Ergebnis fairer Ausgangsbedingungen, unter denen freie und vernünftige Menschen gemeinsamen Grundsätzen zustimmen würden.
Was ist der "Schleier des Nichtwissens"?
Es ist ein Gedankenexperiment, bei dem die Entscheider ihre eigene soziale Stellung, Talente und Interessen nicht kennen, um unvorgestimmte und faire Gerechtigkeitsprinzipien zu wählen.
Was besagt das Differenzprinzip?
Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind nur dann gerechtfertigt, wenn sie den am wenigsten begünstigten Mitgliedern der Gesellschaft den größten Vorteil bringen.
Was ist das "Überlegungsgleichgewicht"?
Ein methodischer Zustand, in dem unsere intuitiven Gerechtigkeitsvorstellungen und die gewählten theoretischen Prinzipien in Einklang gebracht werden.
Welche Rolle spielt der Liberalismus in Rawls' Theorie?
Rawls ist ein Vertreter des angelsächsischen Liberalismus; seine Theorie baut auf der Freiheit des Individuums und dem Faktum des vernünftigen Pluralismus auf.
- Arbeit zitieren
- Gino Krüger (Autor:in), 2013, Fairness als zentraler Begriff in der Gerechtigkeitstheorie John Rawls, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322318